Lexikon der Biologie: Gestalt
ESSAY
Robert Kaspar
Gestalt
Unter der Gestalt eines Lebewesens versteht man zunächst seine äußere Erscheinungsform, also den systematischen Zusammenhang der an ihm unmittelbar zu beobachtenden Merkmale . Organismen sind aber in ihrem Aufbau (Bauplan) stets hierarchisch geordnet, so daß das Phänomen der Gestalt nicht nur auf der Komplexitätsebene des ganzen Lebewesens selbst, sondern auch auf allen Ebenen seiner Substrukturen auftritt: ein Wirbel ist ebenso eine Gestalt wie ein Kiemenbogen, eine Epithelzelle oder ein spezifisches Immunglobulin-Molekül. Jedes System von Einzelstrukturen, zwischen denen ein geordneter, d.h. in der Biologie genetisch determinierter Zusammenhang besteht, nennt man eine Gestalt. So spricht man auch in der Ethologie (Ethologie [Geschichte der]) von der Zeitgestalt einer instinktiven Bewegungsweise oder in der Embryologie (Embryonalentwicklung; Entwicklungsbiologie [Geschichte der]) von der Gestalt eines Strukturbildungsprozesses, z.B. bei der Entstehung des Herzens der Säugetiere. Eine Gestalt weisen aber auch phylogenetische Vorgänge auf, wenn man etwa an die Evolution der Niere vom Pro- über den Meso- zum Metanephros denkt. Diejenige biologische Disziplin, die sich speziell mit dem Phänomen der Gestalt beschäftigt, ist die systematische und vergleichende Anatomie, ihre theoretische Methodenlehre ist die Morphologie.
Die schier grenzenlos erscheinende Gestalt-Variabilität gehört zu den spezifischen Eigentümlichkeiten des Lebendigen (Leben). Dies beginnt schon im Bereich der molekularen Strukturbildung: aus 100 Aminosäuren können theoretisch 10130 verschiedene Proteine gebildet werden. Um ein Vielfaches erhöht sich diese Zahl aber, wenn durch Kombination dieser Proteine makroskopische Strukturen gebildet werden. Selbstverständlich wird man aber nicht alles, was in dieser Weise an Formenmannigfaltigkeit möglich ist, im biologischen Sinne als Gestalt bezeichnen. So bietet bezeichnenderweise die Pathologie zahlreiche Beispiele dafür, daß die Strukturbildung bei Zell-Proliferationen, denen keine übergeordnete Information zugrunde liegt (wie dies für maligne Entartungen typisch ist; Krebs), nicht zu dem führt, was wir unter einer Gestalt verstehen. Vergleicht man etwa den Tumor eines Sarkoms mit dem Bild des gesunden Bindegewebes, so ist der Eindruck des Gestaltverlustes auch ohne spezielle histologische Diagnose offenkundig. Allein der normalerweise kaum reflektierte Umstand, daß Pathologie überhaupt möglich ist, zeigt, in welchem Ausmaß unser Verständnis der lebendigen Gestalt von der Tatsache abhängt, daß ihr nicht irgendeine, sondern eine ganz spezielle Information zugrunde liegt.
Sowohl das Phänomen der potentiell so gut wie unendlichen Mannigfaltigkeit als auch das Phänomen deren Limitierung und Kanalisierung scheint letztlich auf die Eigenschaften des genetischen Informationsspeichers (der DNA; Desoxyribonucleinsäuren, genetische Information, Genom) zurückzugehen. So wie in unserer aus Buchstaben kombinierten Schrift gleichermaßen die Möglichkeit zu komplexester Gestaltbildung wie auch zu deren völliger Paralyse steckt, vermag auch die DNA alles zwischen der Organisation eines Säugetieres und dessen irreversibler Zerstörung zu programmieren. Für das Problem der Gestalt ergibt sich daher die Frage, welches epigenetische System (epigenetisch) aus den Möglichkeiten der Kombination von Merkmalen jene auswählt bzw. zuläßt, die langfristig funktionell stabil sind. Damit erweist sich das Gestaltproblem als ein Spezialfall der prinzipiell phylogenetischen Frage nach den Gesetzen biologischer Strukturbildung.
Im Unterschied zu den vielzelligen Pflanzen, die infolge der Art ihres Energieerwerbes eine reiche Entfaltung in den Raum zeigen (und damit ihre äußere Reaktionsfläche vergrößern), erfolgt die Strukturbildung der Metazoa (Tiere) vorwiegend durch die Ausbildung und Differenzierung innererOrgane (Organsystem, Abb.). Bei den Schwämmen und Hohltieren bestimmt noch das Darmsystem (Darm) im wesentlichen die Tiergestalt, später kommen die anderen Organsysteme hinzu. Bedingt wird schließlich die Gestalt des Organismus durch die Parameter der Form, der Statik (Biomechanik), der Größe und der Proportionen. Dazu kommen in manchen Fällen die Farbornamentierung und die Skulpturierung der Körperoberfläche sowie die Ausbildung verschiedener Symmetrieverhältnisse (Symmetrie).
Untersucht man die anatomischen Verhältnisse einer Spezies (Art) mit der Absicht, diese nicht nur zu beschreiben (Beschreibung) und mit anderen Spezies () strukturell zu vergleichen (wie es die „klassische“ Morphologie tat), sondern diese Verhältnisse auch zu verstehen und zu erklären (Erklärung), dann wird offenkundig, daß der Großteil der Gestalt eines Lebewesens funktionell zu begründen ist (Funktionalismus). So ist z.B. die Struktur des menschlichen Oberschenkels viel weniger eine weiter nicht erklärbare „Selbstdarstellung“ des Lebendigen (A. Portmann) als die Funktion seiner statischen und dynamischen Belastungslinien. Auch das Beispiel der Häute (Haut) zeigt, daß die Form ausschließlich vom jeweiligen Kräfteverhältnis bestimmt wird; sie sind bekanntlich nur auf Zug belastbar und können vom Erbgut ebensowenig beeinflußt werden wie künstliche Häute vom Techniker (Segel, Schirme, Zelte usw.; Bionik). Hier ist also die Gestalt die Folge der physikalischen Bedingungen (Biophysik), und zwar sehr einfacher Bedingungen. Wenn die statischen und dynamischen Funktionen physikalisch komplizierter werden, wie das z.B. schon bei den Schalen der Fall ist (Belastung auf Zug, Druck und Biegung), dann bestehen bereits zahlreiche Möglichkeiten, diesen Funktionen strukturell Genüge zu leisten. Welche spezifische Gestalt daher in der einzelnen Spezies realisiert wird, ist in zunehmendem Maße auch eine Folge der genetischen Determination, d.h., die betreffende Gestalt muß zusätzlich aus ihrem historischen Werdegang erklärt werden. Das Beispiel der Funktion des Fliegens (Flug, Flugmechanik) zeigt mit besonderer Deutlichkeit, daß eine Gestalt neben ihren funktionellen auch historische Merkmale trägt. Es kann sich ja um den Flügel einer Biene (Insektenflügel), eines Sperlings (Vogelflügel) oder einer Fledermaus (Fledermäuse, Abb.) handeln. Von entscheidender Bedeutung ist aber der Umstand, daß die Geschichtlichkeit einer Gestalt weder einen Widerspruch noch eine Alternative zu ihrer Funktionalität darstellt, was besonders deshalb betont werden muß, weil manche Morphologen den phylogenetisch-deskriptiv-vergleichenden Aspekt in der Weise überschätzen, daß sie die historischen Aspekte einer Gestalt in deren Funktionslosigkeit erwarten. Das „Organ ohne Funktion“ ist aber deshalb noch nicht gefunden worden, weil es ein solches nicht geben kann!
In diesem Zusammenhang ist nochmals auf das Problem der „Selbstdarstellung“ zurückzukommen, weil der Gestaltreichtum der Lebewesen tatsächlich prima facie den Eindruck des Entstehens purer Schönheit erwecken kann, welche von unmittelbaren biologischen Funktionen losgelöst ist. Besonders das Phänomen der Farbornamentierung (Farbe) spielt dabei eine große Rolle. Die Färbung von Schmetterlingen, Korallenfischen, Paradiesvögeln usw. hat immer wieder zu der Vorstellung geführt, das Lebendige verschwende seine Gestaltungskraft zur zweckfreien Produktion reiner Schönheit (Ästhetik). Wiewohl nicht in Abrede gestellt werden kann, daß Schönheit in all diesen Fällen tatsächlich erlebbar ist, darf aber darob die Tatsache nicht vergessen werden, daß alle diese optischen Gestalt- und Musterbildungen keineswegs frei von biologischen Funktionen sind. Neben ihren physiologischen Funktionen besitzen die Farben vor allem ethologische Funktionen im Bereich der Tarnung (hier besteht der Zweck in einer Gestaltauflösung; Augentarnung, Schutzanpassungen, Schutztracht, Somatolyse), des Erschreckens (Augenmuster), des Warnens (grelle Färbung z.B. bei Raupen; Schreckfärbung, Warntracht), der Revierverteidigung (z.B. Korallenfische, bei denen, wie K. Lorenz sagte, jede Art ihre unverwechselbare Kriegsflagge führt) und den vielfältigen Formen der Mimikry (Farbtafel). In keinem einzigen Fall solcher Gestaltbildungen liegt Funktionslosigkeit vor, und schon gar nicht eine nur dem menschlichen Auge gewidmete Selbstdarstellung.
Es wäre aber ein schweres Mißverständnis der lebendigen Gestalt, wollte man annehmen, daß die Kenntnis der Funktion neben ihrer Existenz auch ihre Entstehung erklären würde. Denn bevor eine Gestalt in irgendeinem Funktionszusammenhang bestehen kann, muß sie herangebildet werden, und der Modus der Gestaltentstehung ist keine ausschließliche Folge ihrer Funktionen. Das Problem der Gestaltbildung gehört daher immer noch zu den großen Rätseln der Biologie. Unser kausales Verständnis der Entwicklung einer spezifischen Struktur endet beim Eiweißmolekül (Protein), dessen Herkunft von einer bestimmten DNA-Sequenz wir rekonstruieren können; wir wissen aber bereits nicht mehr, welche genetische Regulation (Genregulation) ein Auge, eine Hand oder das Gefieder eines Vogels entstehen läßt. Selbst die Frage nach den kausalen Mechanismen des typischen Informationsverlustes einer bösartigen Neoplasie ist bislang unbeantwortet, was nichts anderes bedeutet, als daß wir auch die kausalen Mechanismen der Entstehung des gesunden Organs nicht kennen.
Das ursächliche Verständnis der Gestalt ist daher ein Desiderat der Biologie. Man kann ihm auf zwei Wegen näherkommen: einmal auf dem Wege einer exakten Analyse der phylogenetischen Strukturbildung, mit dem Ziel, auf dieser makroskopischen Ebene morphogenetische Gesetzmäßigkeiten (Morphogenese) zu finden. Dieser Weg führt zwar nicht von selbst zu den Ursachen der Gestalt, besitzt aber großen heuristischen Wert, weil die Kenntnis phylogenetischer Gestaltbildungsgesetze die Möglichkeit schafft, gleichsam an der richtigen Stelle nach deren Kausalität zu fragen. Diese selbst nun, und dies ist der andere Weg, läßt sich letztlich in den molekularen Prinzipien des gesteuerten Zellwachstums finden. Auf diesem Gebiet liegt bereits eine Reihe höchst interessanter und vielversprechender Arbeiten vor, besonders im Bereich der Musterdetermination (Musterbildung, Musterbildung bei Pflanzen) während der Embryogenese, und es spricht vieles dafür, daß die lebendige Gestalt einst über diesen entwicklungsbiologischen Weg ursächlich verstanden werden kann. Dann wird es auch möglich sein, so komplexe Phänomene wie den Typus einer natürlichen Kategorie von der betrachtend-vergleichenden Anschauung zu einer biologischen Begründung zu führen. Nicht zuletzt sind es ja diese komplexen Formen der Gestalt und ihrer Metamorphosen, die nicht nur zur Erkenntnis der Evolution geführt haben, sondern uns auch das Grundproblem des Lebendigen vor Augen führen: auf welchen Prinzipien nämlich seine Information beruht. Somit ist die Gestaltforschung gleichsam der Anfang und das Ziel aller biologischen Erkenntnis. Allometrie, Biologie, Eidonomie, Lebensformtypus, Metamorphose, Organisation, Organizismus, Strukturalismus, Struktur-Funktion-Beziehung, Strukturvorhersage, Wachstum.
Lit.:Kaspar, R.: Der Typus – Idee und Realität. Acta Biotheor. 26, 181–195, 1977. Remane, A.: Die Grundlagen des natürlichen Systems, der vergleichenden Anatomie und der Phylogenetik. Königstein-Taunus, 1952. Riedl, R.: Die Ordnung des Lebendigen Hamburg 1975. Wolpert, L. et.al.: Entwicklungsbiologie. Heidelberg 1999.

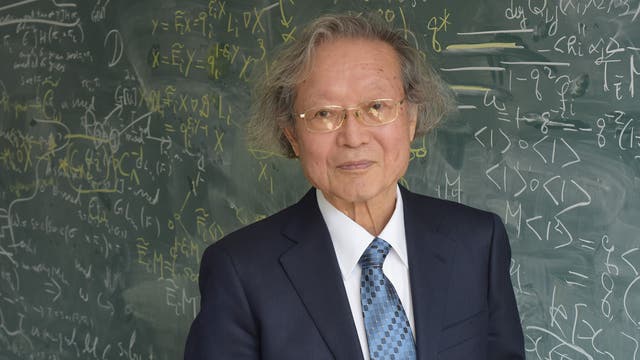





Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.