Publikationen: Risse im Fundament der Wissenschaft
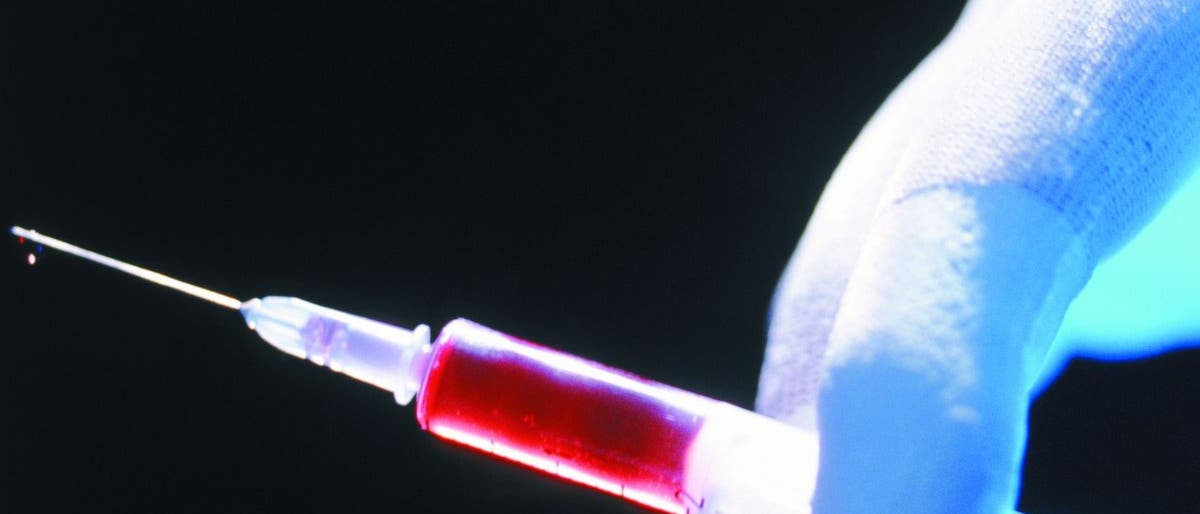
So solide das Fundament der Wissenschaft auch wirken mag, es hat Risse bekommen. Schuld sind ausnahmsweise nicht die üblichen Verdächtigen wie mangelnde Fördergelder, Fehlverhalten, politische Einflussnahme oder eine uninformierte Öffentlichkeit. Schuld ist, was Forscher als "Bias" bezeichnen: unvermeidbare systematische Fehler. Und er trifft die Forschung dort, wo es wehtut.
Statistische Verzerrungen, bestimmte Tendenzen im Publikationswesen, voreingenommene Wahrnehmung und all anderen Ausprägungen eines Bias sind aus der akademischen Welt nicht wegzudenken, gerade in Fachgebieten wie der Biomedizin, die mit komplexen Ursache-Wirkung-Beziehungen zu kämpfen hat und interne Systeme aufweist, die keiner zur Gänze überblickt. Nun könnte man annehmen, dass der Bias Studienergebnisse per Zufall in alle Richtungen verfälscht. Dann würde er sich mit steigender Zahl an Untersuchungen herausmitteln. Doch immer mehr zeigt sich: Diese Verzerrungen sind nicht zufällig.
In einem Kommentar in der Zeitschrift "Nature" war im März von einer Untersuchung der Pharmafirma Amgen zu lesen: Die Wissenschaftler hatten versucht, die Ergebnisse von 53 wegweisenden vorklinischen Krebsstudien zu bestätigen. Erfolg hatten sie in gerade einmal sechs Fällen. Auf ähnliche Ungereimtheiten weisen Wissenschaftler und auch Journalisten seit über zehn Jahren hin, und das mit wachsender Häufigkeit.
Warnzeichen gibt es seit Mitte der 1990er Jahre. Damals begannen Forscher, pharmageförderte klinische Studien auf etwaige positive Verzerrungen abzuklopfen. Anfangs glaubte man an einen leicht zu behebenden Missstand, und vermeldete erleichtert: Das Problem liege nicht in der Wissenschaft, sondern im Profitstreben der Firmen und ihrer Mitarbeiter. Mit strengen Richtlinien, die eine Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten sowie die Publikation auch misslungener Forschungsarbeiten verlangen, sei dem Problem beizukommen.
Bei genauerem Hinsehen zeigte sich dann aber, dass der Fehler tiefer sitzt: Die wissenschaftsinternen Kontrollmechanismen gegen Bias versagen offenbar regelmäßig bei der Auswahl und Veröffentlichung von Studienergebnissen. In der Folge sind in den Fachjournalen falschpositive Resultate systematisch überrepräsentiert. John Ioannidis, derzeit an der University of California beschäftigt, machte am deutlichsten auf dieses Problem aufmerksam: "Warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind", lautete der provokative Titel seines mittlerweile berühmten Artikels.
Wie aber lassen sich solche tiefgreifenden Fehlentwicklungen erklären? Schuld ist die wissenschaftliche Kultur: Ihr liegt eine Überzeugung zugrunde, die den Bias mit Macht in eine bestimmte Richtung drängt. Wissenschaft wird unter der Prämisse betrieben, dass Fortschritt grundsätzlich mit der stetigen Produktion von positiven Ergebnissen und einem immerwährenden Fortschritt gleichzusetzen sei. Dieses Prinzip kommt allen Beteiligten zugute – es ist intellektuell befriedigend, garantiert gleichermaßen Karriereschübe für Wissenschaftler und die Leitungsebene an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und auch das öffentliche Verlangen nach Fortschritt wird bedient. Anreize, ein offenbar negatives Ergebnis zu vermelden, Experimente zu wiederholen und Widersprüche oder Ungereimtheiten beim Namen zu nennen, gibt es praktisch nicht. Obwohl man dies weiß, ist es offenbar unglaublich schwierig, den nötigen Wandel in der Forschungskultur herbeizuführen.
Indem sie bei ihren Experimenten Fehlerquellen genau kontrollieren, versuchen Forscher mit möglichen Verzerrungen umzugehen. Im Ergebnis entfernen sie sich so allerdings immer weiter von der komplexen Wirklichkeit, innerhalb derer die Forschungsergebnisse ja ihre Anwendung finden sollten. Gerade in der Forschung mit Mausmodellen ist dies offensichtlich geworden. Diese hat Scharen von Wissenschaftlern angezogen und die Bereitstellung von Mitteln in entsprechender Höhe gewährleistet. Der Grund: Die Technologie lässt streng überprüfbare Versuchsanordnungen zu, die hochgradig replizierbar sind und exaktes Hypothesentesten erlauben – der heilige Gral wissenschaftlicher Methodik. Auf den Menschen übertragen versagen entsprechende Resultate ihrer Spezifität wegen jedoch oftmals.
Ein wie auch immer beeinflusstes Ergebnis ist allerdings so gut wie nutzlos, denn es kann in der wirklichen Welt keine praktische Anwendung finden. Daher ist es zwar ein bemerkenswertes Detail, wenngleich wenig überraschend, dass einige der beachtenswertesten Dokumentationen nutzloser Forschung aus der Pharmaindustrie selbst kommen. Deren Profit hängt nämlich direkt von der Brauchbarkeit der Forschungsergebnisse ab, da diese als Entscheidungsgrundlage bei der Entwicklung von neuen Medikamenten dienen.
Wissenschaft hat die Fähigkeit zur Selbstkorrektur – dies wird völlig zu Recht immer wieder hervorgehoben. Dennoch müssen uns die Vorkommnisse der biomedizinischen Forschung eine Lehre sein, dass Selbstkorrektur nicht allein über den Wettbewerb von Forschern untereinander funktionieren kann. Mindestens ebenso sehr hängt sie von der engen Bindung zwischen Forschung und Praxis ab – auf diese Weise ließe sich fehlerhaften Trends und nutzlosen Resultaten vorbeugen.
Bias ist zudem nicht allein ein Problem der biomedizinischen Forschung. Sehr wahrscheinlich sind alle Felder davon betroffen, die Vorhersagen in komplexen Systemen machen. Beispiele sind etwa die Ökonomie und Ökologie, die Umweltwissenschaften oder die Epidemiologie. Dies herauszufinden ist jedoch ungleich schwerer. Eine direkte technologische Umsetzung und somit eine unmittelbare Überprüfung von Forschungsergebnissen ist in den genannten Disziplinen nur begrenzt oder überhaupt nicht möglich.
Sollte sich herausstellen, dass die Wissenschaft nicht in der Lage ist, ihren selbstformulierten Anforderungen gerecht zu werden, wäre der gesellschaftliche Schaden nicht abzuschätzen. Mögliche Auswege reichen von einer Reduzierung des Presserummels, der immer wieder um bestimmte Prestigeprojekte stattfindet, bis zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung und der Industrie. Der erste Schritt sollte jedoch sein, sich der Problematik zu stellen – und zwar bevor das Fundament der Wissenschaft allzu brüchig wird.
Der Artikel erschien unter dem Titel "Beware the creeping cracks of bias" in Nature 485, S. 149, 2012

Schreiben Sie uns!
9 Beiträge anzeigen