Wege und Irrwege des Konrad Zuse
Konrad Zuse (1910 bis 1995) zählt zu den großen Erfindern, nicht nur im Rahmen dieses Jahrhunderts. Unter abenteuerlichen Umständen konstruierte er vor dem und im Zweiten Weltkrieg die ersten Geräte, die nach heutiger Auffassung den Namen Computer verdienen. Nach dem Krieg betrieb er die erste Computerfabrik der Welt, bis diese 1964 vom Siemens-Konzern übernommen wurde.
Von da an nutzte er die lange Zeit des erzwungenen Ruhestandes, um eine Fülle von Ideen, sowohl rein theoretische als auch konstruktive, auszuarbeiten. Dabei nahm er einige Konzepte vorweg, die mittlerweile für die Entwicklung von Forschung und Praxis der elektronischen Datenverarbeitung höchst bedeutsam geworden sind, so die des zellulären Automaten und des Parallelrechners. Andere Vorstellungen, wie die vom rechnenden Raum, sind heute noch so spekulativ, daß man nichts Rechtes damit anzufangen weiß. Neben all seiner wissenschaftlichen Tätigkeit brachte er es auch als Maler autodidaktisch zu Anerkennung und Meisterschaft.
Lehr- und Wanderjahre
Konrad Zuse wurde am 22. Juni 1910 in Berlin als Sohn einer preußischen Beamtenfamilie geboren. Im sächsischen Hoyerswerda, wo sein Vater in der Zwischenzeit zum Oberpostmeister aufgestiegen war, bestand er 1927 die Reifeprüfung.
Schwankend zwischen künstlerischen und technischen Neigungen, entschied er sich zunächst, Maschinenbau an der Technischen Hochschule zu Berlin-Charlottenburg zu studieren. Aber die Übungen im Maschinenzeichnen "ließen dem schöpferischen Geist nur wenig Freiheit in der Art der Darstellung; alles war genormt und festgelegt: die Strichdicken, die Art der Vermaßung, selbst die Plätze, an die die Maßzahlen zu setzen waren", so Zuse in seiner Autobiographie "Der Computer – Mein Lebenswerk".
Er sattelte um auf Architektur und wurde wieder enttäuscht, denn auch dort gab es in den ersten Semestern nichts Großartiges zu entwerfen, sondern dorische und ionische Säulen zu zeichnen. So wechselte er nochmals das Studienfach; der Bauingenieur erschien ihm nun als ideale Kombination zwischen Künstler und Ingenieur.
Über die Themen seines Studiums berichtete er auffällig wenig. Der nachhaltigste Eindruck dieser Zeit scheint eine tiefverwurzelte Abneigung gegen die komplizierten statischen Berechnungen gewesen zu sein, mit denen damals die Studenten gequält wurden. Später motivierten ihn diese Erfahrungen, sich über eine programmgesteuerte Rechenmaschine Gedanken zu machen, mit der sich solche Fron ersparen ließe.
Schon während des Studiums interessierte sich Zuse für Automaten und Automatisierungsmöglichkeiten aller Art: Er zeichnete Selbstauslöser sowie automatische Kameras und Entwicklungsgeräte und baute einen funktionsfähigen Verkaufsautomaten, bei dem man Waren verschiedener Preise und Mengen nacheinander an einer Wählscheibe bestellen konnte. Die Einzelpreise wurden im Automaten addiert; dann gab er nach Einwerfen der Gesamtsumme in beliebigen Münzen die Ware aus. Alle anderen dieser Projekte verblieben auf dem Papier – "zu Recht", so sein eigenes Urteil ein halbes Jahrhundert später.
Auch später verlief sein Studium alles andere als geradlinig. So ließ er sich nach dem Vorexamen fast ein Jahr lang beurlauben, um – ohne Ausbildung – Reklamezeichner zu werden. Daß er die Diplomprüfung bestand, erschien ihm noch Jahrzehnte später als ein Wunder.
Die ersten Rechner
Eine Stelle als Statiker bei den Henschel-Flugzeug-Werken gab er bald wieder auf. Er wollte sich fortan ausschließlich mit der Entwicklung eines digitalen Rechenautomaten befassen. Dazu richtete er sich in Berlin-Kreuzberg eine Werkstatt ein – im Wohnzimmer seiner Eltern, die darüber "nicht eben begeistert" waren. Zwar hatte er keinerlei Erfahrung mit der Technik der damals verbreiteten dezimalen mechanischen Tischrechenmaschinen, aber er steckte voller Ideen. Unterstützt nur von seinen Eltern und einigen Freunden, entwickelte Zuse in den Jahren 1936 bis 1938 einen Rechner, den er Z1 nannte (Bild 1). Schon für dieses erste Versuchsmodell benutzte er – als erster Konstrukteur überhaupt – das von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716; Bild 2) mathematisch-theoretisch eingeführte Zahlensystem zur Basis 2, in dem es nur die Ziffern 0 und 1 gibt; Leibniz hatte seinerseits auf den Arbeiten des spanisch-italienischen Bischofs Giovanni Caramuel y Lobkowitz (1606 bis 1682) aufgebaut. Zuse nannte es Sekundalsystem, während heute die Namen Binär- oder Dualsystem üblich sind. Ohne die Schaltalgebra zu kennen, die heute den Namen des englischen Mathematikers George Boole (1815 bis 1864) trägt, entwickelte der Erfinder, was er Bedingungskombinatorik nannte: die theoretische Analyse von Konstruktionen, die aus Bauelementen mit nur zwei ausgezeichneten Zuständen bestehen, wie Relais (Bild 3) oder seine selbstkonstruierten mechanischen Elemente. Später erkannte er, "daß diese formal identisch mit dem Aussagenkalkül der mathematischen Logik ist". Die beiden Zustände der elementaren Bauteile kann man mit den Wahrheitswerten falsch und wahr identifizieren. Das Gerät arbeitet, indem es diese Wahrheitswerte schaltungstechnisch zu neuen Wahrheitswerten verknüpft. Es realisiert also die elementaren Verknüpfungsoperationen des Aussagenkalküls: Konjunktion, Disjunktion und Negation (Bild 4). Im Prinzip lassen sich alle Verknüpfungen von Aussagen mit diesen drei Operationen ausdrücken (Bild 5). Andererseits kann man die Wahrheitswerte falsch und wahr mit den Binärziffern 0 beziehungsweise 1 identifizieren. Insbesondere ist jede Rechenoperation mit Binärzahlen durch die Verknüpfungsoperationen des Aussagenkalküls ausdrückbar (Bild 6). Nach diesem allgemeinen Prinzip arbeiten alle Computer. Rechenwerk und Speicher der Z1 realisierte Zuse rein mechanisch; völlig eigenständig entwickelte er das, was er später die mechanische Schaltgliedtechnik nannte. Aus heutiger Sicht ist es wenig einleuchtend, warum Zuse nicht von Anfang an die ihm wohlbekannten Fernmelderelais verwendete. Statt über ein aufwendiges, fehleranfälliges Gestänge hätte er Informationen innerhalb der Maschine über einen einfachen, nahezu beliebig verlegbaren Draht übermitteln lassen können. Tatsächlich hatte er das zunächst erwogen, war dann aber davor zurückgeschreckt. Die Speicherkapazität für nur 1000 Zahlen (die Chips der neuen Eurocheque-Karten enthalten ein Vielfaches) hätte ungefähr 40000 Relais erfordert: ein Zimmer voller Schaltschränke. Schon die Z1 konnte Zahlen in Gleitkommadarstellung verarbeiten (damals war die Bezeichung "halblogarithmische Darstellung" gebräuchlich). Das ist die in der Technik und beim numerischen Rechnen verbreitete Schreibweise: Statt 17554 schreibt man 1,7554×104. Man normalisiert also die Darstellung derart, daß die Mantisse (im Beispiel 1,7554) das Komma an einer festgelegten Stelle hat und der Exponent (im Beispiel 4) Auskunft über die Größenordnung der Zahl gibt. Eine analoge Darstellung mit Exponenten von 2 statt von 10 gibt es auch für Binärzahlen. Innerhalb der Maschine ist für Mantisse und Exponent jeweils eine feste Anzahl von Binärstellen reserviert. Bei festgelegter Gesamtzahl an Bits hat also die Gleitkommadarstellung weniger Mantissenstellen und damit eine geringere Genauigkeit als die Festkommadarstellung (ohne Exponenten). Dafür deckt sie jedoch einen Bereich von sehr kleinen bis zu sehr großen Zahlen mit gleichbleibender Genauigkeit ab. Die Rechenoperationen für Gleitkommazahlen sind viel komplizierter als für Festkommazahlen, weswegen es zum Beispiel für Personal Computer darauf spezialisierte Koprozessoren gibt. Der mechanische Speicher der Z1 funktionierte einwandfrei; den Versuch, ein ebenfalls mechanisches Rechenwerk zu konstruieren, mußte Zuse hingegen nach zwei Jahren mühsamen Probierens aufgeben. Es ging ihm da nicht besser als fast 100 Jahre zuvor dem englischen Mathematiker und Erfinder Charles Babbage (1791 bis 1871), dessen Differenzenmaschinen nicht an Entwurfsfehlern, sondern an mangelnder Präzision der Bauteile scheiterten (Spektrum der Wissenschaft, April 1993, Seite 78). Zu Zuses Zeiten war die Feinmechanik zwar weiter fortgeschritten, aber er konnte sie aus Geldmangel nicht nutzen: Gemeinsam mit Freunden sägte er die Schaltbleche für sein Gerät nach einer Papierschablone mit der Laubsäge zurecht (Bild 8). Zudem lernte er die Werke Babbages, der als erster eine programmgesteuerte Rechenanlage konzipiert hatte, erst nach dem Kriege kennen, als ein Prüfer des amerikanischen Patentamts sie ihm entgegenhielt. Später nannte er den Namen Babbage stets mit dem größten Respekt. Immerhin entwickelte der Erfinder bei diesen mühsamen Experimenten die Grundlagen der Schaltungstechnik, und das bedeutete nicht weniger als die Umsetzung der mathematischen Logik in funktionsfähige Rechen- und Speichereinheiten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse erwiesen sich beim Übergang auf die Elektromechanik und später die Elektronik als äußerst hilfreich. Ungefähr zur gleichen Zeit – 1937 – veröffentlichte der englische Mathematiker Alan M. Turing (1912 bis 1954) seine Arbeit "On Computable Numbers", in der er den Übergang von der mathematischen Logik zum Modell der Rechenmaschine vollzog (Spektrum der Wissenschaft, Juli 1984, Seite 34). Aber Zuse, der den genau umgekehrten Weg ging, kannte auch ihn nicht. Das nächste Versuchsmodell, die Z2, hatte ein Rechenwerk in Relaistechnik, wohingegen Zuse beim Speicherwerk die bewährte mechanische Schaltgliedtechnik beibehielt. Diesmal verzichtete er auf die Gleitkommaeinrichtung. Die Z2 funktionierte sehr unzuverlässig, weil der junge Konstrukteur bei den gebrauchten Telephonrelais, auf die er aus Materialnot angewiesen war, Ruhekontakte zu Arbeitskontakten umbiegen mußte. Nur ein einziges Mal arbeitete sie einwandfrei: bei einer Vorführung für die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof. Dieser Zufallserfolg brachte Zuse eine bescheidene finanzielle Förderung für die weiteren Arbeiten ein. Als sein Studienfreund Helmut Schreyer, ein Fernmeldeingenieur, die seltsamen Bleche in der Wohnzimmer-Werkstatt sah, äußerte er spontan: "Das mußt du mit Röhren machen." Zuse hielt das erst einmal für eine Schnapsidee – mit Röhren baute man Radios, und Radiobastler war er nie gewesen. Doch diese Anregung erwies sich als eine der folgenschwersten und wichtigsten Ideen der gesamten Computerentwicklung. Schreyer entwarf – wahrscheinlich als erster – Röhrenschaltungen für Rechenautomaten, und die beiden Freunde realisierten auch Versuchsschaltungen. Bereits 1938 führten sie einem kleinen Kreis von Experten an der Technischen Hochschule Charlottenburg ein funktionsfähiges Modell vor. In dieser Schaltung waren Glimmlampen und Röhren so kombiniert, daß die Röhren die Funktion der Wicklung eines Relais und die Glimmlampen die Funktion der Kontakte übernahmen. Die Ansprechzeit einer Glimmlampe – im wesentlichen ihre Ionisierungszeit – ist um Größenordnungen kürzer als die eines Relais, so daß fünf- bis zehntausend Schaltungen pro Sekunde im Prinzip möglich wurden. Dadurch hätte sich die Arbeitsgeschwindigkeit einer Rechenmaschine vertausendfacht. Das Auditorium reagierte mit Kopfschütteln. Im Jahre 1941 vollendete Zuse, immer noch im elterlichen Wohnzimmer, den ersten funktionsfähigen vollautomatischen, programmierbaren Digitalcomputer der Welt: die Z3 (Bild 7 links). Die Maschine enthielt 600 Relais im Rechen- und 1400 im Speicherwerk. Die Gesamtspeicherkapazität betrug 64 Wörter zu je 22 Bit. Nur die (zahlenmäßigen) Daten wurden dort abgelegt; das steuernde Programm stand auf einem Lochstreifen. Ausgegeben wurden die Resultate durch Anzeige auf Lampenstreifen. Für eine Multiplikation, eine Division oder das Ziehen einer Quadratwurzel benötigte die Z3 etwa drei Sekunden. (In einem weiteren Beitrag zu dieser Zeitschrift wird die Funktion der Z3 ausführlich beschrieben werden.) Die amerikanische Konkurrenz war 1941 noch längst nicht so weit. Sie verfügte zwar über weit bessere finanzielle Möglichkeiten als Zuse, und infolge der weltpolitischen Lage nach dem Zweiten Weltkrieg erlangten ihre Ergebnisse den größeren Ruhm und begründeten einen immensen wirtschaftlichen Erfolg. Aber funktionsfähige Computer konnte sie erst Jahre nach Zuse fertigstellen: so Howard Aiken 1944 seinen Relaisrechner MARK I an der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts) sowie John W. Mauchly und J. Presper Eckert 1945 ihre Röhrenmaschine ENIAC an der Universität von Pennsylvania in Philadelphia. Die Konstrukteure dies- und jenseits des Atlantiks wußten während des Krieges nichts voneinander. Heute ist Konrad Zuse weltweit als Erfinder des digitalen Computers anerkannt, auch in den USA, wo es für einen Europäer nach wie vor nicht leicht ist, mit Pioniertaten respektiert zu werden.
Der Von-Neumann-Rechner
Seine frühen Rechner nutzte Zuse zunächst nur zur Lösung numerischer Rechenprobleme. Schon bald sah er aber Möglichkeiten, den Anwendungsbereich zu erweitern: Programme sind ebenso wie Daten aus Folgen von Bits aufgebaut. Ein Loch in dem Lochstreifen, der Zuses frühe Rechner steuerte, steht für eine Eins, die Abwesenheit eines Lochs für eine Null. Indem ein Schrittmotor den Lochstreifen für jeden Rechentakt einen Schritt weiterbewegt, teilt er der Maschine mit, welche Instruktion als nächste auszuführen ist. Wenn eine Folge von Befehlen mehrfach auszuführen ist, was häufig vorkommt, braucht man nur Anfang und Ende des entsprechenden Lochstreifens zusammenzukleben und die entstehende Schleife mehrfach durchlaufen zu lassen.
Programme sind, so gesehen, im Grunde dasselbe wie Daten. Also kann eine Maschine mit ihnen auch dasselbe tun: sie abspeichern, wieder hervorholen, logische Verknüpfungen – insbesondere Berechnungen – mit ihnen anstellen und sie verändern. An die Stelle des Schrittmotors tritt ein Zählwerk. Nachdem eine Anweisung abgearbeitet ist, zählt dieser sogenannte Instruktionszähler eins höher, so wie ein Erstkläßler beim Lesen mit dem Finger ein Wort weiterrutscht; die Zahl, die er dann anzeigt, ist die Nummer (in heutiger Sprechweise die Adresse) des Speicherplatzes, auf dem die nächste auszuführende Anweisung steht.
Eine solche Anweisung kann insbesondere darin bestehen, den Inhalt des Instruktionszählers zu ändern. Der gedachte Lesefinger rutscht also an eine völlig andere Stelle im Text. So kann der Ablauf des Programms nicht nur Schleifen enthalten, sondern auch vom Ergebnis der bisherigen Berechnung abhängig gemacht werden. Das ist heute allgemein übliche Programmierpraxis.
Ein Programm kann aber auch Anweisungen enthalten, die es selbst verändern. Das eröffnet Möglichkeiten für absonderliche und völlig undurchschaubare Manipulationen; sie werden außer in Spielen wie "Krieg der Kerne" (Spektrum der Wissenschaft, Januar 1993, Seite 10) nur zu kriminellen Zwecken verwendet. Computerviren sind berüchtigte Beispiele.
Heute trägt das Konzept des Universalrechners mit im Speicher abgelegtem Programm den Namen des ungarisch-amerikanischen Mathematikers John von Neumann (1903 bis 1957), der diese Ideen 1945 am Institute for Advanced Studies in Princeton (New Jersey) vorstellte. Von den Sonderformen der Parallelrechner abgesehen, sind die heutigen (sequentiellen) Computer sämtlich Weiterentwicklungen dieses klassischen Universalrechners.
Zuse hatte dieses Konzept antizipiert. Schon 1943 arbeitete er Patentzeichnungen für Geräte mit Programmspeicherung und Adreßrechnung aus; des weiteren hatte er assoziative Speicher vorgesehen. Auch in diesem Falle wußten die beiden Forscher nichts voneinander. Während des Krieges wäre allerdings ein leistungsfähiger Computer mit Speicherprogramm in mechanischer oder elektromechanischer Technik kaum realisierbar gewesen.
Ein weiteres kommt hinzu. Zuse hatte erkannt, daß die Möglichkeiten des Computers ins Undurchschaubare anwachsen, wenn das Ergebnis der Rechnung auf Ablauf und Gestaltung des Programms zurückwirken kann. "Ich hatte, offen gesagt, eine Scheu davor, diesen Schritt zu vollziehen. Solange dieser Draht nicht gelegt ist, sind die Computer in ihren Möglichkeiten gut zu übersehen und zu beherrschen. Ist aber der freie Programmablauf erst einmal möglich, ist es schwer, die Grenze zu erkennen, an der man sagen könnte: bis hierher und nicht weiter."
Aus heutiger Sicht mutet es merkwürdig an, daß Zuse die Grenze zur Unbeherrschbarkeit bereits bei der bedingten Verzweigung sah, die längst Allerweltsbestandteil jedes Programms ist. Aber seine Selbstbeschränkung hätte ohnehin nichts genutzt; denn andere hatten keine Hemmungen, den entscheidenden Draht zu legen. Zum Problem des Neuerers, dem seine Schöpfung aus der Hand gleitet, hat Zuse an anderer Stelle bemerkt: "Der Erfinder, so wird gefordert, möge seine Entdeckungen zuallererst der Öffentlichkeit präsentieren und sodann deren Erlaubnis einholen, an ihnen weiterzuarbeiten... Ich selber will diesbezüglich Zweifel nicht verhehlen... Es ist eben so, daß eine Erfindung in der Regel erst dann öffentliches Interesse findet, wenn aus dem noch formbaren kleinen Kind sozusagen ein strammer Bursche geworden ist, der sich, um im Bild zu bleiben, so leicht nicht mehr herumkommandieren läßt. Die Freiheit des Forschers und Erfinders wird hier oft überschätzt... Will er seine Ideen durchsetzen, muß er sich mit Mächten einlassen, deren Realitätssinn schärfer und ausgeprägter ist. In der heutigen Zeit sind solche Mächte, ohne daß ich damit ein Werturteil aussprechen möchte, vornehmlich Militärs und Manager... Nach meiner Erfahrung sind die Chancen des einzelnen, sich gegen solches Paktieren zu wehren, gering."
In der Kreuzberger Wohnzimmer-Werkstatt entstanden auch noch zwei Spezialrechner. Die S1 wurde bei den Henschel-Flugzeug-Werken 1942 zur vollautomatischen Vermessung der Tragflügel, Leitwerke und Querruder ferngesteuerter Flugkörper über eine Meßbrücke praktisch eingesetzt. Sie war mit 800 Relais bestückt, arbeitete binär mit festem Komma und 12 Bit Wortlänge. Das Programm war fest eingebaut und auf Schrittschaltern verdrahtet.
Diese Vermessungsaufgabe regte Zuse zu einem weiteren Gedanken an: Das Ablesen von Meßgeräten müßte sich ebenfalls automatisieren lassen. Damit war die Idee der Prozeßsteuerung geboren, und 1944 entstand die S2 als erster Prozeßrechner der Welt. Zuse konstruierte spezielle Meßgeräte (Analog-Digital-Wandler), bei denen die Positionen der Meßuhren schrittweise vom Rechner her abgetastet wurden. Gleichzeitig lief der Schrittschalter im Rechner mit, der die abgelesenen Positionen als Binärzahlen auf das Rechenwerk übertrug. Die S2 funktionierte einwandfrei, kam aber nicht mehr zum praktischen Einsatz.
Als letztes Modell während des Krieges entstand die Z4 (Bild 7 rechts), ein Nachfolger der Z3. Das Rechenwerk bestand aus 2200 Relais, der Speicher war zunächst wieder in mechanischer Schaltgliedtechnik ausgeführt. Anfang 1945 konnte die Z4 als funktionsfähig bezeichnet werden. Nach dem Kriege wurden ein Lochstreifenleser zur Eingabe von Unterprogrammen und ein Magnetkernspeicher eingebaut.
Zusammen mit ihrem Erfinder gelangte die Z4 gegen Kriegsende auf abenteuerlichen Wegen von Berlin nach Hinterstein im Allgäu. Sie war die einzige Maschine, die Zuse retten konnte; alle anderen wurden in den letzten Bombennächten in Berlin zerstört oder fielen der Roten Armee in die Hände.
Die aus heutiger Sicht kläglich bescheidenen Möglichkeiten seiner Konstruktionen hinderten Zuse nicht daran, weit über das Zahlenrechnen hinaus Anwendungen vorauszudenken, wie sie zum Teil erst Jahrzehnte später realisiert wurden. Das nicht-numerische Problem, das er als Paradebeispiel auf dem Papier sehr weitgehend bearbeitete, war das Schachspiel. Er erlebte gerade noch, wie die späten Nachfolger seiner Relaismaschinen Schachgroßmeister in arge Bedrängnis brachten.
Engagement als Unternehmer
Sobald die Verhältnisse nach dem Kriege es erlaubten, gründete Zuse sein Ingenieurbüro neu. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich mietete die umgebaute Z4 für fünf Jahre. Leicht hätten die Schweizer einen amerikanischen Rechner erwerben können. Mit der Wahl des deutschen Gerätes gaben sie der mitteleuropäischen Entwicklung enormen Auftrieb. Hier entwickelten sich die wissenschaftlichen Hochschulen zu ersten Stätten des Rechnerbaus. Die Computer-Pioniere im deutschsprachigen Raum, vor allem Heinz Zemanek und Friedrich L. Bauer (Bild 9), bauten auf Zuses Erfahrungen auf.
Die Einnahmen aus der Vermietung der Z4 bildeten die Eigenkapitalbasis der 1949 zunächst in Neukirchen ansässigen Zuse KG; später übersiedelte die Firma in das nahe Bad Hersfeld.
Ein Versuch der Zuse KG, mit IBM zusammenzuarbeiten, scheiterte zwar, doch erhielt sie von der Firma Remington Rand einen Auftrag zur Entwicklung eines Zusatzrechners für Lochkartengeräte in mechanischer Schaltgliedtechnik. Die Amerikaner vertrauten offenbar auf die Zuverlässigkeit dieser Technologie, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon überholt war.
Die Zuse KG kam gut auf den Markt: Von dem Relaisrechner Z11 konnten 38 Exemplare verkauft werden. Der erste Röhrenrechner Z22 hatte bereits einen Trommelspeicher sowie einen besonders flexiblen Befehlssatz unter Verwendung funktioneller Bits; das sind Teile des Befehlswortes, die unabhängig von dem Hauptbefehl, mit dem sie verknüpft sind, Schaltfunktionen auslösen. Das war zu dieser Zeit Spitzentechnologie.
Mit der Gründung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1951 hatten die Hochschulen plötzlich Geld, um Computer anzuschaffen. Zugleich aber wuchs die Konkurrenz für Zuses Firma heran: Die Großkonzerne Siemens, Telefunken und Standard Elektrik begannen mit der industriellen Computerproduktion. Im härter werdenden Markt setzte sich die Z22 durch, aber es war Zeit, auf Transistormaschinen überzugehen. Das geschah auch mit der Z23.
Mit dem Nachfolgemodell Z31 hatte die Firma Pech. Es sollte eine kleine, billige Maschine besonders für kommerzielle Anwendungen werden; aber die Konzeption mißlang: Das Modell wuchs und wuchs und erreichte fast die Leistungsfähigkeit der Z23. Damit konnte die Software-Entwicklung, die Zuse in ihrer Bedeutung völlig unterschätzt hatte, nicht schritthalten. Man mußte sich auf Spezialanwendungen beschränken, und der finanzielle Erfolg blieb aus.
Zuse versuchte es nochmals mit einem kleinen Rechner, einer Kurzwortmaschine mit 18 Bit Wortlänge. Aber diese Idee kam zu früh, genau wie die der Feldrechenmaschine, eines Parallelrechners.
Im Jahre 1960 wurde die Lage kritisch. Selbst zwei Jahre später hätte der Inhaber sich noch günstig von seiner Firma trennen können; aber Zuse hoffte immer noch, aus eigener Kraft durchzukommen. Im Jahre 1964 mußte er an Brown, Boveri & Cie verkaufen. Später übernahm Siemens das kleine Unternehmen, das in dem großen Konzern fast spurlos aufging.
Als Unternehmer ist Zuse gescheitert. Seitdem lebte er in vergleichsweise bescheidenen, jedoch gesicherten finanziellen Verhältnissen als Privatmann. Dies begriff er auch als Chance: Endlich hatte er Zeit, sich wieder mit wissenschaftlichen Problemen zu beschäftigen, was seinem Genius eher entsprach als die Tätigkeit eines Geschäftsmanns (Bild 10).
Der Plankalkül
Schon bald nach Fertigstellung der Z3 war Zuse klargeworden, daß eine breitere Anwendung seiner Computer über das rein numerische Rechnen hinaus ohne eine formale Programmiersprache nicht zu erreichen war. Daraufhin begann er mit der Entwicklung dessen, was er später den Plankalkül nannte. Als ihm 1945 nach Evakuierung und Flucht im Allgäu weder Geld noch Material oder Werkstatt zur Weiterentwicklung seiner Rechner zur Verfügung standen, hatte er erstmals Zeit gefunden, seine Überlegungen dazu systematisch zu überdenken und zum Teil schriftlich niederzulegen. Diese Forschungen nahm er 1964 wieder auf.
"Rechnen heißt, aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben bilden." Diese Definition aus Zuses (nie eingereichter) Dissertation, die den landläufigen Begriff vom Rechnen stark verallgemeinert, beschreibt genau die Tätigkeit eines Computers (nur spricht man inzwischen von Daten statt von Angaben und von Algorithmus statt von Vorschrift). Es ist allerdings nicht einfach, diese Vorschrift erstens so zu formulieren, daß das Ergebnis in jedem Einzelfalle den Vorstellungen des Benutzers entspricht, und sie zweitens in eine Folge elementarer Operationen aufzulösen, welche die Maschine ausführen kann. Der ersten Aufgabe dienen heute die Programmiersprachen wie Fortran, Pascal oder C, der zweiten spezielle Computerprogramme, die Compiler.
Der Formalismus, den Zuse unter dem Namen Plankalkül entwickelte, überdeckte den ganzen Bereich von der groben, teilweise in Umgangssprache formulierten Beschreibung eines Verfahrens bis hinunter zu Anweisungen, wie einzelne Bits logisch im Sinne des Aussagenkalküls miteinander zu verknüpfen sind. Aus einem nach dem Plankalkül notierten Rechenplan (Programm) ging eindeutig hervor, aus welchen Variablen welche Resultate abzuleiten sind. Sämtliche Ansätze (Berechnungsvorschriften) für Zwischenwerte und Endresultate wurden explizit notiert, so daß nach Einsetzen der Variablen das Resultat ohne weitere Umformungen abgeleitet werden kann. In diesem Stadium der Bearbeitung kam der Plankalkül bereits ohne die Umgangssprache aus; die weitere Umwandlung in einen maschinenfertigen Rechenplan war nur noch eine formale Manipulation mit Symbolen.
Damit hatte der Plankalkül bereits wesentliche Eigenschaften einer modernen Programmiersprache: Man konnte die Vorschrift zunächst ohne Rücksicht auf die technische Realisierung zusammenfassend in einer Symbolsprache formulieren, die dem Formalismus der Mathematik zumindest ähnlich war. Man konnte vorschreiben, welcher Art eine Angabe sein sollte: Zahl oder Wahrheitswert, Fest- oder Gleitkommazahl mit Anzahl der Binärstellen. Durch spezielle Symbole konnte man Teile des Rechenplans kennzeichnen, die mehrfach oder nur unter gewissen Bedingungen zu durchlaufen waren. Rechenpläne konnten auf andere Rechenpläne verweisen; das Verfahren ist heute als Unterprogrammtechnik bekannt.
Man konnte also die (gedachte) Maschine durchaus anweisen, den Instruktionszähler neu zu setzen, das heißt von einer schlichten Ausführung von Befehlen der Reihe nach abzuweichen – allerdings nur indirekt, in Gestalt von Wiederholungs- oder bedingten Anweisungen. In diesem Punkt ist der Plankalkül überraschend modern; denn in der gegenwärtigen Software-Technologie neigt man dazu, die direkte Sprunganweisung zu verbieten, weil sie die Struktur eines Programms sehr verdunkeln kann.
In der Praxis ist der Plankalkül nie erprobt worden. Der Erfinder formulierte sein Programmiersystem in einem Manuskript, aus dem er nur gelegentlich referierte. Als er es 1972 erstmals vollständig publizierte, hatte dies bereits den Charakter einer historischen Würdigung. Dabei hätte das Konzept zweifellos eine Chance gehabt, etwa in die Bemühungen um die Formulierung der algorithmischen Programmiersprache ALGOL unter Friedrich L. Bauer einzugehen.
Gegenüber derartigen Sprachen fehlten dem Plankalkül zwei Eigenschaften: Der Programmierer konnte den Größen, die im Rechenplan zu manipulieren waren, keine selbstgewählten Namen geben, sondern mußte sich an Symbole halten, die zugleich Adressen von Speicherplätzen bezeichneten. Zum anderen war der Plankalkül in der Ebene notiert: Unter der in einer Hauptzeile notierten Vorschrift standen bis zu drei weitere Zeilen mit näheren Angaben. Durch spezielle Hinweisstriche wurde erklärt, wie Indizes zu verwenden waren. Große Klammern kennzeichneten die Reichweite einer Wiederholung oder Bedingung.
Dagegen bestehen moderne Computerprogramme aus einer schlichten Zeichenfolge – weniger übersichtlich, aber besser geeignet zur maschinellen Verarbeitung. Einen Rechenplan im Plankalkül hätte man in jedem Einzelfall mühsam mit Papier und Bleistift kompilieren, das heißt in Elementaranweisungen auflösen müssen. Mit den heutigen graphischen Benutzeroberflächen wäre die Notation in der Ebene kein Hindernis mehr.
Sich selbst reproduzierende Systeme
Zwei weitere Ideen beschäftigten Konrad Zuse intensiv in seiner langen Zeit als Privatier: Computer, die Computer bauen, oder allgemeiner sich selbst reproduzierende Systeme, sowie die Digitalisierung der gesamten Physik: der Kosmos als Computer, in Zuses Worten der rechnende Raum.
Als geistiger Vater der sich selbst reproduzierenden Systeme gilt allgemein John von Neumann. Seit 1948 beschäftigte er sich damit, ein mathematisches Modell solcher Strukturen zu formulieren. Sein polnisch-amerikanischer Fachkollege Stanislaw Ulam (1909 bis 1984) entwickelte das Denkmodell des zellulären Automaten, in dem eine Vielzahl von Komponenten miteinander in Wechselwirkung treten können. Jede einzelne Komponente ist ein sehr einfacher Automat, der nur wenige Zustände annehmen kann. Er ist nach einem regelmäßigen Muster mit wenigen anderen in seiner Umgebung verbunden. Im Gleichtakt ändern alle diese kleinen Automaten ihren Zustand in Abhängigkeit von dem eigenen und dem ihrer Nachbarn. Aus einfachen Vorschriften für diese Wechselwirkung erwächst eine erstaunliche Komplexität. Üblicherweise symbolisiert man einen Automaten durch ein Feld eines schachbrettartigen Gitters (oder auch eines aus Drei- oder Sechsecken) und seine Zustände durch Farben (Spektrum der Wissenschaft, Juni 1984, Seite 6, November 1986, Seite 6, Oktober 1989, Seite 10, und März 1990, Seite 10).
John von Neumann konzipierte sein Urmodell mit einem zweidimensionalen quadratischen Gitter, in dem jede Zelle genau 29 Zustände einnehmen kann. Er fand tatsächlich eine Ausgangskonfiguration, die sich selbst reproduzierte. Später präsentierte John H. Conway von der Universität Cambridge einen erheblich einfacheren zellulären Automaten mit derselben Eigenschaft, den er "the game of life" nannte (vergleiche Spektrum der Wissenschaft, Mai 1987, Seite 6).
Zuse sah in von Neumanns Modell lediglich eine mathematisch-theoretische Lösung des Problems der Selbstreplikation, keinen Beitrag zur realen Konstruktion von Computern, die Computer bauen. Um so mehr begann er sich für die Automatisierung von Konstruktions- und Fertigungsverfahren zu interessieren, insbesondere für die Steuerung von Werkzeugmaschinen und die Konstruktion von Bauteilen für Rechenmaschinen durch Rechenmaschinen. Erst 1966 aber fand er eine Möglichkeit, solche Systeme experimentell zu realisieren, als er im Auftrag des Bundesforschungsministeriums, betreut von der Fraunhofer-Gesellschaft, zwei Funktionsmodelle einer Montagestraße entwickelte. Damit war erwiesen, daß solche Systeme prinzipiell machbar sind. Die Industrie aber zeigte sich vom praktischen Nutzen noch nicht überzeugt, und Zuse konstatierte mit einiger Verbitterung, daß seine Pläne wiederum ihrer Zeit zu weit vorauseilten.
Die große Idee sich selbst reproduzierender Maschinen ist durchaus lebendig. Sie hat in den letzten Jahren durch die Vision von der Nanotechnologie neuen Auftrieb erhalten.
Zelluläre Automaten haben sich inzwischen von einem schönen Spielzeug der Mathematik zum anerkannten wissenschaftlichen Werkzeug, etwa für Simulationsprozesse in vielen Fachbereichen, gewandelt. Auch in Zuses Denken spielten sie noch eine große Rolle – beim Versuch der Digitalisierung der Physik.
In seiner Autobiographie schrieb er: "Es geschah bei den Betrachtungen über die Kausalität, daß mir plötzlich der Gedanke auftauchte, den Kosmos als eine gigantische Rechenmaschine aufzufassen. Ich dachte dabei an die Relaisrechner: Relaisrechner enthalten Relaisketten. Stößt man ein Relais an, so pflanzt sich dieser Impuls durch die ganze Kette fort. So müßte sich auch ein Lichtquant fortpflanzen, ging es mir durch den Kopf. Der Gedanke setzte sich fest."
Zuse entwickelte diesen Gedanken weiter: der gesamte Kosmos als gigantischer zellulärer Automat, als höchstmassiver paralleler Computer, "rechnender Raum". Dessen miteinander wechselwirkende Kleinstcomputer vermögen jeder allein nur wenig. Aber sie beeinflussen einander, tauschen Daten aus, sind zusammen ein System von unbegrenzter Leistungsfähigkeit, da ihre Zahl unbegrenzt ist und sie alle zugleich arbeiten.
In der Folge gingen seine Ideen in zwei Richtungen: eine angewandte und eine sehr spekulative. Aus der ersten ging die Konzeption einer Maschine hervor, die man heute ohne weiteres als Parallelrechner bezeichnen würde.
Feldrechner
Der Von-Neumann-Computer, Standardmodell des Universalrechners, hat eine einzige steuernde Instanz. Diese verarbeitet einen Befehl nach dem anderen und beginnt mit einem neuen erst, wenn der alte vollständig erledigt ist. Zur Erhöhung der Rechenleistung sind in jüngerer Zeit zwei Konzepte entwickelt worden: Vektor- und Parallelrechner.
Die ersteren führen Befehle überlappend aus, bereiten also die neue Aktion schon vor, wenn die alte noch nicht abgeschlossen ist. Dieses sogenannte pipelining hatte Zuse bei einem Rechenlocher praktiziert, den Remington Rand in Auftrag gegeben hatte. Dieses Gerät las Daten von einer Lochkarte, verarbeitete sie und stanzte das Ergebnis wieder in dieselbe Lochkarte. Da er seine Idee nicht weiterverfolgte und nichts darüber veröffentlichte, mußte das pipelining für die Vektorrechner in den siebziger Jahren neu erfunden werden.
Ein Parallelrechner besteht dagegen aus mehreren Prozessoren, die entweder synchron auf Anweisung einer zentralen Steuerstelle die gleichen Operationen an verschiedenen Daten vollführen oder deren jeder selbständig eine Befehlsfolge abarbeitet. Für den ersten Typ ist das Kürzel SIMD (single instruction, multiple data), für den zweiten MIMD (multiple instructions, multiple data) gebräuchlich; die klassischen Von-Neumann-Maschinen werden als SISD (single instruction, single data) bezeichnet.
Im Idealfall hat ein Parallelrechner mit n Prozessoren die n-fache Leistung eines Einzelrechners – allerdings auch mit dem n-fachen Aufwand. Zuse wurde zum Entwurf seiner Feldrechenmaschine (eines SIMD-Parallelrechners), den er 1958 veröffentlichte, durch die frühen Versuche motiviert, das Wetter mit Hilfe von Computern vorherzusagen. In der Regel traf damals die – nicht einmal besonders genaue – Vorhersage später ein als das betreffende Wetter selbst, so daß der Bedarf nach Beschleunigung der Rechnung offensichtlich war.
Wettervorhersage läuft auf das Lösen partieller Differentialgleichungen hinaus und dieses wiederum auf das Rechnen mit Matrizen (Spektrum der Wissenschaft, April 1990, Seite 78, und März 1991, Seite 82). Eine Matrix (ein "Feld" in Zuses Worten) ist ein rechteckiges Schema aus Zahlen. Man stellt sich die Zeilen und Spalten einer Matrix numeriert vor; zu jeder Kombination von Zeilen- und Spaltennummer gehört genau ein Eintrag. Typische Rechenoperationen sind das Multiplizieren einer ganzen Zeile (das heißt eines jeden ihrer Elemente) mit derselben Zahl und das Addieren zweier Zeilen: Zu jedem Element der einen Zeile wird das darüber beziehungsweise darunter stehende Element der anderen addiert. Es ist also jeweils dieselbe Operation an allen Elementen einer Zeile zu vollführen.
Zuse sah für seine Feldrechenmaschine eine Magnettrommel als Speicher vor (Bild 11). Alle Elemente einer Spalte sollten auf einer Spur, nebeneinander liegende Spalten auf nebeneinander liegenden Spuren gespeichert werden. Für jede Spur war ein eigener Lese- und Schreibkopf vorgesehen, so daß jeweils eine ganze Zeile der Matrix auf einmal gelesen werden konnte. Da die Trommel möglicherweise Platz für mehrere Felder nebeneinander bot, sollte ein Auswahlwerk nur die Daten, die zur aktuellen Matrixzeile gehörten, an eine Verarbeitungseinheit liefern. Diese bestand aus so vielen Addierwerken, wie die Matrix höchstens Spalten haben durfte. Jedes Addierwerk hatte eine eigene Serie von Registern für die Summe, einen sogenannten Akkumulator, zu dessen Inhalt das soeben eingelesene Matrixelement hinzuaddiert wurde. Auf dem Wege zum Addierwerk sollte jedes Element noch um eine Spalte nach links oder rechts oder eine Zeile nach unten oder oben verschiebbar sein. Des weiteren hatte Zuse Schaltungen vorgesehen, die eine Zahl auf dem Wege zum Addierwerk durch Verschiebungen um eine Binärstelle verdoppeln oder halbieren konnten. Der Akkumulator-Inhalt sollte sich auch auf der Trommel ablegen lassen.
Schließlich hatte Zuse noch ein Bedingungswerk vorgesehen: Je nach dem Wert eines weiteren Bits sollte die Aktion eines Addierwerks stattfinden oder auch nicht. Der Fall, den er unmittelbar vor Augen hatte, war die Multiplikation ganzer Zeilen. Da aus Kostengründen nur Addierwerke vorgesehen waren, sollte die Multiplikation, wie beim gewöhnlichen schriftlichen Multiplizieren üblich, in mehrere Additionen des geeignet verschobenen Multiplikanden aufgelöst werden – aber nur dann, wenn der Multiplikator an der entsprechenden Stelle eine Eins hatte (Kasten auf dieser Seite). Diese Bedingung sollte dem Addierwerk durch eine separate Schaltung, eben das Bedingungswerk, übermittelt werden. Für die Multiplikatoren war deshalb ein eigener Platz auf der Trommel (Mr in Bild 11) vorgesehen.
Auch der Feldrechner, dessen Konzeption heute einhellig als Geniestreich gilt, ist nie gebaut worden. Die Realisierung paralleler Systeme mit der Transistortechnik des Jahres 1958 wäre zu aufwendig gewesen.
Der rechnende Raum: Auflösung der Welt in Ja-Nein-Werte
Beim Lösen komplexer physikalischer Probleme mittels Computer, wie etwa bei der Wettervorhersage, pflegt man gedanklich den kontinuierlichen Raum durch ein Gitter ausgewählter Punkte zu ersetzen. An die Stelle der physikalischen Gesetze, die als Differentialgleichungen die Beziehungen eines Raumpunktes zu seinen unendlich dicht benachbarten Punkten beschreiben, setzt man Näherungen, Beziehungen zwischen benachbarten Gitterpunkten.
Im Jahre 1969 legte Zuse eine Denkschrift vor, in der er dieses Verhältnis zwischen kontinuierlicher Realität und diskreter Annäherung auf den Kopf stellte: Was wäre, wenn die Welt in Wirklichkeit diskret wäre und die kontinuierlichen physikalischen Gesetze nur eine Näherung an diese Wirklichkeit?
Nach dieser Auffassung ist das gesamte Universum ein gigantischer zellulärer Automat, ein räumlich unbegrenzter, massiv paralleler Computer. Der Raum ist gekörnt: Weit unterhalb der Größenordnung der bekannten Elementarteilchen, ja weit unterhalb jeder Meßbarkeitsgrenze gibt es elementare Automaten. Sie gehorchen deterministischen Gesetzen lokaler Art: Jeder wirkt nur auf seine unmittelbaren Nachbarn. Wie bei zellulären Automaten üblich, können dennoch weitreichende Wirkungen auftreten (Kasten auf dieser Seite). Makroskopische Gesetze wie der Impulserhaltungssatz lassen sich aus den lokalen Gesetzen der Automaten herleiten.
Aus diesem Modell gehen zwanglos die verborgenen Parameter hervor, mit denen viele Physiker das Auftreten des Zufalls in der Quantenmechanik wegdiskutieren wollten: Die Unbestimmtheit, derentwegen Atomkerne zu im einzelnen unvorhersagbaren Zeitpunkten radioaktiv zerfallen und der Ausgang zahlreicher Experimente nur vom Zufall bestimmt zu sein scheint, sei nicht durch prinzipielle Eigenschaften der Natur, sondern nur durch unser Unwissen verursacht. Beispielsweise folge der Atomkern beim Zerfallen sehr wohl einem deterministischen Gesetz; nur stecke in ihm noch ein verborgener Parameter, der den genauen Zeitpunkt bestimme.
Außerdem läßt sich in Zuses Modell des rechnenden Raums eine nicht statistisch zu begründende, sondern prinzipielle Irreversibilität einführen. Gleichwohl stieß es bei den Physikern aus mehreren Gründen auf nahezu einhellige Ablehnung.
Zum einen verletzt das Modell die Grundannahme von der Isotropie des Raumes. Danach gibt es keine Vorzugsrichtung in der Welt; alle physikalischen Gesetze bleiben dieselben, einerlei wie man sein Koordinatensystem dreht. Wenn man jedoch Zuses Elementarautomaten in einem rechtwinkligen, dreidimensionalen Gitter anordnet, sind die Hauptrichtungen des Gitters ausgezeichnet, und es bedarf beträchtlichen Scharfsinns, die dynamischen Gesetze, die ja nur Gitterpunkte entlang den Hauptrichtungen miteinander in Beziehung setzen, so zu formulieren, daß das Ergebnis makroskopisch isotrop aussieht. Wählt man anstelle regelmäßig angeordneter Elementarautomaten zufällig verteilte, gewinnt man zwar die Isotropie zurück, opfert aber das Interessanteste: die Einfachheit des Modells.
Zum anderen ist nach der Relativitätstheorie Albert Einsteins ein gleichförmig bewegtes Koordinatensystem so gut wie ein (bezüglich des Beobachters) ruhendes; es ist sogar sinnlos, von einem absolut ruhenden Koordinatensystem zu reden. Das ist mit der Vorstellung von den absolut ruhenden Elementarautomaten kaum vereinbar.
Der wichtigste Einwand folgt jedoch aus dem Prinzip der Denkökonomie: Wozu eine komplizierte Theorie nehmen, wenn eine einfachere dasselbe leistet? Zuse hat seine Vorstellungen vom rechnenden Raum nie so weit ausgearbeitet, daß er zu Voraussagen gekommen wäre, die von der klassischen Physik abweichen (und vielleicht einen Aspekt der Natur besser erklärt hätten als diese). Damit entzieht sich die Idee der experimentellen Überprüfung. Sie ist nicht Theorie, sondern bleibt Spekulation.
Damit befindet sich Zuse zwar in Gesellschaft erstrangiger Physiker wie Werner Heisenberg (1901 bis 1976) und Carl Friedrich von Weizsäcker, die auch über auf das Einfachste reduzierte Elemente der Welt nachdachten. Aber bislang ist nicht abzusehen, daß die Physik derlei Gedanken fruchtbar aufgreifen könnte.
Zum Schluß
Schon als Schüler hatte Zuse außergewöhnliche zeichnerische Begabung gezeigt. Besonders Plakatentwürfe aus dieser frühen Zeit bestechen durch nahezu professionelle Qualität.
Erst in den sechziger Jahren begann er ernsthaft mit der Malerei. Aquarelle und Ölgemälde besonders mit Landschafts- und Architekturmotiven belegen sein Talent. Viele Ausstellungen wurden gut besucht, und die Bilder erzielten hohe Preise.
In seiner Werkstatt entwickelte er ein kompliziertes Modell eines aus- und einziehbaren Turmbauwerks. Vom Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft, ein solches Monument – 70 Meter hoch – auf dem Ernst-Reuter-Platz in Berlin zu erbauen, war er höchst angetan: Da sah er eine Verbindung zwischen Kunst und Technik und in der wandelbaren Form ein Symbol des Prinzips der sich selbst reproduzierenden Systeme. Bei Gesprächen über dieses Projekt konnte er noch als alter Mann bubenhafte Begeisterung entwickeln.
Buchstäblich bis in die letzten Tage seines langen Forscherlebens beschäftigte ihn aber sein Weltmodell vom rechnenden Raum. Um bei Physikern und Informatikern neues Interesse dafür zu wecken, wollte er noch ein internationales Symposium "Das digitale Universum – der Kosmos als Computer" ausrichten.
Seine Feldrechenmaschine und seine Vision der Digitalisierung der gesamten Physik waren für ihn zwei Seiten einer Medaille: In künftigen universell programmierten, höchstmassiv parallelen Computern sah er nicht nur wissenschaftliche Werkzeuge, sondern Modelle der realen Welt, die eigenständiger Gegenstand der Forschung werden und zur Formulierung von Fragen an die Natur selbst beitragen.
Noch als Achtzigjähriger baute er seinen ersten Computer, die Z1, aus dem Gedächtnis nach (Bild 1; siehe auch Spektrum der Wissenschaft, Juni 1990, Seite 32).
Seine Aktivität und sein Selbstbewußtsein waren bis zum Schluß ungebrochen. Als er Anfang Dezember 1995 nach einer Herzattacke darniederlag, schaute er himmelwärts, drohte dem lieben Gott mit dem Finger und murmelte: "Mach kein' Blödsinn!"
Aber das Stoßgebet des zeitlebens kreativen Mannes, der noch viel vorhatte, wurde nicht erhört. Am 18. Dezember 1995 ist Konrad Zuse seinem Herzleiden erlegen.
Literaturhinweise
- Der Computer – Mein Lebenswerk. Von Konrad Zuse. 3. Auflage, Springer, Berlin 1993. Rechnender Raum. Von Konrad Zuse. Vieweg, Braunschweig 1969.
– Ansätze einer Theorie des Netzautomaten. Von Konrad Zuse in: Nova acta Leopoldina, Band 43, Nummer 220, 1975.
– Der Plankalkül. Von Konrad Zuse. GMD, Bonn 1972.
– Die Feldrechenmaschine. Von Konrad Zuse in: MTW-Mitteilungen, Nr. V/4, 1958. Erhältlich bei der Konrad-Zuse-Gesellschaft, Konrad-Adenauer-Platz 1, 36088 Hünfeld.
– Über sich selbst reproduzierende Systeme. Von Konrad Zuse in: Elektronische Rechenanlagen, Heft 2. Oldenbourg, München 1967.
– Modelle der Parallelverarbeitung. Von Roland Vollmar und Thomas Worsch. Teubner, Stuttgart 1995.
– Das geistige Umfeld der Informationstechnik. Von Heinz Zemanek. Springer, Berlin 1992.
Kasten: Das ganz kleine Einmaleins
1101001×10011 1101001 1101001 1101001×10011 11111001011
Multiplizieren im Binärsystem geht im Prinzip genauso wie das (dezimale) schriftliche Malnehmen, das man in der Grundschule lernt: Man multipliziert den linken Faktor einzeln mit jeder Stelle des rechten Faktors und addiert die Produkte, jeweils um die richtige Anzahl an Stellen verschoben, auf. Im Binärsystem ist der erste Teil dieser Aktion extrem einfach: Die Ziffer des zweiten Faktors, mit welcher der erste multipliziert werden soll, kann ohnehin nur 0 oder 1 sein ; also genügt es, den linken Faktor, geeignet verschoben, zum Ergebnis zu addieren, wenn der rechte an dieser Stelle eine Eins hat, und im anderen Falle gar nichts zu tun. In Dezimalschreibweise würde obige Rechenaufgabe lauten: 105×19=1995.
Kasten: Ein eindimensionaler rechnender Raum
Als ein erstes Demonstrationsbeispiel eines rechnenden Raumes ersann Zuse einen zellulären Automaten, dessen Elemente zwei verschiedenen Klassen namens p und v angehören und abwechselnd in einer Reihe angeordnet sind. Jeder der kleinen Automaten hat Verbindung nur zu seinen beiden unmittelbaren Nachbarn, also jedes p zu den benachbarten v und umgekehrt. Die Namen stammen aus der Physik; Zuse begann seine Überlegungen mit einem diskreten Modell für Druck (p) und Geschwindigkeit (v) eines Gases.
Auch das dynamische Gesetz dieses zellulären Automaten war der Mechanik der Gase entlehnt. Die zeitliche Differenz der p soll gleich der räumlichen Differenz der v sein, anders ausgedrückt: p morgen gleich p heute plus v links minus v rechts, und umgekehrt. Das Verhalten des Systems ist allerdings losgelöst von dem eines Gases. Setzt man für den Anfangszustand des Automaten ein Paar aus benachbarten p und v auf den Wert 1 und alle anderen auf den Wert 0, so pflanzt sich dieser Zustand nach rechts fort; andere Anfangszustände wandern nach links.
In diesem Bild sind außer den Werten für p und v zu jedem Zeitpunkt (auf der Spitze stehende Dreiecke) auch – in blasseren Farben – die räumlichen Differenzen –Ðp und –Ðv zwischen linkem und rechtem Nachbarwert angegeben (liegende Dreiecke). Diese Zwischenergebnisse nutzte Zuse, um die Dynamik des zellulären Automaten bequemer von Hand durchrechnen zu können. Positive Werte sind blau, negative rot dargestellt.
Derartige Zustände, die sich auf dem Gitter fortbewegen, ohne ihre Gestalt zu verändern, nannte Zuse Digitalteilchen. Wenn zwei von ihnen einander begegnen, durchdringen sie sich wie Wellen, ohne einander zu beeinflussen, denn das dynamische Gesetz ist linear und gehorcht deshalb dem Superpositionsprinzip. Im Bild oben sind links und in der Mitte zwei derartige Begegnungen abgebildet. Sie unterscheiden sich nur durch ihre Phasenlage: Links liegt stets eine gerade Zahl leerer Zellen zwischen den beiden aktiven v-Zellen, in der Mitte eine ungerade. Das hat zur Folge, daß im ersten Fall vorübergehend die Zustände +2 und –2 auftreten, im zweiten nicht.
Will man Wechselwirkungen einführen, muß man das Gesetz nichtlinear machen. Zuse wählte als einfachsten Weg dafür, alle Werte oberhalb von 1 auf 1 zurechtzustutzen, entsprechend für Werte unterhalb von –1. In diesem Falle erleiden die Digitalteilchen bei der Begegnung entweder eine geringe Verzögerung (rechts im oberen Bild), oder sie laufen abermals ungehindert übereinander hinweg (weil die Zurechtstutzungsvorschrift nicht zur Anwendung kommt; Mitte). Welcher Fall eintritt, hängt von der Phasenlage beider Teilchen ab.
Der Unterschied liegt in der Größenordnung eines Gitterabstands und damit nach Zuses Vorstellungen unterhalb jeder Meßbarkeit. Das makroskopisch nicht-deterministische Verhalten quantenmechanischer Systeme fände so eine deterministische Erklärung.
Zudem geht durch das Zurechtstutzen die Reversibilität des Systems verloren: Ein und derselbe Zustand kann verschiedene Vorgängerzustände haben. Die makroskopische Irreversibilität, die man zum Beispiel in der Thermodynamik beobachtet, wäre also nicht wie in der klassischen Physik nachträglich mit statistischen Argumenten zu erklären, sondern unmittelbare Folge des dynamischen Gesetzes.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 1 / 1997, Seite 78
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH



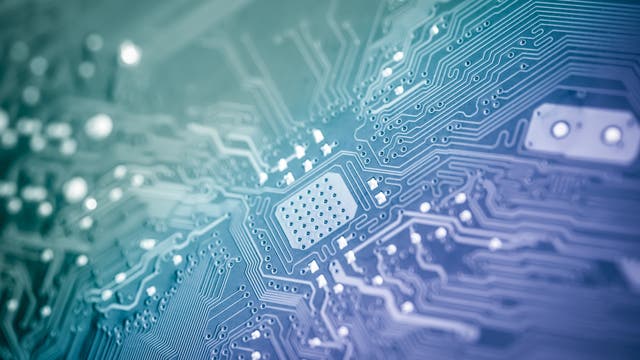


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben