Krebsmedikamente: Die neuen Medikamente gegen Krebs
Bei einer Routineuntersuchung entdeckte der Betriebsarzt bei Gerhard Kraus eine verdächtige Zunahme der weißen Blutkörperchen – er tippte auf einen grippalen Infekt und schickte den Berufsfeuerwehrmann zum Hausarzt. Innerhalb kurzer Zeit kletterten die Werte von 12000 über 40000 bis zu bedrohlichen 70000 Zellen pro Mikroliter Blut. "Das ist kein grippaler Infekt", sagte der Hausarzt. "Das ist Leukämie."
"Ein Schlag ins Genick", erinnert sich der sympathische Mannheimer, sei diese Nachricht für ihn und seine Familie gewesen. Doch wie ernst es tatsächlich um ihn stand, wurde ihm erst klar, als ihm eine Klinikärztin nach der Untersuchung empfahl, die verbleibende Zeit zu nutzen, um "alles zu regeln". Das war 1993. Gerhard Kraus war damals 53 Jahre alt und hörte zum ersten Mal in seinem Leben von einer Krankheit namens "chronische myeloische Leukämie".
Heute, im Herbst 2001, bereiten sich Gerhard Kraus und seine Frau auf eine mehrwöchige Amerikareise zu Tochter und Enkelkindern vor. Dass ihm das möglich ist, führt der Patient in erster Linie auf sechs längliche orange Kapseln mit einem unscheinbaren Pulver zurück, die er seit dem 5. August 1999 täglich einnimmt: "Meine Werte", sagt Kraus freudig, "sind seither konstant, und es geht mir ausgesprochen gut."
Das war nicht immer so. Zu Beginn seiner Erkrankung wurde er mit dem Wirkstoff Interferon-alpha behandelt: "Fünf Jahre lang täglich eine Spritze mit 3,5 Millionen Einheiten." Schlapp und "grippig" habe er sich die ganze Zeit über gefühlt, hinzu kam ein böser Spritzenabszess und im Herbst 1998 die Botschaft, dass das Standardtherapeutikum bei ihm nicht mehr wirkte.
Maßgeschneiderte Medikamente
Es folgte eine aggressive Chemotherapie. Alle Haare fielen ihm aus, ständige Übelkeit und große körperliche Schwäche quälten ihn. "Aber die Tortur hat etwas gebracht", sagt er. Weihnachten 1998 war er wieder zu Hause. In sechs Monaten, hieß es, würde die nächste Chemotherapie notwendig werden.
Sie sollte ihm erspart bleiben. Es gäbe da "etwas Neues aus Amerika", hörte er in der Klinik. Am 4. August 1999 erreichte ihn der Anruf seines behandelnden Arztes. Gleich am nächsten Morgen solle er ins Krankenhaus kommen, das neue Medikament sei mit einem Boten von der Pharmafirma Novartis in Nürnberg zur III. Medizinischen Klinik nach Mannheim unterwegs.
Gerhard Kraus war einer der ersten Patienten in Deutschland, die im Rahmen eines "Expanded-Access"-Programms in eine klinische Studie zur Prüfung des neuen Krebsmedikamentes "STI571" ("Imatinib", Handelsname "Glivec") aufgenommen wurden. Wie STI wirkt, weiß der Patient nicht. Gerhard Kraus hat nie danach gefragt, und es interessiert ihn auch nicht: "Es hält die bösen Zellen nieder", sagt er: "Das ist das Einzige, was für mich zählt." Er wisse sehr wohl, dass er an einer unheilbaren Krankheit leide. Aber sie sei jetzt schon seit zwei Jahren "im grünen Bereich" – und da solle sie "gefälligst auch bleiben".
STI, oder Glivec, ist eine Hoffnung – nicht nur für die Patienten und ihre Lebensqualität, sondern mehr noch hinsichtlich der revolutionären Strategie, die das neue Medikament repräsentiert. "Die bisherigen Erfahrungen mit STI571", kommentiert Privatdozent Dr. Andreas Hochhaus vom Kompetenznetz Leukämie in Mannheim, "belegen das große Potenzial einer molekular ausgerichteten Therapie onkologischer Erkrankungen." STI ist eines der ersten Medikamente, das auf molekularer Ebene maßgeschneidert wurde, und der Vertreter einer völlig neuen Klasse von Krebsmedikamenten, den "Signaltransduktionshemmern" (STI steht für Signal-Transduktions-Inhibitor). Im Unterschied zu den herkömmlichen Krebsmedikamenten, den das Zellwachstum hemmenden so genannten Cytostatika, die zwischen gesunden und entarteten Zellen nur bedingt unterscheiden können (siehe Interview auf Seite 52/53) und deshalb häufig mit schweren Nebenwirkungen einhergehen, versuchen die neuen Wirkstoffe präzise an molekularen Informationswegen anzusetzen, die für Tumorzellen typisch sind.
Die Forscher wissen heute, dass die scheinbar uneinheitliche Erkrankung Krebs eine Krankheit der Zellen, Gene und Moleküle ist. Die Mediziner kennen etwa zweihundert Tumorarten. Bei aller Vielfalt an äußeren Erscheinungsbildern geht die Krankheit doch meist auf jeweils eine einzige Zelle zurück, in deren Erbsubstanz sich genetische Veränderungen – Mutationen – angehäuft haben. Daraufhin entstehen Genprodukte, Proteine, die das geregelte Zellleben außer Takt geraten lassen. Schritt für Schritt wandelt sich eine normale Zelle in eine bösartige um, die sich den wachstumsregulierenden Signalen des Körpers entzieht und sich auf Kosten gesunder Zellen vermehrt.
Die neuen Ansatzpunkte für die Therapie von Krebserkrankungen ergeben sich aus diesen grundlegenden molekularen Einsichten. Die Wirkungsweise von STI571 bei der chronischen myeloischen (oder chronisch-myeloischen) Leukämie zeigt beispielhaft, wie es gelingen kann, den Krebs erfolgreich an seiner molekularen Wurzel zu packen. Bei dieser Erkrankung vermehren sich weiße Blutzellen unkontrolliert. Die augenscheinliche Ursache für deren maßloses Wachstum bei dieser Art von Leukämie ist ein mit dem Lichtmikroskop erkennbarer genetischer Defekt: Die entarteten weißen Zellen sind an einem veränderten Chromosom zu erkennen: dem Philadelphia-Chromosom. Es entsteht, wenn sich in einer der Stammzellen im Knochenmark, aus denen die weißen Blutzellen hervorgehen, ein Unfall ereignet: Während sich die Zelle teilt, erhält Chromosom 9 fälschlicherweise ein Stück von Chromosom 22 und dieses umgekehrt ein Stück von Chromosom 9. Diese Umlagerung von Erbmaterial – die Genetiker sprechen von einer Translokation – ist charakteristisch für die meisten Fälle von chronischer myeloischer Leukämie. Das Philadelphia-Chromosom ist für die Krankheit so typisch, dass die Ärzte es schon lange als Marker-Chromosom für die Diagnose heranziehen.
Aber warum geraten Zellen, die das verdächtige Philadelphia-Chromosom tragen, aus ihrem Wachstumsgleichgewicht? Dieses Rätsel konnten erst die Molekularbiologen lösen. Sie erkannten, dass wegen der Fusion der Chromosomenstücke zwei Gene zusammentreffen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben: das Gen abl von Chromosom 9 und das Gen bcr von Chromosom 22. Die beiden Gene werden zu unmittelbaren Nachbarn – mit fatalen Folgen: Zusammen bilden sie ein so genanntes Onkogen, ein Krebs erzeugendes Gen: bcr-abl. Das Produkt dieses veränderten Gens ist ein abnormer Eiweißstoff, der die Blutzellen dazu antreibt, sich übermäßig zu vermehren. Gegen dieses Krebs erregende Protein – eine bestimmte Tyrosinkinase, also ein Enzym – richtet sich das neue Krebsmedikament Glivec oder STI571.
Bedrohliche Eigenstimulation
Tyrosinkinasen sind an sich im gesunden Zellleben unverzichtbar. Diese Enzyme sind beispielsweise wichtige Mitglieder eines außerordentlich bedeutsamen biologischen Prozesses, den Wissenschaftler Signaltransduktion nennen, also Signalübermittlung. Es handelt sich dabei um eine Kommunikationskette im Innern der Zelle, die auf eine passende äußere Nachricht hin in Bewegung gerät: Signale, die außen bei der Zelle eintreffen, werden aufgenommen und bis zum Zellkern und zu den Genen weitergereicht (SdW 10/2000, S. 60). Wichtig ist die Signaltransduktion deshalb, weil sie die einzelne Zelle – gewissermaßen ein eigenständig organisiertes Individuum – mit den Bedürfnissen und Anforderungen des gesamten Organismus in Einklang bringt. Professor Bernd Groner vom Georg-Speyer-Haus in Frankfurt erforscht die Signaltransduktion von Zellen intensiv. Er veranschaulicht die komplexe molekulare Nachrichtenübertragung mit einem Beispiel aus dem täglichen Leben: "Es ist ganz so, als würde bei Ihnen zu Hause der Postbote an der Tür klingeln, um eine wichtige Nachricht zu überbringen, auf die Sie unmittelbar reagieren müssen."
In diesem Bild repräsentiert der Postbote ein äußeres Ereignis, etwa ein Protein oder einen anderen Signalstoff, der an die Zelle anklopft. Dies geschieht allerdings nicht an einem beliebigen Ort, sondern an einem besonderen Klingelknopf, einem so genannten Rezeptor. Über den Rezeptor – ein speziell geformtes Protein, das den Außen- und den Innenraum der Zelle miteinander verbindet – gelangt die Nachricht in das Zellinnere und wird dort von einem Familienmitglied – einem eigens dafür vorgesehenen Molekül – in Empfang genommen. Nun wird die Nachricht von einer Reihe anderer Moleküle quer durch das Cytoplasma bis hin zum Zellkern weitergereicht.
Im Inneren des Zellkerns trifft die Nachricht auf den eigentlichen Empfänger – ein Gen, das auf die Botschaft in einer bestimmten Weise antwortet. Dieses Gen kann beispielsweise veranlassen, dass sich die Zelle teilt oder für eine bestimmte Aufgabe im Organismus spezialisiert, sich also differenziert. Das Gen kann die Zelle auch dazu bringen, ein spezielles Stoffwechselprodukt herzustellen, oder es kann sie dazu antreiben, den programmierten Zelltod, die Apoptose, einzuleiten.
Selbstgespräch statt Kommunikation
Die Tyrosinkinasen stehen in der Kette dieser Nachrichtenübertragung ganz oben: Sie zählen zu den ersten und auch wichtigsten intrazellulären Übermittlern von Nachrichten. Verändert sich einer dieser zentralen Übermittler – beispielsweise als Folge eines molekularen Unfalls wie im Fall der chronischen myeloischen Leukämie – und wird er dadurch überaktiv, muss das weit reichende ungünstige Auswirkungen haben: Die normalerweise mit der zellulären Außenwelt harmonisch abgestimmte Kommunikation gerät zum egozentrischen Selbstgespräch. Die Zelle teilt sich jetzt unkontrolliert: Zahllose entartete Zellen entstehen, die auf Grund ihrer genetischen Schäden und ihrer Funktionsunfähigkeit zu einer Gefahr für den gesamten Organismus werden.
Derart gestörte Kommunikationswege im Innern der Zelle sind nicht nur für die chronische myeloische Leukämie bedeutend. "Die Erforschung des Signaltransduktionsweges, seiner Unterschiede in normalen und entarteten Zellen und der Möglichkeiten, zielgerichtet mit tumorzellspezifischen Unterschieden zu interferieren, ist derzeit eines der wichtigsten Gebiete der molekularen Onkologie", bewertet Bernd Groner den Stellenwert des Forschungsschwerpunktes.
Der Wirkstoff von STI571, ein 2-Phenylaminopyrimidin-Derivat, interferiert mit der oben genannten überaktiven Tyrosinkinase, die wegen des Philadelphia-Chromosoms fälschlich gebildet wird. Die durch diesen genetischen Fehler gestörte Kommunikation wird somit an einem der ersten und wichtigsten molekularen Übermittlungsschritte in der Zelle geblockt: Die ohne äußere Absprachen entstandene Wachstumsbotschaft erreicht dank des Medikaments nicht mehr das "Headquarter", also den Zellkern mit den Genen. Die unkontrol-lierte Vermehrung der Zelle bleibt nun aus.
Die ersten klinischen Phase-I-Studien (die Prüfung der Verträglichkeit an gesunden Versuchspersonen) mit dem neuen Krebsmedikament STI571 begannen im Jahr 1998 in den Vereinigten Staaten. Zwischen August 1999 und Juni 2000 wurden in 32 Zentren aus sechs Ländern, darunter die III. Medizinische Universitätsklinik in Mannheim, Patienten für eine Phase-II-Studie rekrutiert. (In dieser Phase der klinischen Prüfung wird ein neues Medikament an den ersten Patienten erprobt.)
Die Ergebnisse der Phase-II-Studie erwiesen sich als so viel versprechend, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde das neue Krebsmedikament bereits im Mai 2001 für die Behandlung von Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie zugelassen hat. Auch in Deutschland soll es voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Eingesetzt wird es derzeit in der ersten Phase der Erkrankung und in der so genannten Übergangsphase, wenn die Standardtherapie mit Interferon-alpha versagt, sowie in der Blastenkrise, dem dritten Stadium.
Neue klinische Studien prüfen zur Zeit, ob Glivec möglicherweise auch geeignet sein könnte, um solide Tumoren zu behandeln. Wie sich herausgestellt hat, beeinflusst das Medikament noch weitere Tyrosinkinasen, zum Beispiel c-kit. Diese Kinase wird verdächtigt, das Wachstum so genannter gastrointestinaler Stromatumoren zu fördern. Es handelt sich dabei um Krebserkrankungen des Bauchraums, für die es bislang keine medikamentöse Therapie gibt.
Euphorie wäre verfrüht
Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Glivec auch bei dieser Tumorerkrankung wirksam sein könnte. "Im Rahmen von Pilotstudien", berichtet Andreas Hochhaus, "sind eindrucksvolle klinische Remissionen beobachtet worden." Auch bei kleinzelligen Lungenkarzinomen (siehe "Lungenkrebs", Spektrum der Wissenschaft 7/2000, S. 54) haben die Wissenschaftler eine übermäßig aktive c-kit gefunden. Eine klinische Pilotstudie dazu läuft derzeit in Deutschland unter Leitung der Mainzer Universitätsklinik. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Auf Grund ihrer biologischen Charakteristik könnten möglicherweise auch Melanome, das Glioblastom (ein Hirntumor) oder das Prostatakarzinom Kandidaten für eine Behandlung mit STI571 sein. Ob diese Krebsarten gleichfalls auf das Medikament ansprechen, wird momentan untersucht.
Trotzdem ist eine allzu große Euphorie über das neue Design-Medikament verfrüht. Denn bei allen Besonderheiten und Hoffnungen – STI ist kein Wundermittel und schon gar kein Allround-Krebsmedikament: Es hilft nur einer ganz bestimmten Patientengruppe. Es verursacht Nebenwirkungen, etwa Übelkeit, Muskelkrämpfe, Ödeme oder Hautausschläge. Und es bereitet ein Problem, das auch von herkömmlichen Krebsmedikamenten leidlich bekannt ist: Die Tumorzellen widerstehen nach einiger Zeit dem Wirkstoff, sie werden resistent.
Dass Leukämiezellen wieder auftreten, obwohl die Behandlung mit STI weitergeführt wird, ist bislang vor allem bei Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium beobachtet worden. Die wiedererlangte Widerstandskraft der entarteten Zellen beruht vornehmlich auf zwei Abwehrstrategien, welche die fortgeschrittene Krebszelle entwickelt. Entweder vervielfältigt sie kurzerhand das bcr-abl-Gen. Die nach dieser "Gen-Amplifikation" entstehenden übergroßen Mengen der abnormen Tyrosinkinase lassen sich in ihrer wachstumsfördernden Wirkung kaum mehr medikamentös unterdrücken. Oder aber das bcr-abl-Gen selbst verändert sich durch eine neuer-liche Mutation. Das Resultat ist ein verändertes Protein, das der maßgeschneiderte Wirkstoff Glivec nicht mehr blockieren kann.
In klinischen Studien wird jetzt untersucht, wie man solchen Resisten-zen und Krankheitsrückfällen begegnen kann. Geprüft wird beispielsweise, ob STI571 mit herkömmlichen Chemotherapeutika kombiniert werden sollte, um Rückfälle zu vermeiden. Ob Patienten, die neu an chronischer myeloischer Leukämie erkrankt sind, von einer sofortigen und alleinigen Therapie mit STI profitieren, versucht derzeit eine internationale Phase-III-Studie zu klären, an der mehr als tausend Patienten teilnehmen. (Bei Phase III einer klinischen Medikamentenprüfung wird eine Substanz nach strengen Regeln mit größeren Patientenzahlen erprobt.) Verglichen wird die STI-Monotherapie mit der bisherigen, bewährten Standardtherapie: der Behandlung mit Interferon-alpha, einem Botenstoff des Immunsystems. Ergebnisse liegen noch nicht vor.
Wie alle herkömmlichen Krebsmedikamente ist STI ein lebensverlängerndes Mittel. Heilen kann es zumindest die Patienten in der Spätphase der Erkrankung nicht. In der frühen Phase der chronischen myeloischen Leukämie könnte möglicherweise eine Heilung, vielleicht in Kombination mit Inferferon-alpha, erzielt werden. Ob sich diese Hoffnung realisieren wird, ist noch völlig unklar. Ebenso ist unbekannt, welche Neben-wirkungen das Medikament auf lange Sicht haben könnte. Es werden noch Jahre vergehen, bis diese wichtigen Fragen geklärt sind. "Zur Zeit", so betont Andreas Hochhaus vom Mannheimer Universitätsklinikum, wo seit August 1999 über 300 Patienten mit STI behandelt wurden, "müssen wir mit der Aussage, dass Patienten, die STI einnehmen, grundsätzlich eine deutlich bessere Prognose haben oder gar geheilt werden könnten, noch ausgesprochen vorsichtig sein."
Glivec ist der am weitesten fortgeschrittene Vertreter von über 16 Tyrosinkinase-Hemmern, die derzeit entwickelt und in ersten klinischen Studien erprobt werden. Vor allem zwei weitere dieser Enzymhemmer machen im Moment von sich reden: "Iressa" von der Pharmafirma AstraZeneca und "Tarceva" von Hoffmann-La Roche.
Design-Medikamente
Bei Iressa handelt es sich um einen Wirkstoff gegen das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom. Die Substanz blockiert eine Tyrosinkinase, die von einem bestimmten Rezeptor abhängig ist, nämlich der Antenne der Zellen für den Wachstumsfaktor EGF (epidermal growth factor). Solche EGF-Rezeptoren haben die Molekularbiologen verstärkt auf der Oberfläche vieler Tumorzellen entdeckt. In ersten klinischen Studien sprachen Patienten, die an einem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs leiden, gut auf Iressa an. Auch die Kombination mit herkömmlichen Krebsmedikamenten erwies sich als wirksam. Derzeit läuft eine Phase-III-Studie mit Lungenkrebs-Patienten, gegen deren Leiden weder Chirurgie noch Strahlentherapie etwas ausrichten konnten. Frühe klinische Studien erproben, ob sich Iressa möglicherweise auch eignen könnte, um Prostata-, Nierenzell- und Blasenkrebs sowie bestimmte Hirntumoren, so genannte Glioblastome, zu behandeln.
Wie auf dem Jahreskongress der Amerikanischen Gesellschaft für Klinische Onkologie in San Francisco im Frühsommer 2001 berichtet, wird Tar-ceva, ein zweiter, von der amerikanischen Biotechfirma Genentech mitentwickelter EGF-Rezeptor-Hemmer, zurzeit zur Behandlung des fortgeschrittenen Brustkrebses erprobt. Die EGF-Rezeptor-Hemmer erwiesen sich bislang als vergleichsweise nebenwirkungsarm.
Gegen einen anderen wichtigen Teilnehmer des zellulären Nachrichtenübermittlungssystems richten sich weitere Neuentwicklungen mit dem nahezu unaussprechlichen Namen "Farnesyltransferase-Hemmer" oder kurz "ras-Hemmer". Sie werden gerade in klinischen Phase-II-Studien unter anderem zur Therapie der akuten Leukämie und des fortgeschrittenen Brustkrebses getestet. Experten zählen die ras-Hemmer zum Spannendsten, was die onkologische Forschung heute zu bieten hat. Ihr kryptischer Name bezieht sich auf "ras", ein verändertes Protein im Innern der Zelle, das gebildet wird, weil ein verändertes Gen, das "ras-Onkogen", dies veranlasst. Dieses Onkogen ist in den Zellen sehr vieler Krebsarten des Menschen aktiv. Sein Produkt, das ras-Protein, übermittelt Wachstumssignale von der äußeren Zellmembran ins Innere der Krebszelle. Es wird als Signalmolekül aber erst dann aktiv, wenn ihm von einem bestimmten Enzym, eben der Farnesyltransferase, ein kleines Molekül übertragen wird: eine Farnesylgruppe.
Wenn es gelingt, diesen frühen Aktivierungsschritt in der Kette der Signalübertragung zu unterbinden, könnte die Zelle molekülgenau daran gehindert werden, sich unkontrolliert zu teilen. Farnesyltransferase-Hemmer haben in Versuchen mit Tieren Tumoren vollständig rückgebildet. Ob sie Gleiches auch beim Menschen bewirken können, müssen die neuen Wirkstoffe erst noch beweisen.
Mediziner erforschen auch, ob sie zur zielgenauen Krebsbekämpfung bestimmte Mechanismen der Immunabwehr nutzen können. Hierzu bieten sich Antikörper an, die in einer großen Vielfalt erscheinen. Diese erkennen auf Zellen sehr spezifische Strukturen, das heißt, sie docken an bestimmte Oberflächenmerkmale einer Zelle an (und stacheln dann im natürlichen Fall das Immunsystem an, diese Zelle zu vernichten). Und da sich Krebszellen äußerlich von anderen Zellen unterscheiden, wären Antikörper, die sich genau dagegen richten, eine ideale Waffe, auch etwa, um einen bestimmten Rezeptor für Wachstumssignale zu blockieren. Mit Hilfe zellbiologischer und gentechnischer Methoden können heute beliebige Mengen gleich aussehender (monoklonaler) Antikörper hergestellt werden. Die Angriffsstellen für solche künstlichen Antikörper auf der Oberfläche der Tumorzellen sind verschiedene Rezeptoren – also die Klingelknöpfe der zellulären Signalübertragung.
Prominentestes Beispiel für diese Klasse neuer Krebsmedikamente ist der monoklonale Antikörper "Trastuzumab" von Hoffmann-La Roche. Unter dem Handelsnamen "Herceptin" ist er seit August 2000 in Deutschland zur Therapie des metastasierten Brustkrebses zugelassen.
Herceptin richtet sich gegen den Wachstumsrezeptor HER2 (human epidermal growth factor receptor2). Er kommt auf der Oberfläche von Krebszellen, vor allem aber bei Brustkrebszellen, sehr viel häufiger vor als auf normalen Zellen (Bilder auf Seite 54). Ursache ist ein in der Krebszelle vervielfältigtes (amplifiziertes) Gen, das die Bauanleitung für das im Übermaß gebildete Oberflächenmerkmal bereitstellt. In der gesunden Zelle ist der HER2-Rezeptor die erste Anlaufstelle für ein Signal, das die Zelle dazu stimuliert, sich zu teilen.
Ist die Membran übermäßig mit HER2-Rezeptoren bestückt, wird die Zelle ebenso übermäßig dazu angeregt, sich zu vermehren. "Das ist in etwa so, als würde man in einem Auto einen Backstein auf das Gaspedal legen", vergleicht Professor Dr. Rolf Kreienberg, Direktor der Universitätsfrauenklinik in Ulm und Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, das molekulare Geschehen. Der Antikörper in Herceptin bindet anstelle des Wachstumssignals an den HER2-Rezeptor und verhindert so, dass das Wachstumssignal in das Innere der Zelle weitergeleitet wird – es macht gleichsam das Gaspedal für den Backstein unzugänglich.
Antikörper als Medikament
Aus dieser molekularen Wirkweise ergibt sich, dass Herceptin das überschießende Zellwachstum nur bei denjenigen Brustkrebspatientinnen verlangsamen helfen kann, die den Rezeptor in größerer Menge auf den Zellen tragen. Ob dem so ist, kann mit Hilfe eines zuverlässigen diagnostischen Tests ermittelt werden. "Rund zwanzig bis dreißig Prozent aller Brustkrebspatientinnen sind HER2-positiv", sagt Rolf Kreienberg. "Diese Patientinnen können von Herceptin profitieren – bei HER2-negativen Tumoren macht es keinen Sinn, den monoklonalen Antikörper zu verabreichen."
Große klinische Studien prüfen, ob die Schlagkraft des Antikörpers verbessert werden kann, wenn man ihn mit Chemotherapeutika kombiniert. Auch ob andere Krebsarten ansprechen, bei denen HER2-Rezeptoren im Übermaß zu finden sind – etwa Lungenkrebs –, wird derzeit untersucht. Mit der Chemotherapie verglichen ist Herceptin besser verträglich. Bisweilen kann es jedoch zu schweren Nebenwirkungen kommen, die das Herz betreffen.
Zu den neueren Krebsmedikamenten zählen noch zwei weitere Antikörper, die sich gegen Rezeptoren auf der Oberfläche von Tumorzellen richten: "Rituximab" (Handelsname "Mabthera", von Hofmann-La Roche) ist in Europa seit 1998, "Alemtuzumab" (Handelsname "Mabcampath", Vertrieb durch Schering) seit Juli 2001 zugelassen.
Rituximab richtet sich gegen das "CD20-Antigen". Dieser Oberflächenrezeptor wird von den entarteten Zellen des Non-Hodgkin-Lymphoms, einem häufigen Blutkrebs, übermäßig ausgebildet. Der Antikörper bindet an das CD20-Antigen. Daraufhin wird die bösartige Zelle von den körpereigenen Abwehrmechanismen eliminiert. Gemeinsam mit der Standard-Chemotherapie angewendet, kann der Antikörper die Lebenserwartung von Patienten verbessern, die an einem aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom leiden.
Auch Alemtuzumab, der neueste eingesetzte Antikörper, wird bei einer Blutkrebsart eingesetzt, und zwar bei der chronisch-lymphatischen Leukämie der B-Zellen, einer Fraktion der weißen Blutkörperchen. Der Antikörper bindet an das Protein CD52+ auf der Oberfläche entarteter B-Zellen und initiiert deren Zerstörung durch die körpereigene Immunabwehr. Der Antikörper ist jetzt für Patienten zugelassen, bei denen die Standard-Chemotherapie nicht mehr wirkt.
Neben der Blockade von Wachstumsfaktoren und dem Verhindern molekularer Falschmeldungen gibt es noch zahlreiche weitere Ansatzpunkte, die Krebsforscher weltweit untersuchen, um neue Zielstrukturen (Targets) für wirksame Medikamente zu finden. Von den vielen neuen Ansätzen werden derzeit vor allem zwei als besonders viel versprechend diskutiert: die Hemmung der Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) und das Aushungern von Tumoren mit Angiogenese-Hemmern.
Matrix-Metalloproteinasen zählen zu einer Enzymfamilie mit mehr als zwanzig Mitgliedern. Sie alle sind dazu befähigt, Bestandteile der extrazellulären Matrix abzubauen. Diese hoch entwickelte Matrix füllt die Räume zwischen den Zellen aus und gibt ihnen Halt. Sie besteht vorwiegend aus Glykoproteinen, die von der Zelle abgesondert werden.
Für die Krebsforscher sind Metalloproteinasen interessant, weil entartete Zellen sie verstärkt produzieren und zu einem bösartigen Zweck missbrauchen: Die Enzyme helfen der malignen Zelle, ihren angestammten Platz zu verlassen, in das Blutgefäßsystem vorzudringen und sich in gesunden Organen niederzulassen, um sich dort weiter zu vermehren. Auf ihrer Wanderschaft durch den Körper – bei der Metastasierung – bahnen die Metalloproteinasen den Krebszellen gleichsam unfreiwillig den Weg.
Die Krebsforscher überlegen, wie sie diese Enzyme hemmen können, um so zu verhindern, dass sich gefährliche Tochtergeschwülste absiedeln. Erste entdeckte Hemmstoffe testen sie mittler-weile in klinischen Studien. Einer dieser Matrix-Proteinase-Hemmer (von der Firma Bristol-Myers Squibb) wird bereits in einer Phase II/III-Studie an Patienten geprüft.
In einem ähnlich ambitionierten Projekt soll das Wachstum von Tumoren dadurch gestoppt werden, dass keine neuen Blutgefäße mehr wachsen können, um die Geschwulst mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Hemmstoffe sollen diese so genannte Angiogenese verhindern. Die Geschwulst würde dann schlichtweg ausgehungert. Der entscheidende Vorteil einer Anti-Angiogenese: Sie dürfte bei allen soliden Tumoren, ob Brust-, Darm- oder Lungenkrebs, wirken. Denn alle sind zum Wachstum auf die Zufuhr von Blut angewiesen.
Die Krebsforscher und Arzneimittelentwickler hoffen dabei vor allem auf Substanzen, die ein überaktives Molekül mit dem Kürzel VEGF (vascular endothelial growth factor) hemmen. Es fördert das Aussprossen neuer Blutgefäße. Einige Wissenschaftler versuchen beispielsweise, das Molekül mit monoklonalen Antikörpern abzufangen. Andere arbeiten daran, die Tyrosinkinase des VEGF-Rezeptors mit niedermolekularen Wirkstoffen auszuschalten. Der Gedanke einer Anti-Angiogenese ist bestechend – noch hat allerdings keiner der Entwicklungskandidaten den entscheidenden Sprung in fortgeschrittene klinische Studien geschafft.
"Ob Signaltransduktion, Wachstumsrezeptoren oder Angiogenese – alle diese neuen Konzepte sind unglaublich spannend und von großer methodischer Eleganz", urteilt Professor Rolf Kreienberg. Ob aus ihnen tatsächlich Medikamente werden, die Krebspatienten dauerhaft helfen oder sie gar von ihrem Leiden befreien können, muss bis auf weiteres offen bleiben. "Die Saat ist ausgebracht", meint Kreienberg. "Und ich habe den Eindruck, dass wirklich gut ausgesät wurde."
Rückblick auf hundert Jahre Krebsforschung
Für den deutschen Chemiker Justus von Liebig (1803-1873) war das Bemühen des Wissenschaftlers, eine brauchbare Hypothese über einen Zusammenhang zu formulieren, gleichbedeutend mit der Suche nach einem "Hauptschlüssel, mit dem sich alle Türen öffnen lassen". Dass die Krebserkrankungen trotz ihrer Vielgestaltigkeit auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen seien – diese Hypothese wurde erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert.
Einer der Ersten, die dem Rätsel Krebs auf die Spur kamen, war der Würzburger Zoologe und Zellforscher Theodor Boveri (1862-1915): Er postulierte im Jahr 1902, dass die Krebsentstehung weiter nichts sei als die Folge einer fehlerhaften Verschmelzung der Chromosomen bei der Zellteilung. Dieser biologische Ansatz war damals revolutionär. Zuvor wurde die Geschwulst nicht als dem Körper zugehörend, sondern als eine Art körperfremder, tierischer Parasit betrachtet. Andere glaubten, dass es sich bei Tumoren um Gebilde aus Schleim und Plasma handele, die irgendwie zu großen Massen herangewachsen waren.
Die führenden Anatomen lehnten Boveris biologische Erklärung der Geschwulstentstehung seinerzeit vehement ab – der Zellbiologe jedoch blieb überzeugt davon, dass die Krebsforschung nur durch die Biologie auf Eigenschaften geführt werden könnte, die "aus dem Studium der Tumoren selbst nicht entnommen werden können und doch deren Wesen ausmachen". Boveri sollte Recht behalten.
In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bauten andere Wissenschaftler seine Überlegung zur "Mutationstheorie der Geschwulstentstehung" aus. Einer von ihnen war der deutsche Chirurg und spätere Gründer des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg Karl Heinrich Bauer (1890-1978). Auch er hielt die "Geschwulstbildung ihrem elementarsten Wesen nach für ein Problem der allgemeinen Biologie". Die Formenvielfalt der Krebserkrankungen, schrieb Bauer 1928, müssten "letzten Endes auf plötzlich auftretende Veränderungen im Chromosomenbestand einer Körperzelle" zurückgeführt werden. Die "fruchtbarste und zugleich einfachste Betrachtungsweise des Geschwulstproblems" sei, "dass die Gene der Zelle die Träger der Geschwulsteigenschaften" sind.
Was ein Gen ist und was ein Gen tut, ahnten damals allerdings weder Bauer noch irgendein anderer Forscher seiner Zeit. Nachdem der Krebs auf eine Krankheit sich irgendwie unsachgemäß verhaltender Zellen reduziert worden war, bewegte sich jahrzehntelang nichts mehr in der Krebsforschung. Wie sollten Gene eine Zelle dazu veranlassen, sich normal oder unkontrolliert zu vermehren? Der wissenschaftliche Stillstand sollte sich erst mit dem Einzug der Molekularbiologie ändern – jener Wissenschaft, die sich mit den Lebenserscheinungen im Reich der Moleküle beschäftigt. Seit der Beschreibung der Struktur des Erbmoleküls Desoxyribonukleinsäure (DNS) durch Francis Crick und James Watson im Jahr 1953 und der Erkenntnis, dass Gene bestimmte Abschnitte dieses Moleküls sind, hat auch die Krebsforschung gehörigen Auftrieb erfahren.
In den letzten beiden Jahrzehnten haben die Forscher vor allem zwei Gruppen von Genen ausfindig gemacht, die bei Krebs häufig verändert sind: die Onko-gene und die Tumor-Suppressor-Gene. Deren koordinierte Zusammenarbeit garantiert normalerweise, dass eine Zelle die Grenzen ihres Wachstums akzeptiert. Ist jedoch die Kooperation dieser beiden Genklassen gestört, kann die Zelle aus ihrem abgestimmten Wachstumstakt geraten.
Die Funktionsweise der beiden Gengruppen kann mit der eines Autos verglichen werden. Die Onkogene sind in diesem Bild die Gaspedale, die Tumor-Suppressor-Gene die Bremsen. Wird das Gaspedal zu fest gedrückt (dies entspricht der Mutation eines Onkogens), gerät der Wagen (die Zelle) außer Kontrolle. Gleiches ereignet sich, wenn die Bremsen nicht mehr funktionieren (dies entspricht der Veränderung eines Tumor-Suppressor-Gens).
Die genetischen Defekte innerhalb der Zelle können durch äußere Einflüsse entstehen, beispielsweise durch die Einwirkung von karzinogenen (Krebs erzeugenden) Substanzen, wie sie etwa im Zigarettenrauch enthalten sind. Aber auch innere Fehler, zum Beispiel eine gewisse erbliche Veranlagung, können zu Grunde liegen. Sicher ist, dass eine einzelne Ursache für die Entstehung von Krebs nicht ausreicht. Stets müssen mehrere Faktoren zusammenkommen.
Schon seit über einem Jahrhundert erforschen Wissenschaftler die Krebserkrankungen. Trotz aller Fortschritte – ein wirklicher Durchbruch hat sich noch nicht ereignet. Hinter jeder Tür, welche die Forscher bislang aufschlossen, öffneten sich weitere Türen zu unbekannten Räumen. Was die Molekularbiologen jedoch mittlerweile von der Krebsentstehung wissen, könnte sich möglicherweise als der lange gesuchte Hauptschlüssel erweisen, mit dem sich alle Türen öffnen lassen.
Interview: "Eine Pille gegen Krebs wird es nie geben"
Spektrum der Wissenschaft: Herr Professor Kreienberg, nach Jahren der Stagnation scheint Bewegung in die Onkologie gekommen zu sein. Design-Medikamente machen von sich reden, die den Krebs selektiv und mit weniger Nebenwirkungen bekämpfen sollen. Welchen Stellenwert haben diese neuen Medikamente und welche Patienten profitieren von ihnen?
Prof. Dr. Rolf Kreienberg: Es ist tatsächlich so, dass seit kurzem die ersten Repräsentanten einer völlig neuen Gruppe von Medikamenten mit neuen Substanzen und neuen Ansatzpunkten zur Verfügung stehen. Hervorgegangen sind sie aus der molekularbiologischen Forschung, die die Ursachen der Krebsentstehung in der Zelle, bei den Genen und den Molekülen sucht. Das ist ein sehr interessanter, zukunftsweisender Ansatz. Man muss aber klar sagen, dass die bislang verfügbaren Medikamente auf Grund ihrer hohen Selektivität nur bei einer vergleichsweise geringen Anzahl von Patienten angewendet werden können.
Spektrum: Welche Medikamente und Patientengruppen sind das?
Kreienberg: Es handelt sich dabei zum Beispiel um Herceptin, einen Antikör-per, der beim metastasierten Brustkrebs verwendet werden kann, sofern die entarteten Zellen ein bestimmtes Oberflächenmerkmal tragen. Das zweite Medikament, STI571 oder Glivec, wirkt bei einer bestimmten Gruppe von Leukämiepatienten, deren Zellen in charakteristischer Weise verändert sind. Bis auf diese beiden Medikamente und zwei weitere Antikörper hat noch keines der neuen Medikamente die klinische Reife erreicht .
Spektrum: Die Therapie mit herkömmlichen Krebsmedikamenten, den Cytostatika, ist nach wie vor Standard. Welche Fortschritte sind in jüngster Zeit in diesem weniger im Vordergrund stehenden, konventionellen Bereich erarbeitet worden? Was kommt dem Patienten unmittelbar zugute?
Kreienberg: Hier sind erhebliche Fortschritte erzielt worden, von denen zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt noch weit mehr Patienten profitieren als von den hoch gelobten innovativen Medikamenten. Denn auch die schon seit nunmehr dreißig Jahren bekannten klassischen Cytostatika sind weiterentwickelt worden.
Die Cytostatika der zweiten und dritten Generation wirken selektiver und zerstören nicht mehr wahllos entartete und gesunde Zellen. Dies ist mit verschiedenen Methoden erreicht worden, die alle zum Ziel haben, die Nebenwirkungen zu minimieren, die Wirkung an der Tumorzelle aber zu optimieren. Ein Beispiel sind eingekapselte Cytostatika. Die Kapseln können nur von Enzymen, die für Tumorzellen typisch sind, aufgelöst werden. Erst dann wird das Zellgift, das Cytostatikum, frei. Gesunde Zellen bleiben weitgehend unbeschadet. Auch in der herkömmlichen medikamentösen Therapie haben also Innovationen stattgefunden – es wurde nur nicht groß darüber geredet.
Spektrum: Gibt es noch weitere solcher stillen Innovationen?
Kreienberg: Ja, man darf nicht die Ergebnisse der – sehr langwierigen – Therapieoptimierungs-Studien vergessen, die für den Patienten von entscheidender und konkreter Bedeutung sind. Solche Studien ermitteln beispielsweise, welche Cytostatika in welcher Weise miteinander kombiniert werden müssen, um eine bestimmte Tumorart bestmöglich zu bekämpfen. Wie wichtig die richtige Kombination von Cytostatika ist, zeigt das Beispiel der kindlichen Blutkrebserkrankungen. Der Einsatz herkömmlicher Cytostatika in der optimalen Kombination und Dosierung hat dort zu Steigerungsraten des Überlebens von fünfzig bis sechzig Prozent geführt. Das ist ein Riesenergebnis!
Spektrum: Zurück zu den Design-Medikamenten: Von außerordentlich bemerkenswerten Resultaten wird auch im Zusammenhang mit dem neuen Krebsmedikament STI571 gesprochen.
Kreienberg: Es sind damit bei dieser speziellen Patientengruppe bis zu 98 Prozent Remissionen erzielt worden – ein geradezu unglaubliches Ergebnis. Dennoch heißt es, zunächst abzuwarten. Man muss bei neuen Medikamenten nicht nur prüfen, ob sie wirken, sondern auch, wie lange sie wirken. Es ist zu befürchten, dass Krebszellen, die derart selektiv gehemmt werden, schnell Umgehungsstrategien aktivieren. Das heißt, man beobachtet zunächst wunderbare Remissionsraten, die aber nach einiger Zeit wieder verschwinden. Das könnte ein kritischer Punkt sein.
Spektrum: STI571 gehört zu den so genannten Signaltransduktionshemmern. Die Signaltransduktion zählt mit der Apoptose (dem programmierten Zelltod) und der Anti-Angiogenese (der Blockade von tumorversorgenden Blutgefäßen) zu den top-zitierten Themen der Krebsforschung. Welcher Ansatz verspricht den größten Erfolg?
Kreienberg: Alle diese Forschungsgebiete hängen eng miteinander zusammen. Es geht im Wesentlichen um die Grundfragen: Wie kommuniziert der Zellkern mit dem Außen? Wie reguliert eine Zelle ihr Wachstum? Wie schützt sie sich vor Schädigungen? Darüber erhalten wir derzeit jede Menge molekularer Informationen. Jede dieser neuen Erkenntnisse über tumorzellspezifische Informations- und Signalwege bringt auch potenzielle neue Ansatzpunkte für Medikamente. Ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten fünf Jahren eine Vielzahl von Medikamenten gegen die verschiedensten Bausteine dieser miteinander verwobenen Kaskaden auf den Markt drängen wird. Wir werden dann mindestens zehn Jahre brauchen, um sie klinisch zu prüfen. Ich bin von all diesen neuen Ansätzen begeistert – aber verhalten im Umgang mit Patienten. Denn die Begeisterung eines onkologischen Forschers hat nichts mit der Versorgung von Patienten zu tun, die heute in Not sind.
Spektrum: Könnte aus Krebs in naher Zukunft eine langfristig beherrschbare chronische Krankheit werden?
Kreienberg: Es ist grundsätzlich denkbar, dass es die neuen Behandlungsformen – von den molekularen Targets bis hin zur Immuntherapie – zusammen mit den herkömmlichen Strategien wie Chirurgie, Bestrahlung und Chemotherapie ermöglichen, Krebserkrankungen auf sehr verschiedenen Ebenen anzugreifen und langfristig bei guter Lebensqualität in Schach zu halten. Ob diese vielbeschworene, auf den jeweiligen Patienten individuell abgestimmte multimodale Therapie es tatsächlich eines Tages schaffen wird, den Krebs zu einer erträglichen und beherrschbaren Erkrankung wie Diabetes oder Bluthochdruck zu machen, lasse ich dennoch offen. So schön es wäre – zur Zeit weiß noch keiner, ob das wirklich funktionieren wird.
Spektrum: Wird es irgendwann einmal das eine wirksame Medikament, die Pille gegen Krebs geben?
Kreienberg: Eine Pille gegen den Krebs wird es meines Erachtens nie geben. Denn der Krebs ist keine Schwangerschaft mit einem einzigen vorausgehenden Ereignis. Krebs ist multifaktoriell. Und wenn ich sage, dass es vielleicht fünfhundert oder tausend Ereignisse gibt, die eine normale Zelle zur Krebszelle machen und für deren Ausbreitung im Organismus sorgen, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, wie kompliziert die Sache ist – und auf komplexe Fragen darf man bekanntlich keine einfachen Antworten erwarten.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 12 / 2001, Seite 46
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH




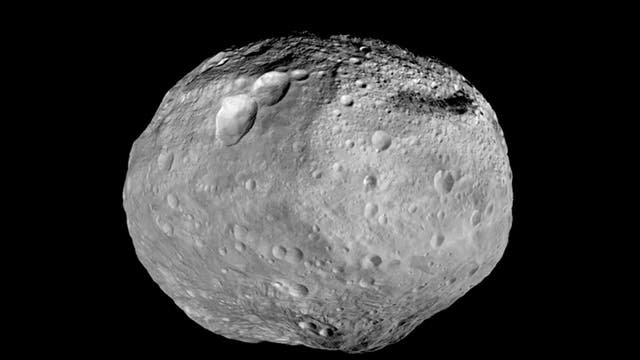

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben