Trends in der Humangenetik: Entschlüsseltes Leben
Ende dieses Jahres kommt ein Gentest auf den US-Markt, der Aufschluß über eine gewisse Veranlagung zu Brust- und Eierstockkrebs geben soll. Anders als ein bislang nur für Forschungszwecke bereitgestellter Test auf Veränderungen im sogenannten Brustkrebsgen BRCA1 ist er laut Hersteller – dem biotechnischen Unternehmen Myriad Genetics in Salt Lake City (Utah) – für Frauen mit der Diagnose Brust- oder Eierstockkrebs gedacht; bei positivem Ergebnis sollte die Patientin allen weiblichen Blutsverwandten nahelegen, sich vorsorglich testen zu lassen.
Nur schätzungsweise grob 5 Prozent aller Brustkrebserkrankungen sind erblich bedingt, davon aber rund 90 Prozent durch Fehler in BRCA1 und in dem im Vorjahr identifizierten BRCA2. In erblich belasteten Familien wird man Trägerinnen desselben Defektes möglicherweise vorsichtshalber zu einer beidseitigen Brustamputation raten – ihr Risiko, vor dem 50. Lebensjahr ebenfalls Brustkrebs zu bekommen, liegt bei vielleicht 60 und das auf die ganze Lebensspanne bezogene eventuell bei 85 Prozent; die Wahrscheinlichkeit von Eierstockkrebs beträgt immerhin etwa 45 Prozent.
Das sind allerdings pauschale Schätzungen. Inzwischen hat man allein im BRCA1-Gen mehr als 100 verschiedene Veränderungen gefunden, die jeweils unterschiedliche Risiken für Brust- und Eierstockkrebs bergen könnten. Diese lassen sich aber erst nach Auswertung sehr vieler Fälle genauer abschätzen. Wegen der aufwendigen und schwierigen Suche nach genetischen Fehlern und deren Interpretation ist nach Ansicht von medizinischen und epidemiologischen Experten kein einfacher und zugleich zuverlässiger Test für alle mutmaßlich Betroffenen zu erwarten.
Den Schritt von Myriad hält man auch deshalb für verfrüht, weil die Ärzteschaft wie die Gesellschaft insgesamt kaum auf die sich ergebenden medizinischen, sozialen und ethischen Fragen vorbereitet ist. Immerhin könnten die Ergebnisse Tausende von Amerikanerinnen vor die schwierige Entscheidung stellen, sich vorsorglich die Brüste abnehmen und die Eierstöcke entfernen zu lassen – oder darauf zu hoffen, daß sie bei Auftreten von Krebs geheilt werden beziehungsweise, daß sie gar nicht daran erkranken.
Tests auf medizinisch bedeutsame Genfehler gibt es erst wenige. Doch dürften Ärzte bald schon Dutzende Gene routinemäßig auf gewisse Mutationen hin überprüfen können. All diese Tests sind mehr oder weniger direkte Nebenprodukte des Human-Genom-Projekts: In diesem ehrgeizigen, auf 15 Jahre ausgelegten Gemeinschaftswerk haben Wissenschaftler aus aller Welt sich daran gemacht, die gesamte Erbinformation des Menschen zu kartieren und Buchstaben für Buchstaben zu entziffern, zu sequenzieren. Der 1989 eigens dazu gegründeten Human-Genom-Organisation gehören inzwischen rund 900 Mitglieder aus 40 Ländern an.
Die bisherigen Fortschritte des Projekts, als dessen offizieller Start der 1. Oktober 1990 gilt, übertreffen alle Erwartungen. Wie auf dem Human-Genom-Kongreß Ende März dieses Jahres in Heidelberg von optimistischen Teilnehmern verlautete, dürfte das Ziel, die Gesamtsequenz in ihren Eckdaten bis zum Jahre 2005 vorzulegen, sogar schon früher zu erreichen sein.
Dank neuer, im Zusammenhang mit dem Projekt entwickelter Verfahren hat sich die Geschwindigkeit, mit der menschliche Krankheitsgene entdeckt werden, nach Schätzungen des amerikanischen Nationalen Zentrums für Human-Genom-Forschung der Nationalen Gesundheitsinstitute in Bethesda (Maryland) seit Beginn der Arbeiten vervierfacht. Mittlerweile wird fast jede Woche die Charakterisierung eines medizinisch bedeutsamen Erbmolekül-Abschnitts gemeldet; und wenn jetzt mit der Massensequenzierung die letzte große Etappe des Projekts beginnt, wird die Menge an aufschlußreichen Daten über die Schlüsselsubstanz der menschlichen Existenz zunehmend rascher wachsen – schließlich dürfte stündlich die Sequenz eines weiteren Gens hinzukommen.
Wenn sich der Genstatus einer Person ermitteln läßt, was rasch immer umfassender möglich sein wird, müssen allgemeine Regelungen jedwedem Mißbrauch vorbeugen. Welche Befürchtungen bestehen, hat die Diskussion um den sogenannten gläsernen Menschen gezeigt. Auch muß das Recht auf Nichtwissen gewährleistet werden, so daß potentiell Gefährdete sich also nicht über ihr mögliches gesundheitliches Schicksal aufzuklären lassen brauchen.
In den Erkenntnissen, die von dem Projekt zu erwarten sind, sah und sieht man zwar die beste Chance, mehr und mehr Krankheiten einmal zu besiegen – nicht nur die seit langem als erblich bekannten, sondern auch solche, bei denen die genetischen Hintergründe subtiler und verwickelter sind wie im Falle von Krebs. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Besonders hohe Erwartungen richteten sich auf die Gentherapie, doch sind die (vorerst experimentellen) Ergebnisse bislang enttäuschend. Individuell zugeschnittene Genreparaturen könnten sich überdies, selbst wenn sie funktionierten und erwünscht wären, für eine allgemeine Anwendung als zu teuer erweisen, was die Gefahr einer Zwei-Klassen-Medizin birgt.
Unbehagen bereitet ferner, daß Unternehmen hektisch versuchen, sich Erbsubstanz-Sequenzen mit wirtschaftlichem Wert (die sich etwa für diagnostische Tests eignen) durch Patentierung zu sichern. Monopole und Rechtsstreitigkeiten, die möglicherweise die Forschung behindern, sind vorprogrammiert. In dieser Kommerzialisierung der natürlichen Genausstattung unserer Art sehen manche Kritiker auch eine gravierende Verletzung der Menschenwürde.
Die Leiter des Human-Genom-Projekts waren sich von Anfang an bewußt, daß die gewonnenen Erkenntnisse schaden wie nutzen können. Darum wurden Millionen von Dollar für die Untersuchung ethischer, rechtlicher und sozialer Fragen reserviert. Aber der technologische Fortschritt eilt allen Versuchen, international gültige Leitlinien für seine Anwendung zu formulieren, weit voraus.
Buchstabe um Buchstabe
Im Jahre 1990 schätzte man den Arbeitsaufwand, um die Abfolge der Nucleotid-Bausteine unserer Erbsubstanz – der DNA (Desoxyribonucleinsäure) – zu ermitteln, auf zigtausend Personenjahre. Die Nucleotide unterscheiden sich nur in ihrer Base: Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) oder Thymin (T). Die gesamte Sequenz, angegeben durch den Großbuchstaben jeder Base, würde 721000 Seiten von Spektrum der Wissenschaft lückenlos füllen. Allerdings sind nur etwa drei Prozent der gigantischen Textmenge für die schätzungsweise bis zu 100000 Gene des Menschen reserviert, die sich auf die 23 Chromosomenpaare jeder Körperzelle verteilen. Wozu die restlichen 97 Prozent dienen ist noch großenteils unbekannt.
Vor der großangelegten Sequenzanalyse waren Groberkundungen angesetzt, um die Terra incognita erst einmal abzustecken, also so etwas wie Übersichtslandkarten zu erstellen. Zunächst suchte man nach unverwechselbaren Landmarken, die eine Orientierung erleichtern. Je enger solche genetischen Marker auf einem Chromosom beieinanderliegen, desto öfter werden sie im Prinzip gemeinsam vererbt (weil die Wahrscheinlichkeit abnimmt, daß Crossing-overs – Austauschvorgänge zwischen den Partnerchromosomen – sie trennen). Ihre Austauschhäufigkeit ist ein Maß für den relativen Abstand beider Marker.
Die genaue, reale Entfernung zwischen einzelnen identifizierbaren DNA-Stücken läßt sich erst einer sogenann-ten physikalischen Karte des jeweiligen Chromosoms entnehmen, in der eine Unzahl von Fragmenten bekannter Größe anhand von Überlappungen in der richtigen Reihenfolge eingetragen ist. Zudem existiert inzwischen eine umfangreiche Sammlung spezieller Sequenzstücke, die gewissermaßen Etiketten für aktive Bereiche und damit für – oft noch unbekannte – Gene sind. All dies zusammen ermöglicht es, Gene, die mit Krankheiten assoziiert sind, künftig schnell aufzuspüren: Jene Marker, die praktisch stets im Zusammenhang mit einem bestimmten Leiden vererbt werden, verraten, auf welchen Molekülbereich die Fahndung einzuschränken ist; wo darin sich Gene aufhalten ist anhand spezieller Etiketten zu entnehmen. Sequenziermaschinen besorgen dann die eigentliche biochemische Sisyphusarbeit; die von ihnen gelieferten Daten gehen an Computer, die sie in das Gerüst der physikalischen Karte des Chromosoms einpassen. Durch Vergleich zwischen erkrankten und gesunden Personen läßt sich schließlich erkennen, worauf der Defekt beruht.
Während der letzten Jahre wurden immer mehr Forschungsprogramme zur Kartierung und Sequenzierung des menschlichen Genoms begonnen. In einer Reihe von Ländern laufen staatlich finanzierte nationale Projekte oder sind geplant – so in Australien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea, den Niederlanden, Rußland, Schweden, den USA und verschiedenen Staaten Südamerikas (das deutsche Human-Genom-Projekt kam erst Juni vergangenen Jahres in Gang). Die Kommission der Europäischen Union finanziert ein eigenes Programm, und die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wie auch die Weltgesundheitsorganisation beteiligen sich an entsprechenden Aktivitäten.
Die fruchtbare internationale Zusammenarbeit beschleunigte den Fortschritt: Bereits Ende 1994 lag eine gute genetische Karte des gesamten Genoms vor, eine umfassende auf der Basis sogenannter Mikrosatelliten-Marker wurde im vergangenen März publiziert, und 95 Prozent des menschlichen Erbguts sind mittlerweile auch durch hochauflösende physikalische Karten abgedeckt. Eine komplette derartige Übersicht mit Sequenzmarkierungen in Abständen von 100000 Basen (die als Ideal angestrebte Auflösung) soll bis Ende dieses Jahres vorliegen. Damit ist die Zeit reif für das eigentliche Sequenzieren im großen Stil (Bild 1).
Dem kommen wiederum Erfahrungen aus Pilotprojekten an Modellorganismen wie der Bäckerhefe oder dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans zugute. Sie haben gezeigt, wie man das Ganze beschleunigen und die Kosten senken kann. Der erfolgreiche Abschluß des Projekts, die zwölf Millionen Basen des Hefe-Genoms zu sequenzieren, wurde auf dem Human-Genom-Kongreß in Heidelberg verkündet; der einzellige Sproßpilz ist somit das erste entwicklungsgeschichtlich über den Bakterien stehende Lebewesen, bei dem dies gelungen ist.
Mehrere neuartige Sequenzierverfahren sind derzeit in Entwicklung. Nach Ansicht von Francis S. Collins (Bild 3 links), dem Direktor des Zentrums für Human-Genom-Forschung in den USA, wären nicht einmal grundlegend neue Ansätze erforderlich, um bis 2005 eine zu 99,9 Prozent genaue Sequenz des menschlichen Genoms vorzulegen: In den letzten beiden Jahren habe sich die Effizienz derart steigern lassen, daß die Aufgabe bereits mit den heutigen technischen Möglichkeiten im wesentlichen zu bewältigen sei – und mit den zu erwarteten Innovationen sogar zwei Jahre früher.
In den USA ist im April ein mit 60 Millionen Dollar gefördertes Pilotprojekt angelaufen; es soll laut Mark Guyer, Assistenz-Direktor des Zentrums, abklären helfen, ob die beim Großmaßstab angestrebte 99,99prozentige Genauigkeit überhaupt nötig und kostengünstig mit den in den nächsten drei Jahren aufkommenden Strategien zu erreichen wäre. Aber das weltweit erste Programm zur Großsequenzierung ist bereits Ende letzten Jahres am Sanger-Zentrum in Hinxton bei Cambridge (England) gestartet worden, gemeinsam finanziert vom britischen Medizinischen Forschungsrat und vom Wellcome-Trust.
Gentest – und was dann?
Von der Flut genetischer Daten, die jetzt auf uns zurollt, sind die meisten Menschen bisher nicht unmittelbar betroffen; doch das wird sich ändern. Mutationen zu identifizieren, die mit solch verbreiteten Leiden wie Krebs, der Alzheimer-Krankheit und manchen Formen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Zusammenhang stehen, ist fast schon Routine; und Tests für Mutationen in irgendeinem bekannten Gen lassen sich inzwischen nahezu umgehend entwickeln. Vergangenen Herbst kündigte das im amerikanischen Cambridge (Massachusetts) ansässige Biotechnologie-Unternehmen Genzyme ein Diagnoseverfahren an, mit dem sich die DNA von 500 Patienten gleichzeitig auf 106 verschiedene Mutationen in sieben Genen untersuchen läßt.
Die Testergebnisse können medizinisch segensreich sein – vorausgesetzt, die Auswirkungen der nachgewiesenen Mutationen sind hinreichend bekannt und man vermag etwas dagegen zu unternehmen: durch vorbeugende oder therapeutische Maßnahmen oder wenigstens durch konsequente ärztliche Überwachung (etwa um im Falle eines bestimmten Krebsrisikos Tumoren frühzeitig zu erkennen). Welche Konsequenzen die oft sehr vielen verschiedenen Mutationen in einem Gen haben, läßt sich freilich nur durch langwierige Untersuchungen aufklären.
Ein Beispiel ist die Mukoviszidose (auch cystische Fibrose genannt), die bei Europäern häufigste rezessive Erbkrankheit mit einer Lebenserwartung von etwa 30 Jahren. Die bei ihr besonders zähflüssige Schleim- und Sekretabsonderung schädigt Lunge und Verdauungsorgane fortschreitend (Spektrum der Wissenschaft, Februar 1996, Seite 32). Inzwischen kennt man fast 600 Mutationen in dem kritischen Gen (die bisherigen Tests erfassen nur einen Teil davon). Aus der Art des Defekts läßt sich aber noch nicht die Schwere der individuellen Erkrankung vorhersagen.
Noch unsicherer sind Prognosen und darauf abgestellte Maßnahmenkataloge, wenn bei Leiden wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehrere Gene und im einzelnen oft noch wenig definierte Faktoren der Umwelt und Lebensweise mitspielen. Eine bestimmte Mutation erhöht zwar dann die Wahrscheinlichkeit zu erkranken – aber weder garantiert ihr Fehlen Gesundheit, noch bedeutet ihr Vorhandensein, daß das Leiden wirklich auftritt.
Anders ist dies beim erblichen Veitstanz (Chorea Huntington). Bereits ein einziges defektes Gen läßt hier mit Sicherheit die neurodegenerative Erkrankung ausbrechen, meist zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr; Bewegungsstörungen und rapider geistiger Verfall sind die Folge. Nur – ein positives Testergebnis setzt einen Jugendlichen der entsetzlichen psychischen Belastung aus, fortan gleichsam auf die Vollstreckung dieses Urteils zu warten.
Gegenwärtig testet man zum Beispiel auf Mutationen, die mit Krebs zu tun haben (also das Risiko hierfür erhöhen), nur im Rahmen von Forschungsprojekten an großen medizinischen Zentren, eben weil die Interpretation der Ergebnisse mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Fest steht, daß für Frauen aus Familien mit gehäuft auftretendem Brustkrebs, der sich auf charakteristische Mutationen im BRCA1-Gen auf Chromosom 17 (Bild 2) zurückführen läßt, ein positiver Befund eine Hiobsbotschaft ist. Angesichts eines durchschnittlichen Erkrankungsrisikos von 85 Prozent für bösartige Tumoren der Brust sowie von 45 für solche der Eierstöcke lassen sich manche dann vorsorglich radikal operieren. Weibliche Angehörige, die den Defekt nicht geerbt haben, dürften zwar erleichtert sein – ihr generelles Risiko für die viel verbreiteteren spontan auftretenden Formen von Brustkrebs besteht aber weiterhin (in der Bundesrepublik erkrankt schätzungsweise jede neunte Frau im Laufe ihres Lebens daran).
Welche Gefahr zudem für Frauen besteht, die zwar ein mutiertes BRCA1-Gen tragen, aber aus offensichtlich nicht mit dem Krebs belasteten Familien stammen, weiß man nicht genau; sie ist jedoch womöglich geringer als bei familiärer Belastung. Ebensowenig geklärt ist, ob die ethnische Zugehörigkeit einen Einfluß hat. Immerhin weiß man, daß bei der Erbkrankheit Neurofibromatose – charakterisiert durch gutartige Wucherungen des Nervensystems – der Defekt eines Gens sich bei Weißen stärker als bei Schwarzen auswirkt; und bei Frauen askenasisch-jüdischer Abstammung ist eine bestimmte Erbänderung im BRCA1-Gen besonders häufig.
Die gleichen Einschränkungen gelten für Befunde an BRCA2. Diese und andere Unsicherheiten bedeuten ein unerträgliches Dilemma: Sollte eine Frau sich vorsorglich einer radikalen Operation unterziehen oder auf intensive Überwachung unter anderem durch regelmäßige Mammographien setzen? Diese birgt wiederum aufgrund der Strahlenbelastung selbst ein gewisses Risiko und ist außerdem bei Jüngeren weniger aufschlußreich; erbliche Formen von Brustkrebs treten aber gerade oft relativ früh auf.
Die meisten Fachleute rechnen nicht in absehbarer Zeit mit einer Lösung solcher Probleme. Gegen das Vorhaben der Firma Myriad, ihren BRCA1-Test allen Frauen mit frisch diagnostiziertem Brust- oder Eierstockkrebs (und möglichst auch deren weiblichen Angehörigen) anzubieten, wenden sich die Amerikanische Gesellschaft für Humangenetik und die National Breast Cancer Coalition (eine Interessenvertretung) unter anderem auch deshalb, weil die Bedeutung eines positiven Ergebnisses für das therapeutische Vorgehen unklar ist. Sie haben gemeinsam gefordert, bis auf weiteres – wie bisher – nur im Rahmen von Forschungsprogrammen zu testen.
Derartige Vorsicht verträgt sich nicht mit wirtschaftlichen Interessen. Selbst wenn allein die neu erkrankten Frauen und nicht auch ihre weiblichen Blutsverwandten das Angebot wahrnähmen, könnte Myriad mehr als 200000 Tests im Jahr verkaufen. Nach Auskunft ihres Präsidenten Peter D. Meldrum untersucht die Firma das Risiko für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Dennoch bezeichnet Collins die Vermarktungspläne als "möglicherweise verfrüht", weil bis Ende dieses Jahres wahrscheinlich noch nicht so viel über die Mutationen und die geeigneten Behandlungsmöglichkeiten bekannt sein dürfte, daß eine breite Anwendung des Tests zu rechtfertigen wäre.
Ein anderes Unternehmen, OncorMed in Gaithersburg (Maryland), vermarktet BRCA1-Tests bereits, aber zum Einsatz in Forschungsprojekten, an denen Frauen aus Hochrisikogruppen teilnehmen. Ferner testet die Firma auch auf Mutationen, die mit einer Form von Dickdarmkrebs assoziiert sind.
Die Arzneimittelbehörde der USA, die Food and Drug Administration (FDA), hat bisher keine Vorschriften für Gentests erlassen. Eine eigens eingesetzte Gruppe des amerikanischen Genom-Programms erwägt jedoch, sie zu Beschränkungen zu drängen: Tests auf Mutationen, die mit Krebs zusammenhängen, sollen so lange nur zu Forschungszwecken erlaubt sein, bis der Wert von Behandlungsmöglichkeiten solide ermittelt ist.
Angst vor Benachteiligung
In den Vereinigten Staaten mit ihrem überwiegend privatwirtschaftlichen Krankenversicherungswesen haben sich die wenigen Frauen, die schon von ihrem mutierten BRCA1-Gen wissen, nach Aussagen von Barbara B. Biesecker vom Nationalen Zentrum für Human-Genom-Forschung alle erdenkliche Mühe gegeben, ihrer Versicherung den Befund zu verheimlichen. Unter anderem befürchten sie, daß die Unternehmen eine Mutation als Vorerkrankung interpretieren und es ablehnen, im Zusammenhang damit auftretende Behandlungskosten zu übernehmen. Solche Ängste sind auch bei Neuabschluß durchaus berechtigt: Private Krankenversicherungen nehmen Personen, in deren Familie gehäuft Krebsfälle vorgekommen sind, oft überhaupt nicht oder nur zu stark erhöhten Prämien auf (gleiches gilt für die Huntington-Chorea).
Darauf stellen sich auch die Wissenschaftler ein, die solche Risiken ermitteln. Im letzten Herbst fragte beispielsweise Thomas H. Murray von der Case-Western-Reserve-Universität in Cleveland (Ohio) bei einer Tagung der Amerikanischen Gesellschaft für Humangenetik, ob seinen Kollegen Patienten bekannt seien, die sich nur anonym oder unter falschen Namen testen lassen wollten. Überall im Saal hoben sich Hände. In vielen klinischen Studien der USA werden die Teilnehmenden nun ausdrücklich gewarnt, daß die Ergebnisse Probleme mit der Versicherung zur Folge haben könnten, wenn sie in die Krankenakten gelangten; nur spezielle Vertraulichkeitszertifikate schützen bei gerichtlichen Auseinandersetzungen vor dem Zugriff darauf.
Andere Patienten lehnen schlicht solche Tests ab, obgleich sie sich damit den möglichen medizinischen Nutzen entgehen lassen. Wer beispielsweise am Hippel-Lindau-Syndrom (HLS) leidet – seltenen erblichen Blutgefäßwucherungen der Augennetzhaut und des Kleinhirns, wobei sich häufig auch Zysten in Bauchspeicheldrüse, Nieren und Leber bilden –, findet in den USA ebenfalls kaum eine Krankenversicherung, weil teure Operationen zu befürchten sind. Vorbeugen läßt sich den Wucherungen zwar nicht, regelmäßige kernspin-tomographische Aufnahmen und Entfernen der entdeckten Neubildungen verlängern jedoch die mittlere Überlebensspanne. Laut William Dickson von der HLS-Patientenorganisation lassen viele betroffene Eltern in den USA ihre Kinder nicht auf das kürzlich entdeckte HLS-Gen testen, weil sie die Verweigerung des Versicherungsschutzes befürchten.
Ähnliches gilt für die sehr häufige erbliche polycystische Nierendegeneration, welche die Lebenserwartung auf etwa 50 Jahre einschränkt. Das zugehörige Gen, PKD1, wurde 1994 identifiziert, und zwar mit Methoden, die man im Rahmen des Genom-Projekts entwickelt hatte.
Eine Arbeitsgruppe, die sich mit den ethischen, rechtlichen und sozialen Auswirkungen des Human-Genom-Projekts in den USA befaßt, empfahl denn auch kürzlich zusammen mit Experten des National Action Plan on Breast Cancer (der letztlich auf Initiative des US-Präsidenten Bill Clinton zustande kam), den Versicherungsgesellschaften die Verwendung genetischer Daten und das Anfordern von Tests zur individuellen Risikoabschätzung auf nationaler Ebene zu verbieten (einige Bundesstaaten haben dies auf Landesebene bereits getan). Indes fragen Versicherer in der Regel noch gar nicht direkt nach Ergebnissen genetischer Tests; Erkundigungen über Krankheit und Todesursachen der Eltern reichen bereits, viele der Risikopersonen zu identifizieren. Zahlreiche amerikanische Arbeitgeber bieten ihrer Belegschaft eine Art Gruppenversicherungsvertrag an; der Schutz erlischt jedoch mit dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses.
Weil US-Bürger mit genetisch bedingten Erkrankungen sich aus Furcht vor sozialem Ruin oftmals nicht freiwillig zu erkennen geben, läßt sich das Ausmaß ihrer Diskriminierung nur schwer einschätzen. Eine der ersten ausgedehnten Umfragen zu diesem Problem hat eine Gruppe um Lisa N. Geller von der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts) im Januar diesen Jahres in "Science and Engineering Ethics" veröffentlicht (Heft 2, Seite 71). Fragebögen wurden an noch symptomfreie Personen verschickt, bei denen das Risiko eines Erbleidens bestand. Von den 917, die antworteten, gaben 455 an, durch das Bekanntwerden der Diagnose benachteiligt worden zu sein. Im persönlichen Gespräch kamen dann Einzelheiten zutage: Kranken- und Lebensversicherer hatten einen Vertrag verweigert oder aufgekündigt; ferner hatten Arbeitgeber Betroffene entlassen oder eine Einstellung abgelehnt, obgleich das durch Bundesgesetze untersagt ist.
In Europa herrscht weniger Besorgnis, was die finanzielle Grundabsicherung von Krankheitsrisiken anbelangt, weil sie teilweise staatlich garantiert oder geregelt ist. Laut einem Bericht in dem britischen Wissenschaftsmagazin "Nature" vom 1. Februar 1996 (Band 379, Seite 389) gibt es bislang in Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Portugal sowie in Japan noch keine Gesetze über den Gebrauch von genetischen Tests oder die Nutzung entsprechender Ergebnisse durch Lebens- wie auch Krankenversicherungsgesellschaf-ten. Diese haben in Frankreich einem fünfjährigen Moratorium für eine solche Verwendung zugestimmt. In den Niederlanden, wo bislang für hohe Lebensversicherungspolicen ein Test gefordert werden konnte, soll nur mehr die Frage nach früheren Ergebnissen erlaubt sein. Belgien, Österreich und Norwegen haben sich für ein unbegrenztes Verbot entschieden. Für Großbritannien hat "Nature" zunächst ein kurzes, aber absolutes Moratorium vorgeschlagen sowie eine ausführliche öffentliche Debatte. Bewußt übervorsichtige erste Bestimmungen sollten folgen, die sich wieder lockern ließen, wenn umfassendere Erfahrungen mit bestehenden und mutmaßlichen Problemen vorliegen.
Beratung erforderlich
Selbst wenn verhütet wird, daß die Bestätigung eines gravierenden genetischen Defekts soziale Schwierigkeiten zur Folge hat – für den Betroffenen ist sie ein schwerer Schock, die ihn in seinem Selbstwertgefühl trifft und vieler Hoffnungen beraubt. Da ein positives Testergebnis auch für engere wie ferne-re Blutsverwandte Konsequenzen haben kann, werden familiäre Beziehungen belastet, was bei allen Beteiligten Schuldgefühle und Depressionen auslösen mag. Die Angst vor solchen Auswirkungen eines Laborbefundes dürfte auch der Grund sein, warum potentielle Überträger einer Veranlagung für Mukoviszidose, die selbst nicht gefährdet sind (weil nur eines der beiden Exemplare des Gens im Erbgut defekt ist), den seit einigen Jahren verfügbaren Test überraschend wenig nutzen (er kann übrigens die meisten, aber nicht alle Überträger erfassen).
Nach Übereinkunft genetischer Berater sollen Kinder wegen der möglichen psychischen Schäden nicht auf Mutationen getestet werden, die eine erst im Erwachsenenalter ausbrechende Erbkrankheit vorhersagen – es sei denn, man kann medizinisch eingreifen. Dies müßte insbesondere für die bislang nicht aufzuhaltende Huntington-Chorea gelten. Aber nach einer Umfrage von Dorothy C. Wertz und Philip R. Reilly vom Shriver-Zentrum für geistige Retardiertheit in Waltham (Massachusetts) haben 23 Prozent jener Gentest-Labors in den USA, die Mitglieder der Dachorganisation Helix sind und über die technischen Voraussetzungen für einen Nachweis der Huntington-Mutation verfügen, auch Kinder unter zwölf Jahren untersucht.
Fast jedes zweite Labor hatte Tests direkt im Auftrag von Patienten vorgenommen, ohne daß ein Arzt eingeschaltet gewesen wäre. Dabei kann die Bedeutung genetischer Diagnosen, so warnt Dorothy Wertz, von Laien leicht mißverstanden werden; und viele Ärzte seien nicht ausreichend für eine genetische Beratung geschult.
Es gibt aber auch Positives zu verzeichnen: Auf der Grundlage von Entdeckungen, die durch das Genom-Projekt gefördert wurden, läßt sich beispielsweise eine bestimmte Veranlagung zu Dickdarmkrebs (der familiären adenomatösen Polyposis mit einem fast 100prozentigen Erkrankungsrisiko) anhand einer charakteristischen Mutation sicher nachweisen. Das Leiden manifestiert sich in diesen Fällen durch Bildung zunächst gutartiger Polypen, was sich bei strikter Überwachung rechtzeitig erfassen läßt (Spektrum der Wissenschaft, Mai 1995, Seite 36). Manche Betroffene haben sich bei den ersten kritischen Anzeichen oder schon vorbeugend zu einer Entfernung des Dickdarms entschlossen. Die Entscheidung für eine solch radikale, wenn auch vermutlich lebensrettende Maßnahme wird durch die Gendiagnose allerdings nur erleichtert; praktiziert hat man den Eingriff bei Gefährdeten schon seit den zwanziger Jahren. Dringend erforderlich wären auch neuartige Therapieverfahren, für die es aber kaum erst Konzepte gibt.
Im Falle der Mukoviszidose sind indes, wie Collins betont, nur sechs Jahre nach der Entdeckung des verantwortlichen Gens (an der er maßgeblich beteiligt war) bereits gezielter gegensteuernde Medikamente in der ersten klinischen Erprobung (Spektrum der Wissenschaft, Februar 1996, Seite 32). Offen ist noch, wie schnell bei positivem Ausgang ein allgemein anwendbares Behandlungsschema entwickelt werden kann.
Besonders heikel ist die vorgeburtliche genetische Diagnostik. Eine Beratergruppe der Europäischen Kommission für ethische Probleme im Zusammenhang mit der Biotechnologie hat erklärt, daß Schwangere nie zu solchen Tests gezwungen werden sollten. Lassen sie embryonale, etwa dem Fruchtwasser entnommene Zellen untersuchen, sei das Ergebnis allein den Eltern mitzuteilen. Zudem sollte das Verfahren ausschließ-lich auf medizinische Indikationen beschränkt und nicht zum Feststellen des Geschlechts oder anderer medizinisch nicht relevanter Merkmale verwendet werden.
Ferner empfiehlt die Gruppe, solche Tests – wie einfach sie auch künftig zu handhaben sein mögen – nur lizensierten medizinischen Zentren zu gestatten und die Qualität ihrer Arbeit, insbesondere auch ihrer genetischen Beratung, fortlaufend zu überwachen; schließlich müßten die Eltern für die schwierige Entscheidung, ein werdendes Kind mit genetischem Defekt abzutreiben oder nicht, die nötige Aufklärung bekommen. Dazu gehören eingehende Informationen über vorhandene oder künftige Behandlungsaussichten. Unter diesen sind jene der Gentherapie, wohl besser Gentransplantation genannt, am heftigsten öffentlich diskutiert worden – verfrüht. Denn erst im Dezember letzten Jahres kamen die amerikanischen Gesundheitsinstitute bei einer Überprüfung aller vorliegenden Ergebnisse zu dem Schluß: "Bei keinem Verfahren der Gentherapie wurde die klinische Wirksamkeit bisher zweifelsfrei nachgewiesen." Die als Paradefall vorgestellte neuartige Behandlung des Adenosindesaminase-Mangels (Spektrum der Wissenschaft Spezial 4: Schlüsseltechnologien, 1995, Seite 72) hatte bestenfalls mäßigen Erfolg; den Kindern muß das ausgefallene Enzym weiterhin künstlich zugeführt werden. An der Effizienz bleibt also viel zu verbessern.
Gene und Kommerz
Trotz solcher Probleme sind Effekte der genetischen Revolution bereits in der Wirtschaft zu spüren. Pharmafirmen investieren Abermillionen in die Suche nach Genen, die mit Krankheiten zu tun haben, denn über die davon codierten Proteine und deren Funktionen könnte man geeignete molekulare Hebel finden, um diagnostisch oder therapeutisch anzusetzen.
Ein Verfahren, in der Unmenge menschlicher Erbinformation möglichst alles an aktiven Bereichen herauszufischen, entwickelte J. Craig Venter vom privat finanzierten Institut für Genom-Forschung in Gaithersburg (Maryland): Dazu isoliert man beliebige Boten-RNA-Moleküle ganz oder in Stücken; dieses der DNA verwandte Zwischenprodukt wird nur an aktiven Genen einer Zelle gebildet – exprimiert – und läßt sich in eine DNA-Form umschreiben, die dann kloniert wird. Durch Teilsequenzierung gewinnt man so etwas wie Etiketten (englisch expressed sequence tags, ESTs), die mit relativ geringem Aufwand bei etwas Glück gewisse Grundinformationen über ihnen zuordenbare Gene liefern; zugleich dienen sie gewissermaßen als Angelhaken, um diese herauszufischen.
Manche Wissenschaftler waren von Venters Ansatz, der die herkömmlichen Methoden umgeht, zunächst wenig beeindruckt; damit gewinnt man nicht die umfassenden Informationen wie mit vollständigem Sequenzieren. Dennoch hat sich das Verfahren als brauchbar und wirtschaftlich ertragversprechend erwiesen. Zwei Firmen – Human Genome Sciences (das Mutterunternehmen von Venters Organisation) und Incyte Pharmaceuticals im kalifornischen Palo Alto – suchen damit eifrig nach gewinnträchtigen Genen.
Nach Angaben von William A. Haseltine, dem Präsidenten von Human Genome Sciences, hat seine Firma 90 Prozent aller menschlichen Gene identifiziert (wohlgemerkt – das ist nicht gleichbedeutend mit sequenziert) und Dutzende davon bereits zur Herstellung von Proteinen genutzt, die möglicherweise therapeutischen Wert haben (Bild 3 rechts). Außerdem hätten diese Aktivitäten "beträchtliche Auswirkungen" auf das Medikamentenentwicklungsprogramm seines Hauptgeschäftspartners, des Pharmakonzerns SmithKline Beecham. Die Firma Incyte behauptet ihrerseits, sie habe "die meisten" Gene des Menschen identifiziert und schon Kunden für ihre dafür eingerichteten Datenbanken gefunden.
Der kleine Unterschied
Die Anstrengungen zur kommerziellen Ausbeutung des Genoms erwecken freilich selbst unter pragmatischen Amerikanern Protest. Mit politischen Argumenten angegriffen wird hingegen in erster Linie das sogenannte Human-Genom-Diversitäts-Projekt, das formal nicht mit dem Human-Genom-Projekt verbunden ist. Es hat zum Ziel, die Variation in den Gensequenzen der verschiedenen ethnischen Gruppen der Erde zu untersuchen.
Inauguriert hat es Luigi Cavalli-Sforza von der Universität Stanford (Kalifornien). Befürworter verweisen darauf, daß die DNA, die im eigentlichen Genom-Projekt analysiert wird, größtenteils europäischen und nordamerikanischen Ursprungs sei. Die Untersuchung der Variationen innerhalb der Weltbevölkerung – sie machen insgesamt nur 0,1 Prozent aus – könnte nach Cavalli-Sforza wertvolle Aufschlüsse über spezielle Anpassungen geben, darunter über Resistenzen gegen Erkrankungen.
Henry T. Greely, Jura-Professor an der Universität Stanford und Mitorganisator des Diversitäts-Projekts, ist sich der Gefahren durchaus bewußt: Rassisten könnten Ergebnisse dazu mißbrauchen, sich willkürliche Vorwände für die Diskriminierung bestimmter Gruppen zusammenzuschustern. Aber er meint, man werde mit Verantwortung solchen Auswüchsen wehren können. Und er betont, wie oberflächlich die genetischen Unterschiede zwischen Populationen jeglicher Abkunft nach derzeitigen Befunden sind: Die stärksten innerhalb der minimalen Gesamtvariation von 0,1 Prozent findet man überwiegend zwischen Angehörigen derselben ethnischen Gruppe, nicht etwa zwischen Amerikanern europäischen und afrikanischen Ursprungs oder Basken und Chinesen. "Biologisch gesehen gibt es nicht so etwas wie eine klar definierte Rasse", sondern nur "einen kontinuierlichen Übergang von einer Population zur anderen", sagt ein zusammenfassendes Dokument des Human-Genom-Diversitäts-Projekts.
Nach dessen Verfahrensvorschriften dürfen Proben von Zellen ohne Einverständnis der Spender nicht kommerziell genutzt werden; außerdem sollte dem Individuum oder der Population eine Provision aus eventuellen profitablen Anwendungen zustehen. Damit wird einer Ausbeutung vorgebeugt. Allerdings kritisierte ein Komitee der UNESCO mangelnde Kontakte zu den Betroffenen in der Planungsphase.
Patente, Patente
Wie der Wettlauf um Genom-Patente schließlich ausgehen wird ist unklar. Ein Gerangel um Nutzungsrechte an jedem sequenzierten Gen würde nach Ansicht von Collins die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern untergraben; viele wären versucht, neue Daten erst zu veröffentlichen, wenn sie sich die Auswertung gesichert haben. Die Forschungsfreiheit ist zwar bislang nicht durch Patente beschnitten worden, weil sie sich nicht auf Experimente im Dienste des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts erstrecken. Dies dürfte aber nicht einfach als gegeben angesehen werden, meint Rebecca Eisenberg, eine Expertin für solche Rechtsfragen an der Universität von Michigan in Ann Harbor: Wenn Wissenschaftler mehr wirtschaftliche Bindungen eingehen, würden Eigentumsinteressen am Genom wohl energischer vertreten.
Bevor jemand ein Gen patentieren lassen kann, muß er etwas über dessen Funktion herausbekommen, um die juristische Anforderung der Nützlichkeit oder gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen. Dies ist in den meisten Fällen eine äußerst schwierige Aufgabe, die viel Kreativität für neuartige Lösungen erfordert (damit wird man sozusagen zum Erfinder). Auch die vom Europäischen Rat (den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer) vorgeschlagenen Grundsätze zum rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen sehen vor, DNA-Abschnitte unbekannter Funktion von der Patentierung auszuschließen. Ein Großteil der Forschungseinrichtungen, die nützliche Eigenschaften effizient zu ermitteln verstehen, ist jedoch von der Industrie kontrolliert. Kommerzialisierung scheint also eine unvermeidliche Konsequenz der Entschlüsselung des Genoms zu sein – eine Tendenz wie bei anderen Projekten anwendbarer Forschung.
Nach einer im April 1996 in "Nature" veröffentlichten umfassenden Analyse eines Wissenschaftlerteams von der Universität von Sussex in Brighton (Band 380, Seite 385) sind zwischen 1981 und 1995 weltweit 1175 Patente für menschliche DNA-Sequenzen erteilt worden, drei Viertel davon an die Industrie. Die meisten dieser Unternehmen haben ihren Sitz in Japan und den USA. Nur 7 Prozent gingen an Einzelpersonen und 17 Prozent an Institutionen des öffentlichen Sektors. Die Hälfte der 1175 Patente hat das Europäische Patentamt (EPO) ausgegeben, wiederum 70 Prozent davon allein an diese beiden Staaten, nur 24 Prozent an europäische Länder (beim EPO-System werden Patente innerhalb von zwei Jahren und zudem kostengünstiger bearbeitet als in den USA).
Das Patentamt der USA hat zwar vor kurzem Anhörungen abgehalten, um durch die Patentierung von Genen aufgeworfene Fragen genauer zu erörtern; aber daß es auf das Drängen einiger Kritiker hin versuchen würde, den gebrochenen Damm wieder zu errichten, gilt als unwahrscheinlich. Und solange finanzstarke Unternehmen nicht die Arbeit und Kooperation unabhängiger Forscher abwürgen, dürften die reichen Nationen wohl weiterhin von dem Gen-Rausch profitieren.
Was hat aber die übrige Welt davon? Einige der derzeit geprüften Ansätze zur Gentherapie sind individuell auf Patienten zugeschnitten. Viele Kranke auf diese Weise zu behandeln wäre jedoch, wie James V. Neel von der Universität von Michigan warnt, selbst in reicheren Nationen viel zu teuer. Mit herkömmlichen Maßnahmen wie wohlabgestimmter Ernährung und stärkerer körperlicher Betätigung, so betont er, ließe sich etwa dem Altersdiabetes kostengünstiger begeg-nen als mit genmedizinischen Verfahren (diese müssen also kein weiteres Nord-Süd-Gefälle heraufbeschwören). Genetiker sollten eben nicht nur auf die DNA starren, sondern schädliche Verhaltensweisen und Umwelteinflüsse mit im Blick haben – Dispositionen allein bedeuten in der Regel kein strikt vorgezeichnetes Schicksal.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 7 / 1996, Seite 48
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH



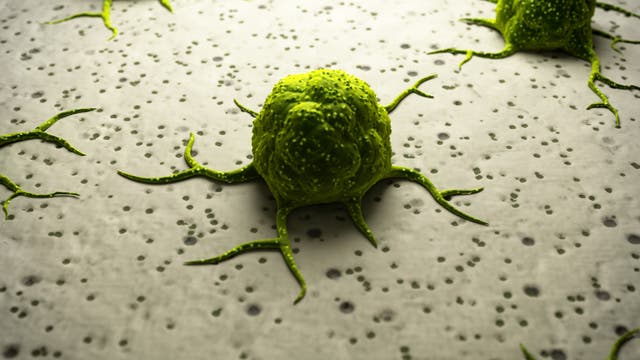


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben