Login erforderlich
Dieser Artikel ist Abonnenten mit Zugriffsrechten für diese Ausgabe frei zugänglich.
Psychologie | Wissenschaftsgeschichte: Ganz oder gar nicht
Die Gestaltpsychologie gilt als das Werk eines Forschertrios, das ab 1910 in Frankfurt und später in Berlin zusammenarbeitete: Max Wertheimer, Kurt Koffka und Wolfgang Köhler. Doch waren sie beileibe nicht die Einzigen, die Wahrnehmung und Denken als ganzheitliche Prozesse verstanden.

© (Ausschnitt)
Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Die amerikanische Dichterin Gertrude Stein, die diesen Ausspruch prägte, hatte mit Gestalttheorie wenig zu tun. Dennoch brachte sie in ihrem berühmtesten Vers (aus dem Gedicht "Sacred Emily" von 1913) ein Erstaunen zum Ausdruck, das auch manche Psychologen jener Zeit überkam. Denn die vier Buchstaben R, o, s, e ergeben in unserem Kopf nicht einfach ein Wort; sie evozieren das Bild der Blüte, ihren Duft, ihre Symbolkraft – alles Eigenschaften, die mit den Lettern selbst gar nichts zu tun haben. Kurz: Sie erschaffen eine Gestalt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – so lautet der Leitsatz der Gestaltpsychologie. Genauer gesagt: Das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile. Dieses Prinzip bezeichnen Psychologen als Übersummenhaftigkeit oder Übersummativität. Ein zweites wichtiges Merkmal der Gestalt ist ihre Transponierbarkeit: Unabhängig von den einzelnen »Bauelementen« erkennen wir eine Gestalt stets als solche wieder. Einen Stuhl etwa nehmen wir immer als Stuhl wahr, auch wenn der eine aus Holz ist und der andere aus Metall. Diese beiden Kriterien hat der österreichische Psychologe Christian von Ehrenfels (1859 – 1932) in seinem Aufsatz "Über Gestaltqualitäten" (1890) erstmals herausgearbeitet. Er verdeutlicht sie am Beispiel der Melodie: Zerlegen wir diese in ihre einzelnen Töne, bricht der kohärente Höreindruck augenblicklich zusammen. Eine Melodie, die uns beschwingt oder traurig macht, zu Tränen rührt oder zum Tanzen animiert, entsteht erst in der zeitlichen Abfolge mit bestimmter Intonation und Lautstärke. Ihre grundlegend neue Qualität geht den einzelnen Bestandteilen, aus denen sich die Melodie zusammensetzt, dabei völlig ab. Auch die Transponierbarkeit von Melodien ist offenkundig: Spielt man sie ein paar Töne höher oder tiefer, ändert sich nichts an ihrer Eigenschaft. Auf diese beiden Gestaltkriterien haben sich nachfolgende Psychologen immer wieder berufen ...
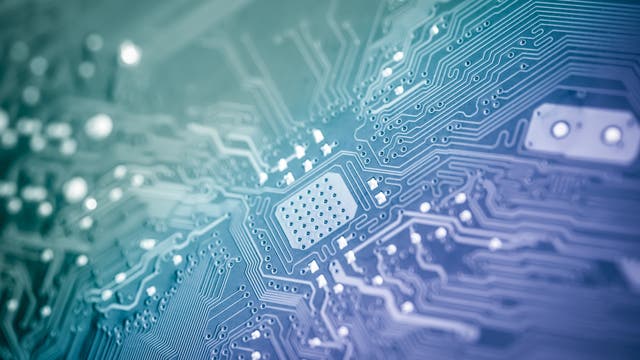

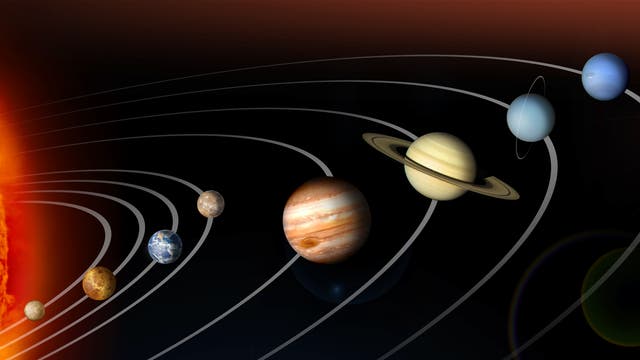
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben