Medizin: Gentherapie, zweiter Anlauf
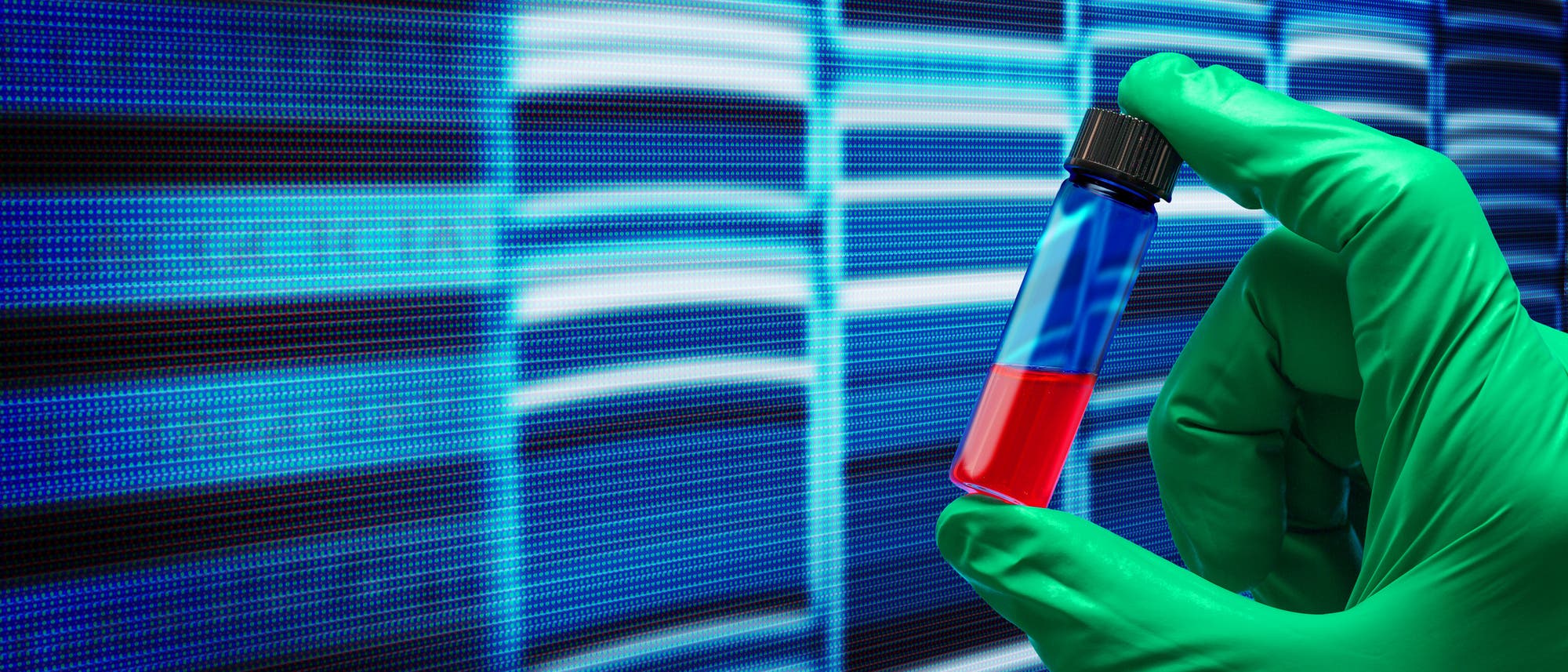
Im Jahr 1999 kam die Weiterentwicklung der Gentherapie ziemlich abrupt zum Stillstand. Denn am 17. September dieses Jahres erlag der Teenager Jesse Gelsinger, der an einer seltenen Stoffwechselkrankheit litt, den Folgen eines solchen Eingriffs. Sein Immunsystem hatte auf die Behandlung mit viralen Genfähren dermaßen aggressiv reagiert, dass er starb – womit die beteiligten Mediziner nicht im Mindesten gerechnet hatten. Geblendet von den frühen Erfolgen der Gentherapie hatten sie unrealistische Erwartungen gehegt und ihre diesbezüglichen Fähigkeiten überschätzt.
Gelsingers tragischer Tod und andere Fehlschläge zwangen viele Wissenschaftler dazu, ihr Vorgehen in Sachen Gentherapie zu überdenken und die klinische Tauglichkeit solcher Behandlungsansätze kritischer zu hinterfragen. Sie schraubten ihre Erwartungen zurück und wandten sich erneut der Grundlagenforschung zu, um der Methode eine Renaissance zu ermöglichen. So gelang es ihnen, potenziell tödliche Komplikationen besser vorauszusehen als vorher und sie zu vermeiden. Zudem verwandten sie mehr Sorgfalt darauf, Patienten und ihre Angehörigen über Nutzen und Risiken der Gentherapie aufzuklären.
Viele Beobachter stimmen darin überein, dass der Wendepunkt um das Jahr 2008 erreicht war. Damals behandelten Ärzte den acht Jahre alten Corey Haas, der infolge einer degenerativen Netzhauterkrankung allmählich erblindete. Eine Gentherapie befähigte die Netzhautzellen seines linken Auges dazu, ein bestimmtes Protein herzustellen, dessen Synthese zuvor wegen eines angeborenen Gendefekts nicht möglich gewesen war. Vier Tage nach der Behandlung besuchte Haas den Zoo und konnte zu seiner Verblüffung sowohl die Sonne als auch einen Heißluftballon erkennen. Drei Jahre später erhielt er die gleiche Therapie im rechten Auge. Inzwischen kann er wieder so gut sehen, dass er zusammen mit seinem Großvater auf Truthahnjagd geht.
Europa als Vorreiter bei den Zulassungsverfahren
Gentherapien sind in Krankenhäusern zwar noch keine Routineverfahren. Doch das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat 2012 die erste Gentherapie zugelassen, und zwar zur Behandlung einer seltenen, aber extrem schmerzhaften Stoffwechselerkrankung namens familiäre Lipoproteinlipase-Mangel. 2013 hoben die Nationalen Gesundheitsinstitute in den USA (NIH) einige restriktive Vorschriften auf dem Gebiet auf, weil sie nicht mehr notwendig erschienen. Kenner der Pharmaindustrie rechnen für das Jahr 2016 mit der Zulassung des ersten kommerziellen Gentherapieverfahrens in den USA. Nach einem verlorenen Jahrzehnt schickt die Gentherapie sich nun doch an, ihr Versprechen auf revolutionäre Behandlungsansätze einzulösen.
Die frühen Fehlschläge der Gentherapie illustrieren, wie schwierig es ist, Fremd-DNA effektiv und gefahrlos ins Zielgewebe einzubringen. Sichere Gentransferverfahren waren oft nicht sehr effektiv, und effektive Methoden waren oft nicht sicher – entweder weil sie verheerende Immunreaktionen auslösen konnten, wie im Fall von Jesse Gelsinger, oder weil sie das Risiko bargen, beim behandelten Patienten eine Krebserkrankung zu verursachen.
Um herauszufinden, wie diese Nebenwirkungen entstehen und wie sie sich vermeiden lassen, konzentrierten sich die Wissenschaftler auf das am häufigsten verwendete Transportvehikel zum Einschleusen von Genmaterial: Ein Virus wird so modifiziert, dass es als Genfähre (als so genannter Vektor) agiert. Dazu entfernen die Forscher zunächst einige Bereiche aus dem viralen Genom, um Raum für die therapeutischen Gene zu schaffen, die sie in die Zellen des Patienten einbringen wollen. Die Verstümmelung des Virusgenoms hat zudem den Vorteil, dass sich das infektiöse Partikel im Körper nicht vermehren kann und somit das Risiko einer schweren Immunreaktion sinkt. Nachdem man die so veränderten Viren in den Körper des Patienten injiziert hat, bauen sie die therapeutischen Gene in verschiedene Zellen und dort an verschiedenen Stellen ein. Wo dies geschieht, hängt vom Typ des Virus ab.
Sichere Gentransferverfahren waren oft nicht sehr effektiv, und effektive Methoden waren oft nicht sicher
Als Jesse Gelsinger sich Ende der 1990er Jahre entschloss, an einer klinischen Gentherapiestudie teilzunehmen, setzten die Forscher hauptsächlich auf Adenoviren als Genfähren. Normalerweise verursachen diese Partikel harmlose Infektionen der oberen Atemwege. Wissenschaftler von der University of Pennsylvania kamen zu dem Schluss, den größten Erfolg verspreche das Injizieren der Viren in die Leber – eben dorthin, wo spezialisierte Zellen normalerweise jenes Stoffwechselenzym produzieren, das Gelsinger fehlte. Die Forscher verpackten intakte Gene, die den Bauplan für dieses Enzym enthalten, in modifizierte Adenoviren. Dann injizierten sie etwa eine Billion der so hergestellten Viren in Gelsingers Leber.
Daraufhin geschah etwas Unvorhergesehenes. Die Viren infizierten nicht nur Leberzellen, sondern auch Makrophagen und dendritische Zellen. Makrophagen sind große bewegliche Abwehrzellen, die als Wächter des Immunsystems fungieren; dendritische Zellen melden dem Körper das Eindringen von Krankheitserregern. Gelsingers Immunsystem reagierte darauf, indem es sämtliche infizierten Zellen vernichtete, was verheerende Schäden im gesamten Organismus anrichtete.
Mit dieser Reaktion wussten die Mediziner nicht umzugehen. Bei keinem der 17 Studienteilnehmer, die an derselben Erkrankung litten und sich der gleichen Behandlung unterzogen hatten, waren so schwere Nebenwirkungen aufgetreten. Den Forschern war bewusst gewesen, dass Adenoviren Immunreaktionen auslösen, doch nicht, dass diese so extrem ausfallen können. In einer der vorangegangenen Tierstudien hatte es einen Affen gegeben, der an der Behandlung starb – allerdings war das Tier mit einem anderen Virenkonstrukt behandelt worden als Gelsinger. "Menschen unterscheiden sich untereinander viel stärker als Versuchstiere", erläutert James Wilson von der University of Pennsylvania. Er hatte das virale Gentransfersystem entwickelt, das bei Jesse Gelsinger und anderen Studienteilnehmern eingesetzt worden war. In der Rückschau betrachtet wäre es wohl klüger gewesen, dem Patienten zunächst nur einige Milliarden Viruspartikel zu injizieren statt einer Billion, ergänzt der Mediziner.
Die Ärzte wurden auch dafür kritisiert, dass sie Gelsinger und seine Familie nicht über den Tod des Affen in der vorausgegangenen Tierstudie aufgeklärt hatten. Dem Patienten und seinen Angehörigen wäre es so möglich gewesen, die mutmaßlichen Risiken der Behandlung besser informiert einzuschätzen.
Verhängnisvolle Nebenwirkungen
Der Tod Gelsingers war nicht das einzige tragische Ereignis in der Geschichte der Gentherapie. Kurz darauf führte die Behandlung eines anderen Krankheitsbilds, des Schweren kombinierten Immundefekts X1 (SCID-X1), bei 5 von 20 Kindern zum Ausbruch von Leukämie – in einem Fall mit tödlichem Ausgang. Wieder war es das virale Gentransportvehikel, das die Komplikationen verursachte. Es handelte sich allerdings nicht um ein Adenovirus, sondern um ein Retrovirus, das seine Genfracht direkt in die DNA der infizierten Zelle einbaut. An welchen Stellen innerhalb des Genoms das geschieht, ist nicht exakt vorhersagbar. Manchmal fügt das Retrovirus sein Erbgut in ein Onkogen ein, was unter bestimmten Umständen Krebs auslöst.
Angesichts der Tatsache, dass Adenoviren tödliche Immunreaktionen provozieren und Retroviren Krebs hervorrufen können, begannen sich die Forscher nach weniger riskanten Alternativen umzusehen. Bald schon konzentrierten sie sich auf zwei besonders viel versprechende virale Vektoren.
Adeno-assoziierte Viren (AAV) verursachen keine Krankheitssymptome, obwohl sich die meisten Menschen irgendwann damit infizieren. Wenn man sie als Genfähren einsetzt, ist das Risiko überschießender Immunreaktionen deshalb gering. Zudem treten sie in mehreren Varianten (Serotypen) auf, die jeweils bevorzugt bestimmte Zelltypen oder Gewebe befallen. AAV2 etwa favorisiert Zellen im Auge, AAV8 Leberzellen, und AAV9 infiziert Gewebe im Herzen oder im Gehirn. Diese Spezifität erlaubt es, denjenigen Serotyp für die Behandlung auszuwählen, der sich für das jeweils zu therapierende Organ am besten eignet. Von einer spezifisch wirkenden Virenvariante braucht man weniger Partikel, um den gewünschten Effekt zu erzielen, als von einem unspezifischen Serotyp. Das verringert das Risiko unbeherrschbarer Immunreaktionen und anderer gefährlicher Nebenwirkungen. Zudem platzieren AAV ihre Genfracht außerhalb der Chromosomen der Zielzelle – sie können also nicht ungewollt Onkogene aktivieren und so Krebs auslösen.
Adeno-assoziierte Viren wurden erstmals 1996 zur Gentherapie der Mukoviszidose eingesetzt. Seitdem haben Wissenschaftler insgesamt elf AAV-Serotypen identifiziert und aus Bestandteilen von deren Genomen hunderte Gentransfervehikel konstruiert, die offenkundig selektiv wirken und kaum Nebenwirkungen hervorrufen. Derzeit laufen klinische Studien darüber, ob Gentherapien auf Basis von AAV gegen Hirnkrankheiten wie Alzheimerdemenz und Morbus Parkinson helfen oder auch gegen Bluterkrankheit, Muskeldystrophie, Herzinsuffizienz und erblich erworbene Blindheit.
Bei dem zweiten alternativen Vektor handelt es sich erstaunlicherweise um HI-Viren, aus deren Genomen einige Teile entfernt wurden. In ihrer natürlichen Erscheinungsform können diese Viren Aids auslösen, doch abgewandelt eignen sie sich sehr gut für eine Gentherapie. Denn als Vertreter der Lentiviren entziehen sie sich den Angriffen des Immunsystems und – besonders wichtig – beeinflussen normalerweise nicht die Funktion von Onkogenen.
Wie bekommt man große Genladungen in die Zellen?
Wenn aus dem HIV-Genom jene Gene entfernt sind, die das Virus zu einem potenziellen Killer machen, werde die Virenhülle zu einem Gentransportvehikel "mit hoher Kapazität", sagt Stuart Naylor, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter des englischen Unternehmens Oxford Biomedica, das Medikamente auf Basis von Nukleinsäuren für die Behandlung von Augenerkrankungen entwickelt. Im Gegensatz zu den kleineren AAV seien modifizierte HIV sehr gut geeignet, um besonders große Gene oder mehrere Gene gleichzeitig in die Zielzelle einzuschleusen. Schädliche Nebenwirkungen oder unerwünschte Immunreaktionen träten dabei nicht auf. "Entkernte" Lentiviren kommen zurzeit in einer Reihe klinischer Studien zum Einsatz, unter anderem um Fettspeicherkrankheiten aus der Gruppe der Adrenoleukodystrophien zu behandeln. Bei einigen betroffenen Kindern, die eine solche Gentherapie erhielten, besserten sich die Krankheitssymptome so sehr, dass sie wieder die Schule besuchen konnten.
HI-Viren können in ihrer natürlichen Erscheinungsform Aids auslösen – doch abgewandelt eignen sie sich sehr gut für Gentherapien
Während also bereits klinische Studien mit AAV- und HIV-basierten Gentherapien laufen, gehen andere Forscher quasi einen Schritt zurück und modifizieren ältere virale Vektoren, so dass diese unter bestimmten Voraussetzungen wieder brauchbare Transportvehikel abgeben. Zum Beispiel lassen sich manche Retroviren genetisch so verändern, dass sie sich selbst inaktivieren, bevor sie eine Leukämie auslösen können.
Selbst Adenoviren, also Vertreter jenes Virentyps, der Gelsingers Tod verursachte, erleben in klinischen Studien ein Comeback als Genvehikel. Mediziner beschränken ihren Einsatz jedoch auf solche Körperregionen, wo es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einer Immunreaktion kommt.
Ein viel versprechender Anwendungsbereich ist die Xerostomie (Mundtrockenheit) bei Patienten, deren Speicheldrüsen durch Bestrahlung eines Tumors im Kopf-Hals-Bereich zerstört wurden. Die Nationalen Gesundheitsinstitute der USA führen zurzeit eine kleine Studie durch, in der Xerostomiepatienten eine Gentherapie erhalten, um in ihren Speicheldrüsen die Bildung von Wassertransportkanälen anzukurbeln. Da die Drüsen klein und klar abgegrenzt sind, reicht für die Behandlung eine 1000-fach niedrigere Virenmenge aus als jene, die Gelsinger erhielt. Das Risiko einer überschießenden Immunreaktion ist also viel geringer. Zudem dürften Viren, die ihre Zielzellen nicht infiziert haben, mit dem Speichel ausgespült und verschluckt oder ausgespuckt werden – sie haben daher kaum Gelegenheit, das Immunsystem zu irritieren. Seit dem Jahr 2006 haben elf Xerostomiepatienten diese Gentherapie erhalten, und bei sechs von ihnen verbesserte sich der Speichelfluss deutlich. Bruce Baum, Zahnarzt, Biochemiker und früherer Leiter der Studie, fühlt sich angesichts der Ergebnisse "vorsichtig optimistisch" gestimmt.
Ermutigt von diesen Erfolgen wagen sich medizinische Forscher jetzt auch über das Gebiet der Erbkrankheiten hinaus: Sie versuchen, Schäden im Erbgut zu reparieren, die im Lauf des Lebens erworben werden. So wollen Wissenschaftler von der University of Pennsylvania mit gentherapeutischen Methoden einen bei Kindern relativ häufigen Blutkrebs behandeln, die akute lymphatische Leukämie (ALL). Zwar sprechen die meisten betroffenen Kinder auf übliche Chemotherapien an, bei 20 Prozent der Patienten erweisen sich diese jedoch als unwirksam. Wissenschaftler versuchen daher, das Immunsystem der Kleinen genetisch so "aufzurüsten", dass es chemotherapieresistente Leukämiezellen aufspürt und abtötet.
Ein besonders komplexer Behandlungsansatz beruht auf so genannten chimären Antigenrezeptoren (CAR). Wie die Chimäre – jenes Sagenwesen aus der griechischen Mytholoie, das aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt ist – besteht auch ein künstlich hergestellter CAR aus verschiedenen Molekülen des Immunsystems, die natürlicherweise nicht zusammen auftreten. Werden bestimmte Zellen der Körperabwehr, so genannte T-Lymphozyten, über eine Gentherapie mit bestimmten CAR ausgestattet, dann verleiht ihnen das die Fähigkeit, charakteristische Proteine auf Leukämiezellen zu erkennen und die Zellen zu zerstören. Die ersten zehn Patienten, die mit dieser Methode behandelt wurden, waren chronisch leukämiekranke Erwachsene. Sie sprachen recht gut auf die Therapie an. Als Nächstes testeten die Mediziner das Verfahren an einem Kind – und hier übertrafen die Ergebnisse ihre kühnsten Hoffnungen.
Emily Whitehead war fünf Jahre alt, als Ärzte im Mai 2010 bei ihr eine Leukämieerkrankung feststellten. Das Kind wurde mit konventioneller Chemotherapie behandelt, allerdings ohne Erfolg. Im Frühjahr 2012 wendeten Mediziner bei ihr eine hochdosierte Chemotherapie an, "die einen Erwachsenen umgebracht hätte, und trotzdem litt sie immer noch an Tumoren in Leber, Milz und Nieren", berichtet Bruce Levine, einer von Emilys Ärzten. Alle Beteiligten mussten sich auf das Schlimmste einstellen: Das Mädchen, so viel schien klar, würde nur noch wenige Tage leben.
Rettung im letzten Moment
In dieser verzweifelten Situation entnahmen ihr die Ärzte eine Blutprobe und isolierten daraus T-Lymphozyten. Sie infizierten die Zellen mit künstlich modifizierten Lentiviren, die den genetischen Bauplan für einen bestimmten CAR enthielten, und gaben die veränderten Zellen der Patientin mittels Infusion zurück. Zunächst war kein Effekt erkennbar, aber dann besserte sich der Zustand des Mädchens in verblüffendem Tempo. Drei Wochen nach der Infusion war das therapeutische Gen bereits in jedem vierten T-Lymphozyten in Emilys Knochenmark nachweisbar. Die genetisch aufgerüsteten Immunzellen griffen die Krebszellen an und vernichteten sie. "Noch im April hatte Emily kein einziges Haar auf dem Kopf", erinnert sich Levine. "Kaum vier Monate später, im August, trat sie den Unterricht in der 2. Klasse an." Inzwischen zeigt das Mädchen keinerlei Anzeichen einer Leukämie mehr.
Die gentherapeutisch veränderten T-Lymphozyten werden vielleicht nicht dauerhaft in Emilys Körper bleiben, doch bei Bedarf können die Ärzte die Therapie wiederholen. Und Emily ist nicht die einzige Patientin, bei der es Erfolge zu vermelden gibt. Ende 2013 lagen Daten von mehr als 120 Leukämiepatienten vor, die mit einer CAR-Gentherapie behandelt worden waren. 5 von 19 Erwachsenen und 19 von 22 Kindern erreichten die komplette Remission, das heißt, sie sind derzeit symptomfrei.
Nachdem nun sichere virale Vektoren zur Verfügung stehen, wagen sich Gentherapeuten an die größte Hürde, die jede neue Therapieform nehmen muss: die Zulassung durch die Arzneimittelbehörde. Hierfür müssen sich die Behandlungsverfahren in klinischen Studien der Phase III bewähren, an denen große Patientengruppen teilnehmen und die ein bis fünf Jahre in Anspruch nehmen. Anfang 2014 hatten etwa 100 von insgesamt 2000 Gentherapieansätzen die klinische Phase III erreicht. Eine der am weitesten fortgeschrittenen Methoden ist die Behandlung der kongenitalen Leber-Amaurose, jener Krankheit, die Corey Haas seines Augenlichts beraubt hatte. Mehrere dutzend Patienten haben nach einer Gentherapie an beiden Augen ihr Sehvermögen wiedererlangt.
China war das erste Land, in dem eine Gentherapie gegen Kopf-Hals-Tumoren zugelassen wurde. Und im Jahr 2012 erteilte die Europäische Arzneimittel-Agentur die Zulassung für Glybera, eine Gentherapie zur Behandlung des familiären Lipoproteinlipase-Mangels. Dabei injizieren die Ärzte Adeno-assoziierte Viren mit funktionsfähigen Versionen des mutierten Gens in den Oberschenkel der Patienten. Das Unternehmen uniQure mit Sitz in den Niederlanden verhandelt derzeit mit der US-Arzneimittelbehörde über die Zulassung Glyberas in den USA. Die Kosten der Therapie sind mit mehr als einer Million Dollar pro Behandlungsdosis zwar noch außerordentlich hoch, dürften jedoch mit dem künftigen methodischen Fortschritt sinken.
Ähnlich wie bei anderen neuen Behandlungsverfahren war der jahrzehntelange Marsch hin zu erfolgreichen Gentherapien äußerst schwierig. Und er ist noch lange nicht beendet. Doch mit jedem weiteren erfolgreich behandelten Patienten rücken Gentherapien ein Stück weiter in den klinischen Alltag.
Schreiben Sie uns!
1 Beitrag anzeigen