Bisphenol A: Kunststoff mit Nebenwirkungen

Ein Spaziergang durch die Gänge eines Supermarkts offenbart den bescheidenen Erfolg für den Verbraucherschutz. In der Kleinkinderabteilung prangt auf Produkten wie Babyflaschen, auslaufsicheren Tassen und Miniaturbesteck aus Kunststoff die Aufschrift "BPA-frei" – anders als in vielen anderen Kunststoffen soll sich hierin nicht mehr die chemische Verbindung Bisphenol A befinden. Im Gang mit den Küchenutensilien steht eine Reihe von Mixern und Wasserflaschen ohne diese Chemikalie, und auch in der Abteilung mit Biolebensmitteln wird man fündig: Einige Konservendosen, gefüllt mit Bohnen, sollen diese Substanz nicht enthalten. Und hat man an der Kasse etwas Glück, ist sogar der Kaufbeleg BPA-frei.
Der teilweise Verzicht auf BPA ist das Ergebnis von zwei Jahrzehnten Forschung und Hunderten von Studien, in denen die Chemikalie – die das Sexualhormon Östrogen imitiert – mit einer Vielzahl von Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Nagern und Menschen in Zusammenhang gebracht wird. Dennoch glauben viele Verbraucher, dass Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff und anderen Materialien derzeit unbedenklich sind. Die Entscheidung von Aufsichtsbehörden in den USA und der Europäischen Union, BPA in Babyflaschen zu verbieten, trug sicherlich dazu bei, ebenso wie Marketingkampagnen der Industrie.
"Man verwendet diese Chemikalie an Stelle von BPA – und das ohne ausreichende toxikologische Daten"
Kyungho Choi
Doch man wiegt die Konsumenten fälschlich in Sicherheit. BPA ist nach wie vor Bestandteil vieler Lebensmittelverpackungen, insbesondere von Konservendosen. Und wenn Unternehmen auf BPA verzichten, setzen sie oft alternative Stoffe ein – wie das immer häufiger genutzte Bisphenol S (BPS) –, die sich sowohl bezüglich ihrer Chemie als auch der Bedenken wenig von BPA unterscheiden. "Man verwendet diese Chemikalie an Stelle von BPA – und das ohne ausreichende toxikologische Daten", sagt der Umwelttoxikologe Kyungho Choi von der Seoul National University. "Das ist ein Problem."
Schlechter Ruf
Seit den 1950er Jahren bildet BPA das chemische Rückgrat der meisten formstabilen, transparenten Polycarbonatkunststoffe. Die Chemikalie – die aus dem Plastik in Lebensmittel diffundieren kann – steht inzwischen im Verdacht, eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu haben, darunter verringerte Fruchtbarkeit und niedrigeres Geburtsgewicht, Fehlbildungen der männlichen Genitalien, veränderte Verhaltensentwicklung, Diabetes, Herzerkrankungen sowie Fettleibigkeit.

Eine eindeutige Verbindung zwischen einem chemischen Stoff wie BPA und der menschlichen Gesundheit herzustellen, ist alles andere als einfach. Das bestätigt auch Geoffrey Greene, der an der University of Chicago in Illinois Östrogene und deren Rezeptoren erforscht: "Die meisten Studien untersuchen lediglich, ob diese nachteiligen Auswirkungen in verschiedenen Zell- oder Tiermodellen auftreten können. Ob die Mengen, denen wir ausgesetzt sind, ausreichen, um die menschliche Gesundheit zu beeinflussen, bleibt offen." Weil sich viele der potenziellen Risiken von BPA für die Gesundheit schwer abschätzen lassen, startete das National Institute of Environmental Health Sciences im Research Triangle Park in North Carolina ein 30 Millionen US-Dollar teures Forschungsprogramm. In dessen Rahmen sollen die offenen Fragen geklärt werden.
Vor einigen Jahren bewegten die zunehmenden Belege sowie besorgte Verbraucher die Regierungen zum Handeln. 2011 verbot die Europäische Union BPA in Babyflaschen; die USA folgten dem Beispiel ein Jahr später. Doch in den meisten von innen beschichteten Lebensmittel- und Getränkedosen findet sich weiterhin BPA, ebenso wie in beschichteten Wasserleitungen in zahlreichen Ländern. Und auch Zahnversiegelungen und Brutkästen für Frühgeborene enthalten die Chemikalie.
Eine Alternative für BPA in Konserven- und Getränkedosen zu finden, erwies sich als besonders schwierig. Denn die Beschichtung müsste nicht nur preisgünstig sein, sondern sich auch für eine Reihe von Lebensmitteln eignen – von Bohnen über Tomaten bis hin zum scharfen Curry. Zudem soll der Kunststoffüberzug alle Bakterien und Pilze vom Lebensmittel fernhalten und die Dose gleichzeitig vor Korrosion durch den Inhalt schützen. Käme das Lebensmittel mit dem Metall in Berührung, kann der Geschmack leiden. "Wenn man den Leuten erzählt, ihr Lebensmittel sei unbedenklicher für die Gesundheit, obwohl es seltsam schmeckt – werden sie einem das abnehmen?", fragt sich Kunststoffingenieur Daniel Schmidt von der University of Massachusetts in Lowell.
Kein BPA-freier Kunststoff kann das leisten
Des Weiteren bevorzugen Hersteller meist Beschichtungen, die Schwefelverbindungen – die sich etwa in Proteinen, Konservierungsmitteln und Pestiziden finden – daran hindern, mit dem Metall zu reagieren und unansehnliche Eisen- oder Zinnsulfidflecken zu bilden. Bisher existiert kein BPA-freier Kunststoffüberzug, der all das leisten kann. "Man müsste für jede Art von Lebensmittel eine spezielle Dose und eine spezielle Beschichtung einsetzen", so Schmidt. "Das wird extrem umständlich und ziemlich teuer."
Auf BPA basierende Epoxidbeschichtungen werden gerne eingesetzt, weil sie solide, elastisch und kostengünstig sind. Sie vertragen die hohen Temperaturen, die nötig sind, um Lebensmittel während der Konservenfabrikation zu sterilisieren, und treten laut der North American Metal Packaging Alliance in Washington D.C. nicht in Wechselwirkung mit einem breiten Spektrum an Lebensmitteln und Getränken. Der Verband schätzt, dass 95 Prozent aller Beschichtungen in Aluminium- und Stahldosen auf Epoxidharzbasis hergestellt werden: mehr als 99,9 Prozent davon enthalten BPA.
Es gibt zwar Alternativen, doch nicht ohne Nachteile. Seit 1999 beschichtete die Firma Eden Organic aus Clinton, US-Bundesstaat Michigan, Konservendosen mit pflanzlichen so genannten Oleoresinen, weichen Harzen, besser als Balsame bekannt. Die Kosten für solche Dosen liegen um mehr als 20 Prozent höher. Beschichtungen auf Oleoresinbasis können zudem den Geschmack von Lebensmitteln verfälschen und werden leicht von sehr säurehaltigen Lebensmitteln – wie etwa Tomaten – angegriffen. Und gerade diese tendieren dazu, das BPA aus den Innenbeschichtungen zu lösen, berichtet der Biologe Frederick vom Saal von der University of Missouri-Columbia.
Einige japanische Hersteller verwenden inzwischen BPA-reduzierte Lacke, um ihre Dosen auszukleiden. Andere Beschichtungen bestehen aus Polyacrylaten, die für den Einsatz in Dosen allerdings zu spröde sind, sowie Vinylgruppen und Phenolen, die womöglich beide östrogene Wirkungen haben.
Erst allmählich tauchen neue Alternativen für Innenbeschichtungen von Dosen auf. Schmidt entwickelt beispielsweise ein Epoxid, das auf einem Molekül in Tritan – einem BPA-freien Polymer – basiert. Tritan wird von der Eastman Chemical Company in Kingsport, Tennessee, hergestellt und kommt in Babyflaschen zum Einsatz. Der Wissenschaftler hofft, dass sein Epoxid genauso vielseitig und kostengünstig sein wird wie BPA. "Die Gewinnmargen sind so winzig in dieser Branche", berichtet Schmidt. Bei der Beschichtung von Dosen könne sich deshalb nur etwas ändern, wenn jemand der Industrie einen gleichwertigen Ersatz präsentiert.
Anders als bei den Innenbeschichtungen von Dosen gestaltet es sich relativ einfach, BPA in Babyflaschen und Kassenzetteln zu ersetzen. Als BPA seinen schlechten Ruf bekam, griffen viele Hersteller auf eine verwandte Verbindung zurück: BPS. Ein BPA-Molekül besteht aus zwei Phenolgruppen verbunden durch eine Kohlenstoffgruppe. In einem BPS-Molekül werden die beiden Phenolgruppen stattdessen von einer Sulfongruppe (SO2) zusammengehalten. BPS wurde bereits 1869 erzeugt, zunächst als Farbstoff. Erst seit Kurzem kommen wir damit direkt in Kontakt – beispielsweise seit 2006 durch Kassenbons – und nur wenige Forscher haben die Toxizität dieser Chemikalie bisher untersucht. "Die wichtigste Frage, auf die wir bisher keine Antwort haben, lautet: 'Ist BPS genau so giftig wie BPA?'", sagt der Endokrinologe René Habert von der Université Paris Diderot.
Schlüssel und Schloss
Wegen seiner zu BPA ähnlichen Struktur steht auch BPS im Verdacht, wie ein Östrogen zu wirken, erklärt Cheryl Watson von der medizinischen Fakultät der University of Texas in Galveston. Natürliche Östrogene bestehen aus kleinen Molekülen, die mehrere Phenolringe enthalten; diese verfügen über chemische Anker, die an die Bindungstasche von Östrogenrezeptoren im Körper andocken können. BPA und BPS sind in etwa gleich groß und besitzen ebenfalls Phenolringe mit ähnlichen Anhängseln, erläutert die Biochemikerin, so dass sie womöglich wie ein Schlüssel in die Östrogenrezeptoren passen.
"Die Gewinnmargen sind so winzig in dieser Branche"
Daniel Schmidt
Watson und ihr Kollege Rene Viñas, jetzt an der US Food and Drug Administration, untersuchten die Reaktion von kultivierten Hypophysezellen einer Ratte auf BPS. Diese Zellen reagieren besonders empfindlich auf Östrogene und Östrogenimitate, so dass die Forscher noch BPS-Konzentrationen von 10-15 Mol pro Liter testen konnten. Selbst bei diesen extrem geringen Mengen, stellte das Team fest, löste BPS eine Enzymkaskade aus, die normalerweise durch das Östrogen Östradiol aktiviert wird – dieser Effekt lässt sich auch mit BPA beobachten. Als die Wissenschaftler zusätzlich echte Hormone hinzufügten und so einen Östradiolspiegel simulierten, wie er bei Frauen zu finden ist, schien BPS den Signalweg übermäßig anzuregen, legte ihn dadurch lahm und führte schließlich zum Zelltod. Genau solche Ergebnisse, sagt Watson, würde man typischerweise für ein Östrogenimitat erwarten: eine unpassende Aktivierung von Östrogenreaktionen, das Ausschalten der normalen Östrogensignalwege und schließlich der Zelltod.
Andere Forschergruppen wiesen ähnliche Effekte nach. Susanne Bremer und ihre Kollegen am Institute for Health and Consumer Protection – einem von der Europäischen Kommission finanzierten Forschungszentrum im italienischen Ispra – untersuchte BPS und BPA auf einer für Östrogen sensitiven menschlichen Zelllinie. Demnach verhalten sich die beiden Chemikalien wie Östrogene, doch Östradiol sei 100 000-fach wirksamer. Setzt man Zebrafische einer Konzentration von 0,5 Mikrogramm BPS pro Liter Wasser aus – das entspricht etwa einem Sechstel der höchsten in der Umwelt gemessenen Konzentration –, wiesen diese weniger Eier, mehr missgebildete Nachkommen sowie höhere Verhältnisse von Östrogen zu Testosteron auf als unbehandelte Zebrafische, so das Ergebnis von Choi und seinem Team. "Hohe Konzentrationen an BPS zeigen die gleiche Wirkung wie hohe Konzentrationen an BPA", berichtet Habert. Der Forscher hatte vorausgehende Versuche über die Wirkung von BPS auf fötale Hodenzellen von Mäusen und Menschen durchgeführt. "Bei niedrigen Konzentrationen ist die Wirkung nicht bekannt."
Welche Konzentration am ehesten die Aufnahme von BPS durch den Menschen widerspiegelt, ist unklar. Ein Team um Catherine Simoneau vom Institute for Health and Consumer Protection analysierte insgesamt 30 BPS-haltige Babyflaschen aus zwölf Ländern. Nach fünf Minuten in kochendem Wasser und zwei Stunden bei 70 Grad Celsius setzte keine der Flaschen nachweisbare Mengen an BPS frei. "Diese Materialien sind deutlich resistenter gegen einen hydrolytischen Abbau als Polycarbonat – das war einer der wesentlichen Pluspunkte", sagt Schmidt. "Von daher würde ich sie, was den Lebensmittelkontakt angeht, als unbedenklicher einstufen als Polycarbonat."
Doch BPS begegnet uns noch an vielen weiteren Stellen. Der analytische Chemiker Kurunthachalam Kannan vom New York State Department of Health in Albany und seine Kollegen entdeckten BPS in Kassenzetteln, Fluggepäckanhängern und Bordkarten – allesamt bestehen aus Thermopapier, das BPS als Farbentwickler enthält. Die Wissenschaftler fanden BPS auch in Produkten aus Recyclingpapier, darunter Pizzakartons und Lebensmittelbehälter. Die Forscher um Kannan nehmen an, dass die BPS-Mengen, die wir durchschnittlich pro Tag über die Haut aufnehmen, deutlich unter den Grenzwerten für eine toxische Wirkung liegen. Dennoch fordert Kannan weitere Studien, denn angesichts anderer Fundorte – etwa in Lebensmitteln – sei eine höhere Exposition durchaus möglich. Und Watson warnt, dass selbst geringe Dosen dieser östrogenähnlichen Substanzen möglicherweise Schwierigkeiten verursachen: "Sie sind bereits in winzigen Mengen wirksam. Das ist ein Problem. Wenn sich auch nur wenig herauslöst, kann das bereits reichen, um eine Wirkung zu erzielen."
Vor Gericht
Auf der Suche nach adäquatem Ersatz haben einige Hersteller der Bisphenolfamilie den Rücken zugekehrt. 2007 entwickelte die Eastman Chemical Company einen neuen hitzebeständigen, transparenten Kunststoff namens Tritan für Produkte, mit denen Kleinkinder in Berührung kommen wie etwa Babyflaschen. Seitdem ersetzt der BPA-freie Kunststoff das alte BPA-haltige Polycarbonat in zahlreichen Wasserflaschen, Lebensmittelbehältern und Kinderbechern. Eastman zufolge bestätigen Testergebnisse – erhoben durch Thomas Osimitz und seinen Kollegen vom Beratungsunternehmen Science Strategies in Charlottesville, US-Bundesstaat Virginia –, dass die Monomere im Tritan nicht an Östrogen- oder Androgenrezeptoren binden.
2011 berichtete George Bittner von der University of Texas in Austin, dass 92 Prozent der 102 im Handel erhältlichen Kunststoffprodukte Chemikalien mit östrogener Wirkung freisetzen. Darunter auch Kunststoffe, die als BPA-frei beworben wurden. Der Grund, so der Neurobiologe und Geschäftsführer der Firma CertiChem für chemische Analysen: Zusatzmittel in Kunststoffen wie Stabilisatoren und Schmierstoffe können auch an Östrogenrezeptoren binden, ebenso wie einige der Kunststoffmonomere selbst.
"Diese Chemikalien sind wirklich überall um uns herum"
Cheryl Watson
Von Eastman hergestellte Tritanharze waren unter jenen Polymeren, die in Bittners Analysen eine östrogene Wirkung zeigten. Als PlastiPure – eine Schwesterfirma von CertiChem – diese Ergebnisse in einer Broschüre veröffentlichte, klagte Eastman dagegen. Anwälte des Unternehmens behaupteten, der von CertiChem durchgeführte In-vitro-Test – an einer Zellkultur aus östrogenempfänglichen Brustkrebszellen – könnte eine östrogene Wirkung nicht eindeutig nachweisen. In einem Schreiben an den Herausgeber der Zeitschrift Food and Chemical Toxicology konterte Bittner, dass seine Experimente bis zu 200-mal sensitiver sind als diejenigen, mit denen Osimitz die Gefahrlosigkeit von Tritan demonstriere.
Bittner bekam Rückendeckung: Wade Welshons, der an der University of Missouri-Columbia Stoffe erforscht, die den Endokrinhaushalt stören, untersuchte unabhängig fünf Tritanflaschen mit dem gleichen Verfahren. Im Gerichtsprozess sagte Welshons aus, dass er in jedem Test eine nachweisbare östrogene Wirkung gefunden habe. Doch die Geschworenen entschieden zu Eastmans Gunsten und der Richter untersagte Bittner, PlastiPure und CertiChem, künftig Behauptungen über die östrogene Wirkung von Tritan aufzustellen.
Besorgnis erregende Mischung
Eastman hält an den Ergebnissen von Osimitz fest. Und im Gegensatz zu Bittner vermutet Welshons, dass die von ihm festgestellte östrogene Wirkung nicht auf das Tritanpolymer selbst zurückgeht. Verantwortlich seien stattdessen andere Verbindungen, die bei der Kunststoffproduktion hinzugegeben werden. Und nicht nur ihm bereiten die bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Chemikalienmixturen ernsthafte Sorgen. Im Jahr 2012 wurden weltweit rund 280 Millionen Tonnen Kunststoff erzeugt. Nach einer Schätzung, die auf dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen fußt, enthalten mehr als 50 Prozent dieser Kunststoffe Inhaltsstoffe, die schädlich sein können. Einige sind Krebs erregend; andere wirken wie Östrogene.
Wie viele dieser Chemikalien tatsächlich bedenklich sind – in den jeweils nachgewiesenen Konzentrationen im Kunststoff –, ist bislang noch nicht klar. Doch durch das Zusammenspiel der Stoffe könnten synergistische Wirkungen auftreten. Watson und Viñas untersuchten kürzlich die Wirkung der östrogenähnlichen Substanzen BPA, BPS und Nonylphenol (ein Vorläuferstoff für Tenside in Reinigungsmitteln) auf gezüchtete Hypophysezellen von Ratten. Ein Zusammenwirken von zwei oder drei der chemischen Verbindungen beeinträchtigte den Östrogensignalweg stärker – und bei niedrigeren Konzentrationen – als eine einzelne Substanz, so das Ergebnis. "Wir merken nichts von diesen Chemikalien, wenn sie allein auftreten", sagt Watson. "Viele andere Chemikalien imitieren ebenfalls Östrogene."
Im Idealfall, meint Watson, würde man die Auswirkungen der kommenden Chemikaliengeneration auf den Östrogensignalweg prüfen, bevor man sie in großem Umfang in Lebensmittelverpackungen einsetzt. Zu diesem Zweck entwickelte die Forscherin gemeinsam mit einigen Biologen und Chemikern ein Konzept namens TiPED oder Tiered Protocol for Endocrine Disruption. Neu synthetisierte Chemikalien sollen demnach in fünf verschiedenen Stufen auf ihr hormonaktives Potenzial getestet werden – angefangen mit Computeranalysen der Struktur bis hin zu Tierversuchen.
Das Ziel: Ein Verbund aus unabhängigen Laboren untersucht Chemikalien auf Anfrage von Kunststoffherstellern. Diese Unternehmen von einer Teilnahme zu überzeugen, räumt Watson ein, wird eine Herausforderung sein. Doch es gebe einen Anreiz, fährt die Biochemikerin fort. Denn sollte eine von den Firmen hergestellte oder verwendete Substanz als möglicherweise gesundheitsschädlich eingestuft werden, kann dies zu schlechter Presse, Umsatzverlusten und Klagen führen. "Wenn sich herausstellt, dass eine bestimmte Chemikalie problematisch ist", sagt Watson, "muss sich die gesamte Branche völlig umstellen." Mit Hilfe von TiPED sollen hormonaktive Stoffe den Markt künftig nicht mehr erreichen. Für Watson und viele andere Forscher ist die aktuelle Situation Besorgnis erregend, weil sich in unzähligen Kunststoffprodukten viele ungeprüfte Substanzen finden lassen. Diese Chemikalien, sagt sie, "sind wirklich überall um uns herum."



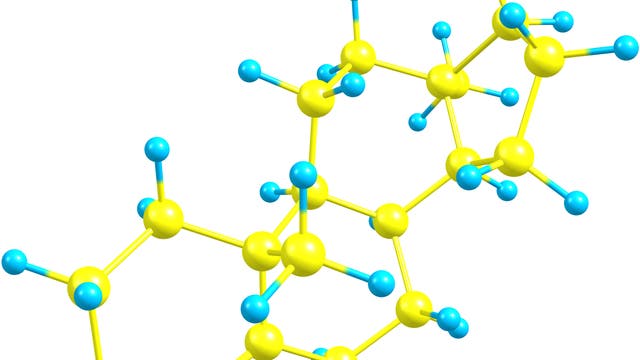


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben