Von Dauer ist nur der Wandel
Mit dem Untertitel seines Buchs, "Wie es mit fremden Tieren und Pflanzen gelingt, die Natur zu retten", lehnt sich der renommierte britische Umweltjournalist Fred Pearce weit aus dem Fenster und stellt sich gegen die Ansichten etablierter Naturschützer. Getreu dem Motto, Veränderung sei die einzige Konstante, stellt er eingefahrene Ansichten darüber auf den Prüfstand, was Naturschutz ist und wer oder was davon profitieren darf. Natur versus Kultur, heimisch gegen fremd, gut versus schlecht, ursprünglich gegenüber zivilisiert, Stadt im Gegensatz zu Land: Pearce beschreibt, wie wenig hilfreich diese Kategorisierungen sind, wenn man Biodiversität bewahren und fördern möchte. Seine Ausführungen verdeutlichen, dass es in der Natur kein Schwarz-Weiß gibt.
Im Zuge seiner Recherchen hat der Journalist unterschiedlichste Biotope aufgesucht. An ihrem Beispiel zeigt er, dass eingewanderte Arten – seien es Tier- oder Pflanzenspezies – nicht unbedingt negative Auswirkungen auf bereits vorhandene Lebensgemeinschaften haben müssen. So berichtet er von Invasionen, die zu einem Anstieg des Artenreichtums führten oder sogar gefährdete Arten vor dem Aussterben bewahrten. Der Gelbbrustara etwa, Ara ararauna, siedelte sich erfolgreich auf Puerto Rico an, starb aber in seiner Heimat Paraguay nahezu aus. Dass neu eingewanderte Arten auch für Menschen durchaus vorteilhaft sein können, zeigt er am Beispiel der Europäischen Honigbiene (Apis mellifera). Sie wurde im 17. Jahrhundert von britischen Siedlern in die USA eingeschleppt und ziert heute zwölf Wappen amerikanischer Bundesstaaten. Inzwischen umgetauft in Westliche Honigbiene, trägt sie jährlich mehrere Milliarden Dollar zur US-Wirtschaft bei.
Vermeintliche Unberührtheit
Pearce zufolge sind die Definitionen von "Wildnis" und "Ursprünglichkeit" veraltet und müssten abgeschafft beziehungsweise überarbeitet werden. Wie sie den Naturschutz prägen, untersucht er im zweiten Teil des Buchs. Auch hier bedient er sich diverser Beispiele, um zu belegen: Die vermeintliche Wildnis ist gar nicht so wild und ursprünglich, wie es oft scheint. Die Regenwälder des Amazonas etwa umfassten kaum noch Primärwald. Vielmehr handle es sich großteils um einen Flickenteppich verwilderter Gärten – Zeugen früherer Zivilisationen, die gezielt Landwirtschaft betrieben und Sekundärwälder anlegten. Zahlreiche archäologische Funde von Resten hoch entwickelter urbaner Gesellschaften belegten das.
Im dritten und letzten Teil des Werks stellt Pearce den so häufig rezitierten Abgesang auf die Natur in Frage. Ist die Zukunft wirklich so düster, wie Biodiversitäts- und Klimaforscher prophezeien? Lässt sich der Untergang aufhalten? Der Autor argumentiert, die Natur sei durchaus in der Lage, eine gewisse Toleranz gegenüber menschlichen Störungen zu entwickeln – freilich ohne damit einen Freifahrtschein für Umweltzerstörungen auszustellen. So lebten drei Viertel der noch existierenden Orang-Utans nicht in Primär-, sondern in Nutzwäldern. Manche Tier- und Pflanzenpopulationen beschränkten sich mittlerweile ausschließlich auf Städte. In Terminal 2 des Flughafens London-Heathrow beispielsweise gebe es seit mehreren Jahren eine Kolonie Hausspatzen, die sich von den Krümeln der Snackbars ernähre.
Plädoyer gegen Schwarzmalerei
Der Autor wirft einen optimistischen Blick in die Zukunft. Die Ökosysteme der Welt seien zu außerordentlichen Regenerationsleistungen fähig, wenn der Mensch sie nur lasse und die Einwanderung neuer Arten nicht immer als Bedrohung ansehe. Endemische Spezies könnten von invasiven mitunter durchaus profitieren, beispielsweise durch ein erweitertes Nahrungsangebot. Veränderung müsse deshalb nicht durchweg negativ sein. Neue Arten besetzen oft lediglich freie Nischen, wie Pearce plausibel zeigt.
Der Autor führt in seinen Ausführungen den traditionellen Naturschutz in vielerlei Hinsicht ad absurdum und zeigt, dass wir gerade in Zeiten des Klimawandels widerstandsfähige Arten brauchen, die sich auf veränderte Umweltbedingungen einstellen. Wir könnten es uns nicht leisten, schreibt er, an einem Status quo festzuhalten, der lediglich Momentaufnahme eines stetigen Wandels sei. Statt uns nur auf die Verlierer der (anthropogenen) Umweltveränderungen zu fokussieren, müssten wir uns auch den Gewinnern zuwenden, uns konstruktiv mit ihnen auseinandersetzen und ihren Wert erkennen. "Fremd" bedeute nicht zwangsläufig "gefährlich".
Pearces Ausführungen lesen sich wie ein Appell, verstaubte Ansichten über Bord zu werfen. Sie geben Denkanstöße und regen dazu an, die Vorteile zu sehen, wenn man Natur als offenes System begreift.


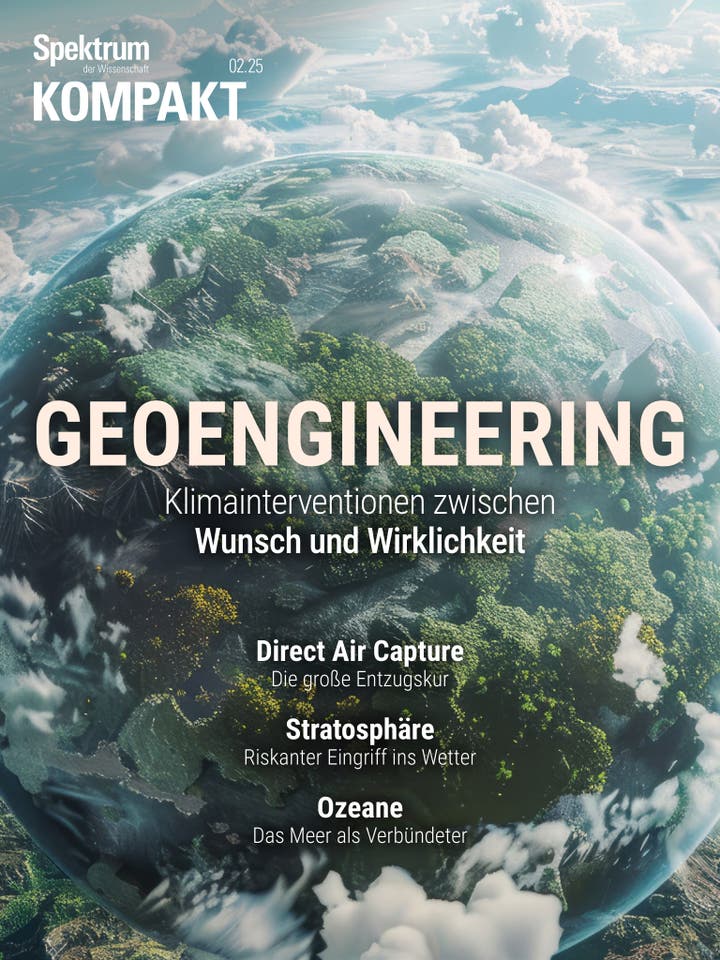



Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben