Login erforderlich
Dieser Artikel ist Abonnenten mit Zugriffsrechten für diese Ausgabe frei zugänglich.
Bioinformatik: Computer aus Biomolekülen
Eine Mischung aus DNA und Enzymen wirkt wie ein vollwertiger Rechner. Dieser molekulare Automat passt in eine lebende Zelle. Dort kann er Stoffe in seiner Umgebung erkennen, aus diesen Erkenntnissen Schlüsse ziehen und danach handeln.
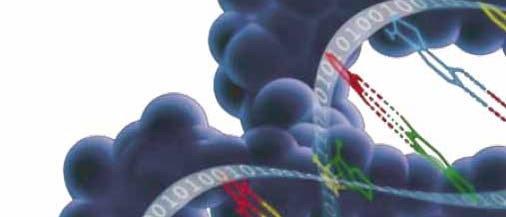
© (Ausschnitt)
Molekulare Turing-Maschinen
Ein paar genial konstruierte Biomoleküle, in eine Zelle gespritzt und dort sich selbst überlassen, wirken zusammen wie ein richtiger Computer.
Der britische Mathematiker Alan Turing (1912 – 1954) ist zu Recht berühmt als einer der Pioniere des Computers. Praktisch alle heutigen programmgesteuerten Rechner funktionieren nach den Prinzipien, zu denen er die theoretischen Grundlagen beigesteuert hat. Aber eine Turing-Maschine? Das ist zwar ein Computer, aber man kann praktisch nichts damit anfangen.
Das Gerät ist denkbar primitiv. Es besteht aus einem – beliebig langen – Band, auf dem eine Folge der Zeichen 0 und 1 steht. Irgendwo auf diesem Band sitzt ein Mechanismus, der eine begrenzte Zahl von inneren Zuständen annehmen kann. Er liest das unter ihm befindliche Zeichen; je nachdem, ob das eine Null oder Eins ist, und je nach seinem inneren Zustand ändert er das Zeichen – oder auch nicht –, geht in einen anderen inneren Zustand über – oder auch nicht – und rückt eine Stelle nach rechts oder links auf dem Band, wo dasselbe Spiel von vorne beginnt. Das ist alles.
Für die technische Realisierung bieten sich die verschiedensten Möglichkeiten an. Der Informatiker denkt vorrangig an ein Magnetband mit einem Lese- und Schreibkopf. Eine Reihe geeignet geformter Plastikklötzchen tut es auch. Die überraschende Neuigkeit: Es darf auch ein Strang der Erbsubstanz DNA sein.
DNA besteht nämlich aus einem Band von Einzelteilen ("Nukleotiden"), die sogar vier verschiedene Werte annehmen können. Dass das Band zu einer Doppelhelix verdrillt ist, tut nichts zur Sache. Die Arbeit einer Turing-Maschine besteht in diesem Fall darin, ein Nukleotid aus dem Strang herauszuschneiden, ein anderes an seiner Stelle einzufügen und einen Schritt auf dem Strang weiterzuwandern; und das können verschiedene Enzyme, die in der Natur an der DNA arbeiten, auch. Also könnte man einen Computer aus DNA und Enzymen bauen?
Im Prinzip ja. Eine Turing-Maschine ist nämlich ein universeller Computer. Unter einer "berechenbaren Funktion" verstehen die Informatiker "mit einer Turing-Maschine berechenbar", und das umfasst alles, was ein Computer kann. Andererseits wäre eine Turing-Maschine quälend langsam. Indem sie alles, was ein Computer tun soll, in die oben geschilderten Primitivakte zerlegt, braucht sie für die einfachsten Dinge eine Unzahl an Schritten.
Das aber muss nicht stören, wenn die Rechenaufgabe selbst sehr einfach ist. Dafür hätte eine molekulare Turing-Maschine einen unschätzbaren Vorteil: Sie könnte im Inneren einer menschlichen Körperzelle existieren. Die Daten, die sie verarbeitet (der "Input"), sind gewisse Substanzen, die sie in der Zelle selbst antrifft; ihr "Output" wäre ebenfalls molekularer Natur, beispielsweise ein Medikament, das der Computer genau dann freisetzt, wenn er anhand des Inputs die Zelle als erkrankt erkennt.
Das war die Idee des Software-Wissenschaftlers Ehud Shapiro vom Weizmann-Institut aus Rehovot (Israel). Gemeinsam mit seinem damaligen Doktoranden Yaakov Benenson machte er sich an die Realisierung – zuerst mit Plastikklötzchen, dann mit echter DNA. Wie bei wissenschaftlichen Projekten üblich, war das Ergebnis ganz anders als geplant – aber nicht weniger faszinierend (Spektrum der Wissenschaft, März 2007).
Es stellte sich nämlich heraus, dass es zwar für jede Einzeltätigkeit einer DNA-Turing-Maschine die richtigen Enzyme gibt, aber nicht für alle Tätigkeiten zusammen. Ersatzweise unternahmen es Shapiro und Benenson, eine noch einfachere Maschine in DNA zu realisieren, einen so genannten endlichen Automaten, und hatten Erfolg. Im Prinzip ist es möglich, in einem Strang von DNA eine Arbeitsanweisung niederzulegen. Die Maschine führt sie aus, während sie den DNA-Strang Stück für Stück abbaut; das letzte Reststück ist zugleich das Ergebnis der Berechnung und möglicherweise das zu verabreichende Medikament.
Bis man einen solchen molekularen Automaten wirklich einem Patienten injizieren kann, muss man sich natürlich noch gegen alle möglichen Fehlfunktionen absichern. Aber der entscheidende erste Schritt zu einem Computer ganz neuer Art ist getan.
Ein paar genial konstruierte Biomoleküle, in eine Zelle gespritzt und dort sich selbst überlassen, wirken zusammen wie ein richtiger Computer.
Der britische Mathematiker Alan Turing (1912 – 1954) ist zu Recht berühmt als einer der Pioniere des Computers. Praktisch alle heutigen programmgesteuerten Rechner funktionieren nach den Prinzipien, zu denen er die theoretischen Grundlagen beigesteuert hat. Aber eine Turing-Maschine? Das ist zwar ein Computer, aber man kann praktisch nichts damit anfangen.
Das Gerät ist denkbar primitiv. Es besteht aus einem – beliebig langen – Band, auf dem eine Folge der Zeichen 0 und 1 steht. Irgendwo auf diesem Band sitzt ein Mechanismus, der eine begrenzte Zahl von inneren Zuständen annehmen kann. Er liest das unter ihm befindliche Zeichen; je nachdem, ob das eine Null oder Eins ist, und je nach seinem inneren Zustand ändert er das Zeichen – oder auch nicht –, geht in einen anderen inneren Zustand über – oder auch nicht – und rückt eine Stelle nach rechts oder links auf dem Band, wo dasselbe Spiel von vorne beginnt. Das ist alles.
Für die technische Realisierung bieten sich die verschiedensten Möglichkeiten an. Der Informatiker denkt vorrangig an ein Magnetband mit einem Lese- und Schreibkopf. Eine Reihe geeignet geformter Plastikklötzchen tut es auch. Die überraschende Neuigkeit: Es darf auch ein Strang der Erbsubstanz DNA sein.
DNA besteht nämlich aus einem Band von Einzelteilen ("Nukleotiden"), die sogar vier verschiedene Werte annehmen können. Dass das Band zu einer Doppelhelix verdrillt ist, tut nichts zur Sache. Die Arbeit einer Turing-Maschine besteht in diesem Fall darin, ein Nukleotid aus dem Strang herauszuschneiden, ein anderes an seiner Stelle einzufügen und einen Schritt auf dem Strang weiterzuwandern; und das können verschiedene Enzyme, die in der Natur an der DNA arbeiten, auch. Also könnte man einen Computer aus DNA und Enzymen bauen?
Im Prinzip ja. Eine Turing-Maschine ist nämlich ein universeller Computer. Unter einer "berechenbaren Funktion" verstehen die Informatiker "mit einer Turing-Maschine berechenbar", und das umfasst alles, was ein Computer kann. Andererseits wäre eine Turing-Maschine quälend langsam. Indem sie alles, was ein Computer tun soll, in die oben geschilderten Primitivakte zerlegt, braucht sie für die einfachsten Dinge eine Unzahl an Schritten.
Das aber muss nicht stören, wenn die Rechenaufgabe selbst sehr einfach ist. Dafür hätte eine molekulare Turing-Maschine einen unschätzbaren Vorteil: Sie könnte im Inneren einer menschlichen Körperzelle existieren. Die Daten, die sie verarbeitet (der "Input"), sind gewisse Substanzen, die sie in der Zelle selbst antrifft; ihr "Output" wäre ebenfalls molekularer Natur, beispielsweise ein Medikament, das der Computer genau dann freisetzt, wenn er anhand des Inputs die Zelle als erkrankt erkennt.
Das war die Idee des Software-Wissenschaftlers Ehud Shapiro vom Weizmann-Institut aus Rehovot (Israel). Gemeinsam mit seinem damaligen Doktoranden Yaakov Benenson machte er sich an die Realisierung – zuerst mit Plastikklötzchen, dann mit echter DNA. Wie bei wissenschaftlichen Projekten üblich, war das Ergebnis ganz anders als geplant – aber nicht weniger faszinierend (Spektrum der Wissenschaft, März 2007).
Es stellte sich nämlich heraus, dass es zwar für jede Einzeltätigkeit einer DNA-Turing-Maschine die richtigen Enzyme gibt, aber nicht für alle Tätigkeiten zusammen. Ersatzweise unternahmen es Shapiro und Benenson, eine noch einfachere Maschine in DNA zu realisieren, einen so genannten endlichen Automaten, und hatten Erfolg. Im Prinzip ist es möglich, in einem Strang von DNA eine Arbeitsanweisung niederzulegen. Die Maschine führt sie aus, während sie den DNA-Strang Stück für Stück abbaut; das letzte Reststück ist zugleich das Ergebnis der Berechnung und möglicherweise das zu verabreichende Medikament.
Bis man einen solchen molekularen Automaten wirklich einem Patienten injizieren kann, muss man sich natürlich noch gegen alle möglichen Fehlfunktionen absichern. Aber der entscheidende erste Schritt zu einem Computer ganz neuer Art ist getan.
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben