Mai 1982: Krebsgene
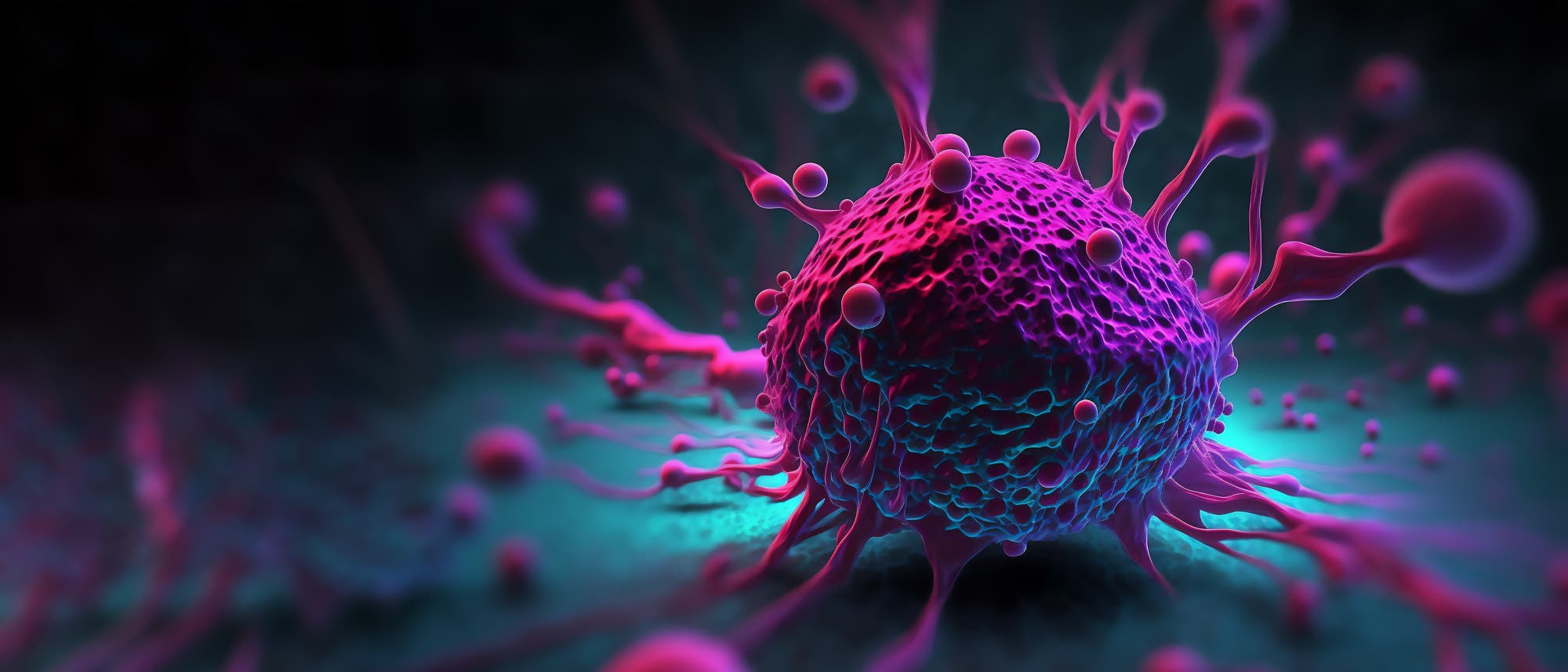
Kann man eigentlich verstehen, was in Krebszellen vor sich geht? Da man bis heute noch nicht einmal weiß, wie normale Zellen ihr Wachstum regulieren, mag der Glaube, die abnormen Regeln im Wachstum einer Krebszelle entschlüsseln zu können, geradezu vermessen erscheinen. Doch gibt es viele Beispiele in der Geschichte der Biologie, die zeigen, daß gerade das Studium von Abnormitäten Licht in normale Lebensprozesse brachte. Die jüngsten Entwicklungen in der Krebsforschung ergänzen die Geschichte nun um ein weiteres erregendes Beispiel. Zum ersten Mal lichtete sich ein wenig das Dunkel um die Vorgänge, die in normalen Zellen ein Krebswachstum induzieren können. So entdeckte man Enzyme, die solche Vorgänge katalysieren, und darüber hinaus die Gene, die jene Enzyme codieren.
Zu verdanken haben wir diese Fortschritte den Forschungen über tierische Tumorviren. Seit einigen Jahren sucht man geradezu besessen nach Viren, die beim Menschen Krebs verursachen können. Doch bislang mit wenig Erfolg, und so begannen viele Forscher zu zweifeln, ob solche Krankheitserreger bei menschlichen Krebsformen überhaupt eine größere Rolle spielen. Einige Viren erzeugen jedoch Tumoren in Tieren, und so versuchte man dort, die grundlegenden Prozesse zu klären, die in einer Krebszelle schieflaufen. Dieser Versuch hat sich nun endlich gelohnt.
Zwar wurden die Gene, die etwas mit der Entstehung von Krebs zu tun haben, zuerst in Viren entdeckt, doch gehören sie nicht zu deren Urinventar. Ja, sie sind nicht einmal eine Besonderheit von Tumorzellen; denn man trifft sie ebenso gut in normalen Zellen an. Möglicherweise sind diese Gene für das Leben einer solchen Zelle genauso notwendig, wie sie es für das ungezügelte Wachstum einer Krebszelle zu sein scheinen. Vielleicht hat man hier eine Station gefunden, von der aus alle Tumoren einen gemeinsamen Entwicklungsweg nehmen.
Tumorviren
Ein Virus ist kaum mehr als ein Bündel genetischer Information, verpackt in einer Eiweißhülle. Anders als in höheren Zellen kann hier das genetische Archiv nicht nur von Desoxyribonucleinsäure, sondern auch von Ribonucleinsäure verkörpert werden (international abgekürzt: DNA und RNA). Beide Molekülarten bestehen aus langen Strängen, die sich aus vier verschiedenen chemischen Grundbausteinen, den Nucleotiden, zusammensetzen. Die Reihenfolge dieser Nucleotide stellt eine verschlüsselte Botschaft dar, wobei die einzelnen Sätze jeweils dem entsprechen, was man so landläufig als Gen bezeichnet. Die dort codierten Anweisungen werden auf verschiedene Weise ausgeführt. Meist gibt die Nucleotidsequenz an, in welcher Reihenfolge Aminosäuren zu einem bestimmten Eiweißmolekül — beispielsweise einem Enzym oder einem Strukturprotein — zusammenzusetzen sind. Manche Viren kommen mit weniger als fünf Genen aus, aber selbst die verschwenderischsten beherbergen nicht mehr als ein paar hundert Gene. Die Zellen höherer Organismen dagegen haben ein Genom, also eine genetische Gesamtausstattung, aus Zehntausenden solcher Gene. Viren vermehren sich ähnlich wie Zellen, die wachsen und sich teilen. Weil aber Viren viel einfacher gebaut sind, lassen sie sich auch viel leichter untersuchen und verstehen als eine komplexe Zelle.
ln Zellen wird die DNA zuerst in einen Strang Boten-RNA abgeschrieben (transkribiert) und dann in Proteine übersetzt (translatiert). Ein Virus schiebt seine genetische Information einfach dieser Übersetzungsmaschinerie unter, so daß die infizierte Zelle zwangsläufig virale Proteine produziert. Einige davon vervielfältigen das virale Genom, andere lagern sich mit den Kopien zu neuen Viruspartikeln zusammen, und wieder andere führen irgendwelche Anweisungen der viralen Gene aus. In manchen Fällen enthalten die Anweisungen auch einen Befehl, der eine normale Wirtszelle zum Tumorwachstum veranlaßt.
Der Verdacht, daß Viren Tumoren verursachen können, wurde erstmals um die Jahrhundertwende geäußert. Im Jahre 1910 machte Peyton Rous vom Rockefeller Institut für Medizinische Forschung eine entscheidende Entdeckung: Zellfreie Extrakte bestimmter, bei Hühnern auftretender Tumoren — Sarkome genannt — konnten in anderen Hühnern neue Sarkome induzieren. Doch seine Berichte wurden schlecht aufgenommen, und wegen der Mißbilligung seiner Kollegen gab Rous schließlich seine Untersuchungen an Tumorviren auf. Erst Jahrzehnte später ließ sich die Existenz der von Rous vermuteten Viren — genauso wie die von anderen Tumorviren — zweifelsfrei beweisen: Neuartige physikalische Reinigungsverfahren und das Elektronenmikroskop machten es möglich. Die Krebsforschung stürzte sich auf die neuen Tumorviren, und heute gehören sie zum alltäglichen Handwerkszeug. Endlich wußte man auch Rous’ Arbeit zu würdigen: 1966 erhielt der damals schon Fünfundachtzigjährige den Nobelpreis.
Einige Tumorviren wirken nur in Tierarten onkogen (krebserregend), die gar nicht ihre natürlichen Wirte sind, andere dagegen tun dies nur in ihren normalen Wirten. Wie es zu diesem unterschiedlichen Verhalten kommt, ist erst teilweise geklärt, doch spielt das für Krebsforscher auch keine so große Rolle. Weitaus wichtiger erscheint ihnen, daß sie nun gezielt und mit ziemlich einfachen Mitteln reproduzierbare Tumoren erzeugen können. Daß man dabei manchmal auf merkwürdige Kombinationen von Wirt und Virus zurückgreifen muß, tut der Sache keinen Abbruch.
Transformation
Viele Tumorviren haben eine besonders wertvolle praktische Eigenschaft: Sie können auch in Zellen einer Gewebekultur deutlich sichtbare Veränderungen hervorrufen, die denen in Tumorzellen ähneln. Eine solche infizierte Kultur ermöglicht es, die Wechselwirkungen zwischen Tumorvirus und Wirtszellen unter kontrollierten Versuchsbedingungen zu studieren. Damit umgeht man alle Schwierigkeiten, die mit Tierexperimenten verbunden sind. Man sollte allerdings nicht vergessen, daß einige Tumorviren normale in Kultur gehaltene Zellen nicht umwandeln (transformieren), sich im Tierexperiment aber trotzdem als hochonkogen erweisen.
In der Fähigkeit oder Unfähigkeit eines Tumorvirus, kultivierte Zellen zu transformieren, spiegelt sich auch der Entstehungsverlauf der von ihm induzierten Tumoren wider. So zeigt sich bei der einen Gruppe von Viren ein einziges Gen für die tumorinduzierende Eigenschaft verantwortlich (bei manchen fand man auch mehrere solcher »Onkogene«). Da virale Krebsgene sehr dominant sind, gewinnen sie rasch über alle zelleigenen Gene die Oberhand. Die meisten, vielleicht sogar alle damit ausgestatteten Viren können auch Zellen einer Gewebekultur transformieren. Der Nachweis einer solchen Transformation ist daher fast schon ein Beweis, daß das geprüfte Virus ein Krebsgen enthält. Die andere Gruppe von Tumorviren besitzt keine speziellen Krebsgene und induziert Geschwülste auf subtilere Art und Weise. Solche Viren transformieren kultivierte Zellen nicht und arbeiten auch nur langsam. In vielen Fällen dauert es sechs bis zwölf Monate, bis ein Tumor sichtbar wird. Bei Viren mit Krebsgenen dagegen zeigt sich die Wirkung schon nach wenigen Tagen bis Wochen.
Charakteristisch für beide Wege der Tumorentstehung ist, daß das virale Genom in den Tumorzellen bis zu deren Tod überdauert (persistiert). In den meisten Fällen wird es der zellulären DNA eingepflanzt, so daß die viralen Gene völlig in die Chromosomen der Zelle integriert sind. Manchmal scheint das Genom eines Tumorvirus auch als selbständige Einheit (als eine Art Minichromosom) in den Zellen zu überleben, wo es sich dann unabhängig von den Zellchromosomen teilt und vermehrt. Anscheinend müssen die viralen Genome ständig vorhanden sein, damit ein Tumor wächst — entweder weil ein Krebsgen nur so einen dauernden Einfluß auf die Zelle aus iiben kann, oder weil nur so die weniger direkten Prozesse in Gang bleiben, die man bei Tumorviren ohne Krebsgene vermutet.
Die geheimnisvollen Vorgänge um die virusinduzierten Geschwülste haben gelegentlich die Hypothese von einem Auslösemechanismus aufkommen lassen. Danach soll eine vorübergehende Virusinfektion in den Zellen eine Reihe von Prozessen in Gang setzen, die letzten Endes zu einem Tumor führen, und zwar ohne daß von dem auslösenden Virus auch nur eine Spur Zurückbleiben müßte. Für diese Hypothese gibt es aber nun kaum eine Stütze mehr.
Retroviren
Das von Rous entdeckte Sarkomvirus gehört zu einer Familie, die als Retroviren bekannt ist. Ihre Mitglieder stellen die einzigen Tumorviren mit einem RNA-Genom dar. Retroviren haben uns den bisher umfassendsten Einblick in die Tumorentstehung gewährt. Drei ihrer Eigenschaften erwiesen sich dabei als besonders nützlich. Erstens kommen Retroviren in sehr vielen Arten von Wirbeltieren vor, wo sie verschiedenartige Tumortypen induzieren, die experimentelle Modelle für viele menschliche Krebsarten liefern. Zweitens lassen sich nicht nur die Krebsgene der Retroviren, sondern auch deren Produkte relativ einfach identifizieren und isolieren. Daher haben Retroviren uns den ersten Einblick in jene chemischen Prozesse erlaubt, die mit dem Krebswachstum einhergehen. Drittens finden sich Krebsgene von Retroviren nicht nur als natürliche Bestandteile des viralen Genoms. Es sieht vielmehr so aus, als seien sie Kopien von bestimmten Genen der Wirbeltierart, in der die Retroviren sich vermehren. Grund genug anzunehmen, daß diese zellulären Gene, von denen die Krebsgene der Retroviren offensichtlich abstammen, etwas mit der Tumorinduktion durch nicht-virale Agentien zu tun haben. So sind die Virologen in ihrem Bemühen, dem Ursprung der Krebsgene auf die Spur zu kommen, auf genetische Mechanismen gestoßen, die wahrscheinlich vielen Krebsarten zugrunde liegen.
Retroviren leiten ihren Namen aus einem einzigartigen Vorgang während ihres Lebenszyklus ab: ihre RNA muß nämlich erst in DNA »zurückgeschrieben« werden, damit eine Vermehrung stattfinden kann. Dieser ungewöhnliche Prozeß vollzieht sich durch ein Enzym namens reverse Transkriptase. Es wurde im Jahre 1970 von David Baltimore vom Massachusetts Institut für Technologie sowie Satoshi Mizutani und Howard M. Temin von der Universität Wisconsin in Partikeln wie dem Rous-Sarkom-Virus entdeckt. Eine sensationelle Entdeckung, und das in mehrerer Hinsicht. Sie erschütterte den bis dahin allgemein verbreiteten Glauben an das sogenannte »zentrale Dogma der Molekularbiologie«, nämlich daß die genetische Information immer von der DNA zur RNA fließt. Gleichzeitig führte die Entdeckung zu einer Flut wissenschaftlicher Untersuchungen über Retroviren, weil man nun plötzlich verstand, wie sich diese Art Viren vermehrt. Und nicht zuletzt bot die reverse Transkriptase ein entscheidendes Hilfsmittel für die sich gerade entwickelnde Technologie der Genchirurgie.
Der Lebenszyklus eines Retrovirus ist ein Wunder an Zusammenarbeit zwischen Parasit und Wirtszelle. Der Erfolg einer Infektion beruht auf der großzügigen Gastfreundschaft der Zelle, und doch behält das Virus die ablaufenden Ereignisse weitgehend unter Kontrolle. In den ersten Stunden der Infektion wird die virale RNA durch die reverse Transkriptase in DNA umgeschrieben. Anschließend erfolgt die Integration dieser DNA in das Genom der Wirtszelle. Dadurch werden nicht nur die viralen Gene zusammen mit den zellulären Genen vermehrt, sondern auch ihre Anweisungen gehorsam von der zelleigenen Synthesemaschinerie ausgeführt.
In den meisten Fällen ist ein Befall mit Retroviren für die Zelle harmlos. Sie bietet dem Virus eine neue und vielleicht dauerhafte Heimat, produziert neue Viruspartikel und läßt diese schließlich auswandern — und das alles, ohne einen Schaden zu erleiden. Eine Tumorinduktion läßt jedoch die Partnerschaft zerbrechen. Falls der Gast ein Krebsgen besitzt, vermag dessen Aktivität die Zelle zu unkontrollierter Vermehrung zu zwingen. Und falls er keines besitzt, kann alleine schon die Integration seiner DNA solche Folgen haben — nämlich dann, wenn sich die eingebaute DNA störend auf das sie einschließende oder benachbarte Gen auswirkt. Anders ausgedrückt: Der Einbau kann eine Mutation in den Genen der Wirtszelle verursachen, und wenn dies an bestimmten Stellen geschieht, wird möglicherweise ein Tumorwachstum ausgelöst. Die Induktion durch ein Krebsgen und die durch einen ungünstigen Einbau erscheinen zwar auf den ersten Blick wie zwei völlig verschiedene Ereignisse, doch werde ich im folgenden zeigen, daß beide engstens miteinander verknüpft sind.
Das src-Gen
Das Krebsgen des Rous-Sarkom-Virus war das erste in der Reihe, daß sich einer experimentellen Analyse erschloß. Den entscheidenden Anfang machte 1970 G. Steven Martin an der Universität von Kalifornien in Berkeley, als er temperaturempfindliche »konditionelle« Virusmutanten isolierte, die je nach Versuchsbedingungen Zellen einer Gewebekultur nicht mehr transformieren konnten. Eine konditionelle Mutation ist ein hervorragendes Werkzeug in der Hand des Experimentators, weil sich mit ihr das betroffene Gen reversibel inaktivieren läßt. Infiziert man kultivierte Zellen mit einer solchen temperatursensitiven Mutante des Rous-Sarkom-Virus und hält sie bei der »zulassenden« (permissiven) Temperatur, so werden sie transformiert. Steigert man die Wärmezufuhr bis zur »beschränkenden« (restriktiven) Temperatur, so gewinnen die transformierten Zellen innerhalb von Stunden ihr ursprüngliches normales Aussehen zurück. Sie werden nur wieder umgewandelt, wenn man die Temperatur senkt. Da man davon ausgeht, daß die restriktive Temperatur ein temperatursensitives Gen inaktiviert, muß der transformierte Zustand das Ergebnis eines kontinuierlich arbeitenden Gens sein. Wahrscheinlich wirkt sich die erhöhte Temperatur nicht direkt auf das mutierte Gen aus, sondern vielmehr auf dessen nun strukturell verändertes Produkt (ein Protein), das dann durch ein Zuviel an Wärme erheblich in seiner Aktivität beeinträchtigt werden kann.
Das Gen, von dem Martin einen ersten flüchtigen Blick erhaschte, trägt heute die Bezeichnung src (nach Sarkom, der von ihm induzierten Tumorform). Es ist das Krebsgen des Rous-Sarkom-Virus.
Bald bekam man es besser in den Griff, als Peter H. Duesberg in Berkeley sowie Charles Weissmann, Martin Billeter und John M. Coffin von der Universität Zürich mit Stämmen des Rous-Sarkom-Virus arbeiteten, die Peter K. Vogt von der Universität in Southern California isoliert hatte. Diese Stämme waren sogenannte Deletionsmutanten, die ihr Krebsgen verloren hatten. Sie konnten daher keine Tumoren mehr induzieren oder Zellen transformieren. Duesberg und Weissmann mit seinen Kollegen zerlegten die Genome der Deletionsmutanten und des krebserregenden Wildtyps mit Hilfe des Enzyms Ribonuclease in kleine Abschnitte. Als sie dann wußten, welches Fragment nur im Wildtyp vorhanden war, konnten sie auch die Position des daraufliegenden Krebsgens bestimmen. Es saß dicht an einem Ende des Virusgenoms.
In den letzten Jahren nutzte man die neuen wirkungsvollen Techniken der Gentechnologie, um Krebsgene und deren krebserregende Eigenschaften genauer zu untersuchen. So erlaubt es eine ganze Batterie von Enzymen — die Restriktionsendonucleasen — jede DNA an dafür spezifischen Stellen zu zerschneiden. Mit einer ganzen Reihe von Tricks kann man die einzelnen DNA-Fragmente in Bakterien einschmuggeln und dort vermehren (klonieren). Die daraus reisolierte DNA läßt sich dann in die Zellen einer Gewebekultur übertragen, wo sie ihr Genprodukt erzeugt. Nach der gleichen Methode kann man die aus der RNA abgeschriebene virale DNA in kleine, nur ein einziges Gen tragende Stücke zerlegen und herausbekommen, welche davon eigentlich eine Transformation verursachen. Beim Rous-Sarkom-Virus ist — wie die Analysen zeigen — für die Transformation ein Gen verantwortlich, das für ein bestimmtes Protein codiert. Daraus folgt, daß ein einziges Gen, das die Synthese eines einzigen Proteins veranlaßt, die für Krebszellen charakteristische Veränderungen hervorbringen kann. Dieses Protein und seine Wirkungsweise zu kennen, heißt auch besser die Vorgänge zu verstehen, die einen bösartigen Tumor.
Daß heute das Protein des src-Gens bekannt ist, verdanken wir vor allem Raymond L. Erikson und dessen Kollegen von der Medizinischen Hochschule der Colorado-Universität. Sie suchten zunächst nach einem Protein, das im Reagenzglas nur vom Genom des Wildtyps, aber nicht von dem der Deletionsmutante gebildet wird. Dann induzierten sie mit normalen Rous-Sarkom-Viren Geschwülste in Kaninchen, die daraufhin Antikörper gegen das vermutete sre- Protein produzierten. Diese Antikörper reagierten spezifisch mit dem im Reagenzglas gefundenen Protein und außerdem mit einem identischen Protein aus Zellkulturen, die man mit dem src-Gen transformiert hatte. Alles in allem eine überzeugende Identifizierung des Proteins, das vom src-Gen codiert wird. Es erhielt die Bezeichnung pp60v-src. Das »pp« soll andeuten, daß es sich um ein Phosphoprotein handelt, also um ein Eiweißmolekül. an dem Phosphatgruppen hängen. Die »60« bezieht sich auf das Molekulargewicht von 60.000, und das »v-sre« kennzeichnet die genetische Herkunft — also das virale src-Gen.
Ein Krebsenzym
Wie bringt aber nun das Proteinprodukt des src-Gens eine Zelle dazu, krebsartig zu wachsen? Zu der Zeit, als das Protein isoliert wurde, schien dies eine entmutigende, schwierige Frage zu sein. Aber eine erste Antwort kam unerwartet schnell, als man entdeckte, dass pp60v-src als Proteinkinase arbeitet. Solche Kinasen sind Enzyme, die Phosphat-Ionen an die Aminosäuren eines Eiweißmoleküls heften – ein Vorgang den man Phosphorylierung nennt. Die Entdecker waren Erikson und sein Kollege Mark S. Collett sowie — unabhängig von ihnen — Arthur Levinson, der mit Harold E. Varmus und mir in unserem Laboratorium an der Medizinischen Hochschule von Kalifornien arbeitete. Bald darauf berichteten Tony Hunter und Bartholomew M. Sefton vom Salk Institut für Biologie, daß pp60v-src spezifisch die Aminosäure Tyrosin phosphoryliert. Damit unterschied sich das Enzym von allen bis dahin bekannten Kinasen, die Phosphat-Ionen an die Aminosäuren Serin und Threonin hängen. Inzwischen stellte sich heraus, daß die Phosphorylierung von Tyrosin eine charakteristische Eigenschaft der von Krebsgenen codierten Enzyme ist und überraschenderweise auch bei der Wachstumsregulation einer normalen Zelle eine Rolle spielt.
Noch vor wenigen Jahren hielten die meisten Biologen Phosphat für eine Allerweltssubstanz und die Phosphorylierung von Proteinen für einen unbedeutenden Vorgang. Heute weiß man, daß dieser Prozeß eine der zentralen Möglichkeiten darstellt, die Aktivitäten von wachsenden Zellen zu steuern. Ein einziges Enzym vermag, indem es eine Reihe von anderen Proteinen phosphoryliert, die Vorgänge in einer Zelle dramatisch zu beeinflussen.
Für pp60v-src schlug man zwei verschiedene Wirkungsmöglichkeiten vor. So könnte das Enzym ein einziges Protein phosphorylieren und dadurch eine ganze Kaskade von Folgereaktionen auslösen, die dann alle zusammen der Zelle die Eigenschaften einer Krebszelle verleihen. Es könnte aber auch etliche verschiedene Proteine der Prozedur unterwerfen und damit direkt deren Funktionen beeinflussen. Möglicherweise bringt dies wiederum Sekundärereignisse oder sogar regelrechte Reaktionslawinen ins Rollen. Das wenige, was man bis heute über pp60v-src weiß, läßt die zweite Möglichkeit richtiger erscheinen.
Kann die Phosphorylierung von Tyrosinen zellulärer Proteine erklären, warum das src-Gen fähig ist, Tumoren zu induzieren? Hunter und seine Kollegen stellten fest, daß die Menge phosphorylierter Tyrosinreste nach der Transformation durch das src-Gen etwa um das Zehnfache steigt. Sie führten das auf die Tätigkeit von pp60v-scr zurück. Kernfrage ist jetzt, welche zellulären Proteine eigentlich durch das Enzym phosphoryliert werden und welche Aufgaben sie in der Zelle haben. Bisher gibt es nur wenige Anhaltspunkte, doch keiner kann das vom src-Gen induzierte ungehemmte Wachstum erklären. Die Jagd nach den Angriffszielen von pp60v-src ist in vielen Laboratorien in vollem Gang.
Die Angriffsziele von pp60v-src
Eine Möglichkeit, der Sache näher zu kommen, ist nachzuschauen, wo in den Zellen pp60v-src sich eigentlich aufhält. Ältere Untersuchungen ließen vermuten, daß sich die Produkte der viralen Krebsgene im Zellkern sammeln. Dort könnten sie direkt in die für die DNA- Vermehrung zuständige Maschinerie eingreifcn und so die Zelle zum Wachstum antreiben. Experimente von Hartmut Beug und Thomas Graf am Max-PlanckInstitut für Virusforschung in Tübingen zeigten jedoch, daß die Wirkungen des src-Proteins auch noch einige Zeit in Zellen erkennbar sind, deren Kerne entfernt wurden. So überraschte es auch niemanden mehr, als mehrere Arbeitsgruppen dann keine oder nur geringe Spuren von pp60v-src im Zellkern transformierter Zellen fanden. Im Gegenteil, pp60v-scr saß sogar ganz weit außen und war hauptsächlich an die Plasmamembran gebunden, also an jene dünne Haut, die jede Zelle umschließt und den Kontakt zur Außenwelt übernimmt. Viele Zellbiologen vermuten, daß die Kontrolle des Zellwachstums etwas mit der Plasmamembran und den damit verbundenen Strukturen zu tun hat.
Eine genaue Untersuchung der Plasmamembran von src-transformierten Zellen lieferte den ersten Beweis, daß der Angriff von pp60v-src auf ein spezifisches zelluläres Protein mit einer der typischen strukturellen und funktionellen Veränderungen einhergeht, wie sie in Krebszellen zu beobachten sind. Mit Hilfe einer speziellen photomikroskopischen Technik gelang es Larry R. Rohrschneider vom Fred Hutchinson Krebszentrum in Seattle nachzuweisen, daß sich in Tumorzellen das pp60v-src Protein an den sogenannten Adhäsionsplaques versammelt. Mit diesen Stellen kann sich die Zellmembran an eine feste Unterlage heften. Nun haften aber Krebszellen schlechter aneinander, weil ihre Membranstellcn sich auflösen. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, daß sich die meisten Krebszellen so leicht aus ihrem Zellverband lösen und an entfernteren Stellen Metastasen bilden.
Denkbar war, daß pp60v-src ein oder mehrere Proteine in den Adhäsionsplaques phosphorylieren und so deren Funktion stören kann. Tatsächlich fanden Sefton und S. J. Singer an der Universität von Kalifornien in San Diego, daß pp60v-src einen Tyrosinrest im Vinculin phosphoryliert — einem Protein, das normalerweise in den Haftstellen vorkommt, aber nach der Transformation durch sre über die gesamte Zelle verteilt ist. Man darf also mit gutem Grund annehmen, daß die Phosphorylierung von Vinculin die Zerstörung der Adhäsionsplaques heraufbeschwört. Doch was dies mit dem regelwidrigen Verhalten einer Krebszelle zu tun hat, bleibt noch offen.
Früher glaubte man, daß die krebserregende Eigenschaft von Viren sozusagen eine Nebenerscheinung jener Gene darstellt, die »hauptberuflich« mithelfen, neue Viruspartikel zu produzieren. Heute weiß man jedoch, daß die Vermehrung von Retroviren auch ohne Krebsgene vonstatten gehen kann. Wie läßt sich dann aber erklären, warum Krebsgene fast schon zur Grundausstattung von Retroviren gehören und offensichtlich im Verlauf der Evolution nicht ausgesondert wurden? Nach einem Jahrzehnt Forschungsarbeit kam nun die überraschende Antwort: Die Krebsgene der Retroviren sind gewissermaßen verkleidete zelluläre Gene, ehemals blinde Passagiere, die in den Tieren aufgelesen wurden, in denen sich die Retroviren gewöhnlich vermehren. Die Entdeckung, daß auch normale Zellen eigene Krebsgene besitzen, reicht in ihrer Bedeutung weit über die Tumorvirologie hinaus.
Die Herkunft der viralen Krebsgene
Doch zurück ins Jahr 1972. Damals machten Dominique Stehclin, Varmus und ich uns daran, die von Robert J. Huebner und George J. Todaro am Nationalen Krebsinstitut aufgestellten »Krebsgen-Hypothesen« zu prüfen. Beide hatten nach einem allgemeingültigen Mechanismus gesucht, mit dem sich die karzinogene Wirkung vieler verschiedener Agentien erklären ließ. Ihre Hypothese war nun, daß die Krebsgene der Retroviren zum genetischen Gepäck aller Zellen gehören – möglicherweise als Überbleibsel einer weit in der Evolutionsgeschichte zurückliegenden Virusinfektion. Solange diese Gene stillhalten, erscheint alles völlig harmlos. Werden sie aber durch karzinogene Substanzen stimuliert, können sie die Zellen zu einem krebsartigen Wachstum zwingen. Wenn die Hypothese richtig ist, müßte es — so dachten wir — gelingen, das src-Gen auch in normalen Zellen nachzuweisen.
Nun umfaßt die DNA einer Wirbeltierzelle aber Zehntausende verschiedener Gene. Um aus einem solchen Heuhaufen die Stecknadel — sprich das src- Gen herauszufinden, bediente sich Stehelin eines Tricks. Er stellte sich eine radioaktiv markierte DNA-Kopie des src- Gens her. Das war die Sonde, die ihm bei der Suche nach src-ähnlichen Genen in der zellulären DNA helfen sollte. Die Technik, die Stehelin dabei anwandte, nennt man molekulare Hybridisierung. Sie beruht auf der Fähigkeit eines Nucleinsäurestrangs, mit einem anderen passenden einen Doppelstrang bilden zu können. Unter geeigneten Bedingungen reicht als Gegenstück auch ein etwas weniger paßgenauer Strang. Stehelin mischte nun die einzelsträngige virale Genkopie mit gleichfalls einzelsträngiger DNA aus Zellen von gesunden Hühnern oder anderen Vögeln. Zu unserer freudigen Überraschung fand er tatsächlich hybride (gemischte) Doppelstränge aus Virus-und Vogel-DNA — ein sicherer Beweis, daß es in normalen Vogelzellen Gene gab, die mit dem src- Gen verwandt waren. Schließlich wies Deborah H. Spector, ein neues Mitglied unserer Arbeitsgruppe, das gleiche für Säuger (Menschen nicht ausgenommen) und Fische nach. Daraus schlossen wir, daß src-ähnliche Gene wohl in allen Wirbeltieren Vorkommen. Die Krebsgen- Hypothese von Huebner-Todaro schien sich also zu bewahrheiten.
Als wir aber das Gegenstück des viralen Krebsgens genauer untersuchten, zeigte sich, daß dieses überhaupt kein Retrovirus-Gen, sondern ein typisches zelluläres Gen war. Heute trägt es die Bezeichnung c-src (nach dem Englischen cell für Zelle). Den zwingendsten Beweis lieferten strukturelle Unterschiede. C-src zählt nämlich zu den sogenannten Mosaikgenen, bei denen die proteincodierenden Bereiche (die Exons) durch andere dazwischengefügte Bereiche (die Introns) getrennt sind. Ein solcher Aufbau gilt als typisch für die Gene tierischer Zellen, aber in Retroviren wurde er noch nie beobachtet. Von den Introns einmal abgesehen, sind jedoch alle Versionen von c-src —gleichgültig ob aus Fischen, Vögeln oder Säugern — eng mit dem viralen Gen v-src verwandt. Augenscheinlich hat sich das src-Gen der Wirbeltiere im Laufe der Evolution nur sehr wenig verändert, muß also für das Wohlbefinden der damit ausgestatteten Arten entscheidend sein.
Die Sache wurde noch rätselhafter, als wir entdeckten, daß dieses Gen nicht nur in normalen Zellen vorkommt, sondern dort auch aktiv ist. Es wird in Boten-RNA abgeschrieben und in ein Protein übersetzt. Die RNA ließ sich durch Hybridisierung mit der bereits zuvor benutzten radioaktiven Genkopie sowohl in Vögel als auch in Säugerzellen nach-weisen. Das vom zellulären src-Gen gebildete Protein war jedoch weniger gut zu erfassen, vor allem weil es die meisten Zellen nur in sehr geringen Mengen erzeugten. Der Erfolg trat erst ein, als wir und andere mit Hilfe jener Antikörper nach dem zellulären Protein forschten, mit denen sich das virale Protein pp60v-src hatte aufspüren lassen. Das so gefundene zelluläre Protein unterschied sich so gut wie gar nicht von seinem viralen Gegenstück, weshalb wir es pp60c-src nannten. Beide ähnelten sich in Größe und chemischem Aufbau, beide katalysierten eine Phosphorylierung von Tyrosin, und beide waren fest an die Plasmamembran gebunden (pp60v-src an die Membranen transformierter Zellen, pp60c-src an die von normalen Zellen). Es sieht so aus, als ob beide Proteine für den gleichen Zweck geschaffen wurden, obgleich das eine viraler Herkunft ist und Krebs erzeugen kann, während das andere normalen Zellen entstammt und dort eine normale Funktion erfüllt.
Zelluläre Verwandte der viralen Krebsgene
Die an den src-Genen gewonnenen Erkenntnisse lieferten den ersten Fingerzeig für eine Allgemeinstruktur, deren Ausmaß und Bedeutung noch nicht abzuschätzen sind. Von 16 der 17 bisher in Retroviren identifizierten Krebsgenen weiß man, daß sie enge Verwandte in der DNA normaler Wirbeltierzellen sitzen haben. Die meisten dieser zellulären Verwandten folgen dem gleichen Grundschema wie das bereits beschriebene c-src-Gen: Sie besitzen Exons und Introns; sie scheinen sich während der Evolution kaum verändert zu haben, und sie sind in normalen Zellen aktiv. Die meisten Virologen vertreten daher heute die Ansicht, daß die viralen Krebsgene gewissermaßen Kopien der zellulären src-Gene sind. Anscheinend wurden die Krebsgene vor entwicklungsgeschichtlich gar nicht allzu langer Zeit in das Genom von Retroviren übernommen. Wie und warum sich die Retroviren Kopien dieser zellulären Gene angeeignet haben, ist unbekannt. Einige Gründe sprechen aber dafür, daß dieser Prozeß auch heute noch stattfindet. Und möglicherweise läßt er sich sogar unter Laborbedingungen nachvollziehen.
Zunächst bezeichnete man die Wirbeltiergene, aus denen die Krebsgene der Retroviren offenbar hervorgingen, als Proto-Krebsgene. Man wollte sie damit als Stammeltern hervorheben und gleichzeitig den Eindruck vermeiden, sie könnten selbst krebserregend sein. Doch dazu sind die zellulären Gene tatsächlich in der Lage. Es handelt sich bei ihnen also um echte zelleigene Krebsgene. Die Untersuchungen, die eine solche Behauptung rechtfertigen, drehten sich zunächst um die Frage: Wie kann man sich die verheerende Wirkung viraler Krebsgene erklären, wenn diese doch nur Kopien normaler zellulärer Gene sind? Zwei Antworten boten sich an. Eine lautete: Die viralen Krebsgene könnten sich von ihren zellulären Vorläufern in subtiler, aber bedeutsamer Weise unterscheiden, weil die »gestohlenen« Kopien nicht fehlerfrei angefertigt waren. Durch solche Mutationen wäre es beispielsweise möglich, daß pp60v-src und pp60c-src — obwohl sie sehr ähnliche Enzymaktivität aufweisen — in der Zelle unterschiedliche Ziele angreifen und sich daher auch anders auf das Verhalten der Zellen auswirken. Das Gegenstück zu dieser Mutationshypothese ist die Dosishypothese. Sie besagt, daß die Krebsgene der Retroviren einfach mit brutaler Gewalt handeln und ihre Wirtszellen mit bestimmten, eigentlich normalen und funktionell erforderlichen Proteinen überlasten. Hier wird die Entstehung von Krebs also auf eine Überdosis und nicht auf irgendwelche besonderen Eigenschaften von viralen Proteinen zurückgeführt.
Im Moment läßt sich noch nicht entscheiden, welche der beiden Hypothesen die richtige ist, doch den ersten Hinweisen zufolge dürfte der Dosishypothese die Favoritenrolle zufallen. So liegen die Mengen an Proteinen, die auf das Konto der viralen Krebsgene gehen, bei weitem höher als die Mengen, die gewöhnlich von den zellulären src-Genen bereitgestellt werden. Durchaus denkbar, daß die Zelle von ihnen regelrecht erdrückt wird. Weitere wichtige Hinweise lieferten Versuche, mit denen man eine Voraussage der Dosis-Hypothese prüfen wollte. Wenn virale und zelluläre src-Gene tatsächlich identische Funktionen haben, dann sollte es möglich sein, Bedingungen zu finden, unter denen auch letztere überaktiv werden und ein krebsartiges Wachstum induzieren.
Krebserzeugung durch zelluläre Gene
Der erste Prüfstein waren die bemerkenswerten Experimente von Hidesaburo Hanafusa und dessen Kollegen an der Rockefeller Universität. Hanafusa entdeckte Stämme des Rous-Sarkom-Virus, die große Teile des src-Gens verloren hatten und daher in Tierexperimenten nicht mehr die charakteristischen Sarkome induzieren konnten. Er injizierte die verkrüppelten Viren in Hühner und gewann anschließend die neu produzierten Viruspartikel wieder aus den infizierten Zellen zurück. Zu seiner Überraschung fand er ein ausgebessertes v-src-Gen vor. Offensichtlich hatten Rekombinations-vorgänge Teile des zellulären Genoms mit dem viralen Genom verbunden. Ein Virus mit einem solchen ausgebesserten Gen vermochte genauso gut Tumoren zu erzeugen wie seine normalen Doppelgänger, obgleich er Dreiviertel seines Krebsgens aus dem zellulären Gegenstück beschlagnahmt hatte. Hanafusa konnte dieses außergewöhnliche Manöver nach Belieben wiederholen, es klappte sowohl bei Wachteln als auch bei Hühnern. Seine Experimente sprachen zwar sehr stark dafür, daß v-src und c-src die gleichen Funktionen ausüben, aber viele Tumorvirologen waren noch nicht zu überzeugen, solange direktere Beweise für die krebserregende Fähigkeit der zellulären Gene fehlten.
Heute liegen solche Beweise vor. Mit gentechnologischen Methoden konnten die Forschergruppen von George F. Vande Woude und Edward M. Scolnick am amerikanischen Nationalen Krebsinstitut drei zelluläre Krebsgene (eins aus Mäusen und zwei aus Ratten) isolieren und damit in Zellen einer Gewebekultur ein krebsartiges Wachstum hervorrufen. Das Bravourstück gelang jedoch erst, nachdem sie den zellulären Genen einen viralen Promoter angeheftet hatten. Das ist ein Stück DNA mit einem Signal, das die Abschrift der ihm benachbarten Gene fördert. Das Promoter-src-Genstück wurde dann in Zellen übertragen, wo es sich genauso verhielt wie ein virales Krebsgen und einige Zellen trans formierte. In Wirklichkeit war das Kuckucksei jedoch ein zelluläres Gen, das unter viralem Kommando lediglich intensiver arbeitete als gewöhnlich. Denn im Einklang mit der Dosishypothese synthetisierten die Zellen, die mit den beiden Krebsgenen aus Ratten transformiert waren, ungewöhnlich große Mengen der entsprechenden Rattenproteine.
Warum sollte aber ein normales Protein in Überdosen solche Verheerungen anrichten? Mit Sicherheit läßt sich diese Frage erst beantworten, wenn man über die Funktion der zellulären Onkogene in ihrer normalen Umgebung besser Bescheid weiß. Vielleicht sind zelluläre Krebsgene Teil eines fein abgestimmten Kontrollsystems, das Wachstum und Entwicklung normaler Zellen reguliert. Die extreme Aktivität eines solchen Gens könnte das Gleichgewicht in ein ungehemmtes Wachstum umkippen lassen.
Es gibt tatsächlich Hinweise dafür, daß virale wie zelluläre Krebsgene mit der Wachstumsregulation normaler Zellen zu tun haben. Zuerst schien die Phosphorylierung von Tyrosinresten durch das Protein pp60v-src ein anomaler Vorgang zu sein, der nur unter dem Einfluß des viralen Krebsgens zustande kommt. Doch das stellte sich als falsch heraus, als Hochschule der Vanderbilt Universität bewies, daß die Tyrosinphosphorylierung auch im Stoffwechselhaushalt normaler Zellen eine Rolle spielt. Er hatte einen kleinen, sogenannten epidermalen Wachstumsfaktor entdeckt und isoliert, der sich an die Oberfläche von Zellen bindet und dabei deren DNA-Synthese und Teilung stimuliert. Die Frage war nur, wie das entsprechende Signal durch die Zellmembran nach innen gelangte. Als erstes konnte Cohen zeigen, daß die Bindung die Phosphorylierung von Proteinen auslöst. Ihm waren die Eigenschaften von pp60v-src bekannt, und so schaute er sich die Tyrosine genauer an. Tatsächlich wurde unter dem Einfluß des Wachstumsfaktors spezifisch diese Aminosäure in den Proteinen phosphoryliert. Inzwischen stellte sich heraus, daß die gleichen Proteine sich teilweise auch durch pp60v-src phosphorylieren lassen. Es sieht also so aus, als ob eine normale, die Zellteilung stimulierende Substanz (der epidermale Wachstumsfaktor) und eine anomale Substanz (pp60v-src) das gleiche Instrumentarium benutzen. Der Schluß liegt daher nahe, daß auch das Produkt des zellulären src-Gens bei der Wachstumsregulation einer normalen Zelle eine Rolle spielt.
Auf der Suche nach einer einheitlichen Theorie
Bei Menschen scheinen Retroviren nicht zu den Hauptursachen von Krebs zu zählen; trotzdem haben sie uns möglicherweise den Blick auf die zentralen Mechanismen geöffnet, die diese tückische Krankheit entstehen lassen. Nach allgemeiner Ansicht beginnt Krebs mit Defekten in der DNA, obwohl die Natur der Schäden noch umstritten ist. Wie könnten nun DNA-Schäden zu einem krebsartigen Wachstum der Zellen führen? Fast alle jüngeren Hypothesen, die eine für sämtliche Formen des Krebses gültige Antwort zu geben versuchen, gehen von allgemein vorhandenen Krebsgenen aus. Also von Genen im normalen zellulären Genom, welche unter dem Einfluß verschiedenartiger krebserregender Substanzen eine entfesselte Aktivität entwickeln, die wiederum für das undisziplinierte Verhalten von Krebszellen verantwortlich ist. Dabei betrachtet man Krebsgene nicht als fremde unerwünschte Eindringlinge, sondern als normale, sogar lebenswichtige Zellgene, die ausflippen und Amok zu laufen beginnen. Freund wird zu Feind, und das alles, weil karzinogene Substanzen vermutlich die Krebsgene selbst oder Kontrollgene schädigen, die normalerweise die Aktivitäten der Krebsgene überwachen und steuern.
Möglicherweise haben Genetiker schon vor Jahren die Auswirkungen solcher Krebsgene beobachtet, als sie Familien untersuchten, in denen die Veranlagung für bestimmte Krebsformen vererbt wird. Jetzt sieht es so aus, daß die Tumorvirologen bei den scr-Genen nun direkt auf zelluläre Krebsgene gestoßen sind. In ihrer viralen Form führen diese Gene zu Tumoren, und aus den Ergebnissen von Vande Woud und Scolnick läßt sich ableiten, daß auch die zellulären Formen transformierend wirken können. Die Krebsgen-Hypothese von Huebner und Todaro feiert also mit neuen Schauspielern ein Comeback: Zelluläre Krebsgene haben die viralen abgelöst. Und die Dosishypothese hilft zu erklären, warum die gesteigerte Aktivität eines normalen zelleigenen Gens Krebs hervorrufen kann.
Gestützt werden diese Hypothesen auch durch Untersuchungen an Retroviren, die bei Hühnern sogenannte Lymphome induzieren; das sind tödlich ausgehende Tumoren des Immunsystems. Diese Retroviren besitzen kein Krebsgen. Warum erzeugen sie also Krebs? Die Entdeckungen von William S. Hayward und Benjamin G. Neel an der Rokkefeller Universität sowie von Susan M. Astrin vom Krebsforschungsinstitut in Fox Chase (Pennsylvanien) geben hier vielleicht schon die Antwort. In den Lymphomzellen wird die virale DNA fast immer in unmittelbarer Nachbarschaft eines erst kürzlich aufgefundenen zellulären Onkogens eingebaut. (Es trägt die Bezeichnung cmyc und unterschei-det sich von dem bekannten c-src.) Die Integration scheint der Grund dafür zu sein, warum sich die Aktivität des zellulären Krebsgens so deutlich verstärkt.
Diese Ergebnisse passen gut in das bisher entwickelte Konzept von Krebsgenen. Der Einbau der Lymphom-Virus-DNA hat den gleichen Effekt wie Mutationen oder DNA-Schäden durch verschiedenartige karzinogene Substanzen. Und er führt zu der gesteigerten Aktivität eines Gens, von dem man weiß, daß es ein krebserregendes virales Gegenstück (v-myc) besitzt — und zwar in einem anderen Hühner-Retrovirus. Das entfesselte Krebsgen scheint zumindest teilweise für die Entstehung der Lymphome verantwortlich zu sein. Retroviren ohne Krebsgene induzieren eine ganze Reihe von Tumoren. Vielleicht stoßen die Tumorvirologen noch auf andere, bisher nicht erkennbare zelluläre Krebsgene, wenn sie nachschauen, wo in der Zelle diese Viren ihre umgeschriebene DNA integrieren.
Daß sich der Schleier über den Krebsgenen mittels Retroviren lüften ließ, war ein glücklicher Zufall. Müssen sich die Krebsforscher nun mit dem Schritt-Tempo zufrieden geben, in dem ihnen die Retroviren neue zelluläre Krebsgene enthüllen? Offensichtlich nicht, denn es gibt neue, über die Tumorvirologie hinausgehende Forschungsansätze. Robert A. Weinberg vom Massachusetts Institut für Technologie und Geoffrey Cooper von der Medizinischen Hochschule der Harvard-Universität zeigten, daß kleine genlange DNA-Stücke, die sie aus einigen nicht virusinduzierten Tumoren isoliert hatten, nach der Übertragung in normale kultivierte Zellen dort ein krebsartiges Wachstum hervorrufen.
Weinberg und Cooper haben offenbar einen Weg gefunden, um aktive Krebsgene von einer Zelle in eine andere zu übertragen. Sie besitzen auch Hinweise dafür, daß in verschiedenen Krebsarten unterschiedliche Krebsgene aktiv sind. Die Zukunft wird uns also höchstwahrscheinlich weitere Krebsgene bescheren. Keine der bisher von Weinberg und Cooper aufgespürten Krebsgene ist mit den schon bekannten identisch. Trotzdem könnte durchaus nur eine einzige große Familie von zellulären Krebsgenen existieren. Wenn dem so ist, sollten die Untersuchungen an Retroviren und die von Weinberg und Cooper entwickelten Verfahren uns bald näher mit den einzelnen Mitgliedern dieser Familie bekannt machen.
Der Weg zum Krebs
Vielleicht tragen schon alle normalen Zellen den Keim ihrer Vernichtung in Form der Krebsgene in sich. Die Überaktivität dieser Gene stellt sich vielleicht einmal als der gemeinsame Weg heraus, über den viele karzinogene Substanzen ihre verheerende Wirkung ausüben. Krebsgene sind wahrscheinlich gar keine unerwünschten Eindringlinge, sondern wichtige und notwendige Bestandteile des genetischen Apparates einer Zelle. Nur wenn ihre Struktur oder ihre Regulierung durch Karzinogene gestört ist, »verraten« sie ihre Zelle. Wenigstens einige dieser Gene dürften in den Retroviren auftauchen, wo man sie leicht identifizieren, manipulieren und charakterisieren kann.
Was man bisher über die Krebsgene gelernt hat, erlaubt nur einen ersten flüchtigen Blick hinter den geheimnisvollen Schleier, der die Mechanismen der Krebsentstehung umhüllt. In einer Hinsicht mag dieser Blick entmutigend sein, denn die chemischen Mechanismen, die eine Krebszelle vom rechten Weg ab-kommen lassen, unterscheiden sich im Prinzip nicht von denen, die in einer normalen »gehorsamen« Zelle am Werk sind. Das läßt den Eindruck aufkommen, daß man auch in Zukunft möglicherweise keine besseren, weniger bedrücken-den Strategien zur Bekämpfung des Krebses entwickeln kann. Es scheint ja keinen Zweck zu haben, Mittel zu erfinden, die die Aktivität der Krebsgene beeinflussen, wenn die gleichen Genaktivitäten auch für das Überleben einer normalen Zelle erforderlich sind.
Wie auch immer die Geschichte enden mag — jeder, der sich mit Krebsforschung beschäftigt, kann daraus etwas lernen. Die Untersuchung von Viren, die auf den ersten Blick wenig mit den Belangen des Menschen zu tun hatte, gab uns wirkungsvolle Instrumente in die Hand, um eine so gefährliche Krankheit des Menschen studieren zu können. Trotz der Niederlagen bei der Suche nach Viren, die für die Entstehung menschlicher Krebserkrankungen verantwortlich sind, ging die Tumorvirologie als Sieger hervor. Die Frage lautet nun nicht mehr, ob Viren menschliche Krebserkrankungen verursachen (einige Viren sind hier möglicherweise nicht ganz so unschuldig), sondern vielmehr, was uns die Tumorvirologie über die Mechanismen lehren kann, durch die menschliche Tumoren entstehen.
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben