Juni 1990: Eine Nachtfahrt und die Polymerase-Kettenreaktion
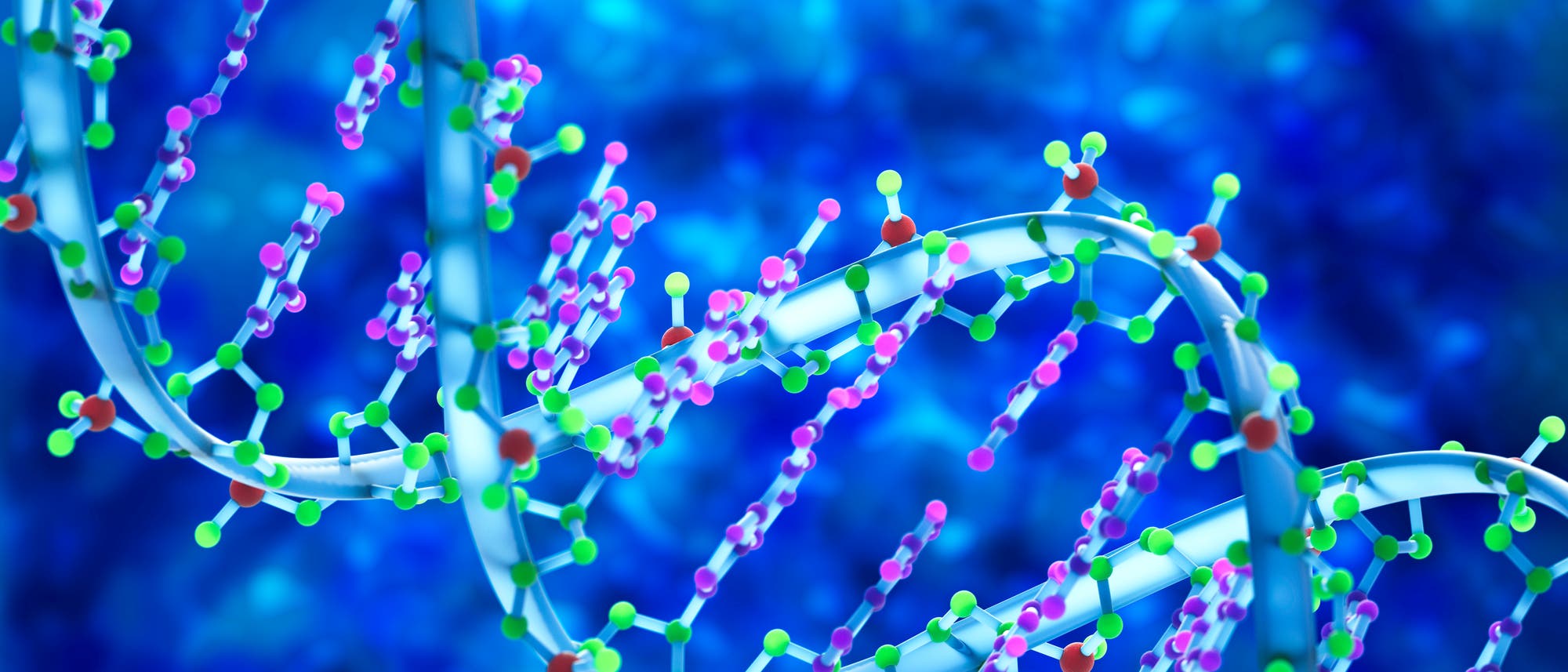
Es war ein Geistesblitz — bei Nacht, unterwegs auf einer mondbeschienenen Bergstraße, an einem Freitag im April 1983. Ich fuhr gemächlich mit meinem Wagen zu den Mammutbaumwäldern im Norden Kaliforniens, als aus einem unglaublichen Zusammentreffen von Zufällen, Naivität und glücklichen Irrtümern plötzlich die Eingebung kam: zu jenem Genkopierverfahren, das heute als Polymerase-Kettenreaktion (englisch polymerase chain reaction oder kurz PCR) bekannt ist.
Ausgehend von einem einzigen Molekül der Erbsubstanz DNA kann man damit an einem Nachmittag 100 Milliarden Kopien des gewünschten Abschnitts erzeugen — und alles ohne großen Aufwand: Man braucht nur ein Reagenzglas, ein paar Zutaten und eine Wärmequelle. Die zu kopierende DNA muß nicht einmal in gereinigter Form vorliegen; ein Quentchen davon in einem hochkomplizierten Gemisch biologischer Substanzen genügt. Sie kann aus der Gewebeprobe eines Kranken stammen, aber auch aus einem einzigen menschlichen Haar, einem eingetrockneten Blutstropfen am Ort einer Gewalttat, einem mumifizierten Gehirn oder einem 40000 Jahre alten Mammut, das im Dauerfrostboden leidlich konserviert worden ist.
In den sieben Jahren seit jener Nacht hat die Polymerase-Kettenreaktion alle biowissenschaftlichen Bereiche erobert: Mehr als 1000 Veröffentlichungen fußen auf ihrer Anwendung. Angesichts solcher Schlagkraft und des einfachen Konzepts dieser Reaktion scheint es schier unglaublich, daß nicht schon früher jemand darauf gekommen war; alle nötigen Voraussetzungen dafür waren immerhin seit mehr als 15 Jahren gegeben.
Isolierung von Genen — ein mühsames Unterfangen
Die Polymerase-Kettenreaktion macht den Molekularbiologen das Leben um vieles leichter: Endlich können sie eine bestimmte DNA in jeder gewünschten Menge herstellen. Die üblichen Diskussionen über DNA-Moleküle hören sich manchmal so an, als wäre die Gewinnung ein Kinderspiel. Aber außer bei sehr einfach gebauten Viren ist es in Wirklichkeit recht schwierig, an ein ganz bestimmtes Stück DNA eines Organismus heranzukommen.
Dies liegt am Aufbau des Moleküls. Die DNA, die Desoxyribonucleinsäure, ist eine raffiniert zusammengesetzte Kette aus vier Arten von Desoxyribonucleotiden. Ein solches Nucleotid besteht aus einer Phosphatgruppe, dem Zucker Ribose (dem hier ein Sauerstoffatom fehlt, daher »Desoxy«) sowie einer von vier Basen. In der Reihenfolge dieser Basen — Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) und Cytosin (C) — ist die genetische Information verschlüsselt festgelegt (die Kürzel stehen übrigens meist stellvertretend für das gesamte jeweilige Nucleotid).
Ein DNA-Strang tritt aber nur selten allein auf; gewöhnlich ist ein komplementäres Paar von Strängen zur berühmten Doppelhelix vereinigt, deren Struktur der Amerikaner James D. Watson und der Engländer Francis H. C. Crick aufgeklärt und dafür (zusammen mit dem englischen Biophysiker Maurice H. Wilkins) 1962 den Nobelpreis bekommen hatten. Darin stehen sich As und Ts beziehungsweise Cs und Gs gegenüber und sind gleichsam zu Wendeltreppenstufen — über Wasserstoffbrücken — verbunden.
In höheren Zellen ist die Doppelhelix in verschiedene Proteine verpackt, die sie noch enger aufwickeln. Befreit man sie davon, dann wird die DNA eines Chromosoms so lang und dünn, daß schon geringe Scherkräfte sie an allen möglichen Stellen brechen lassen. Mit der gesamten, aus 1000 gleichen Zellen isolierten DNA bekommt man daher zwar auch jedes Gen in tausendfacher Ausfertigung, aber jedes auf einem Fragment anderer Länge.
Dieses Problem hat die Untersuchung von Genen jahrelang sehr erschwert. Einfacher wurde es mit der Entdeckung der Restriktionsendonucleasen in den siebziger Jahren. Diese Enzyme zerschneiden die DNA-Stränge an ganz bestimmten Stellen, so daß man kleinere, bruchfestere und besser identifizierbare Stücke bekommt. Dadurch lassen sich leichter jene Abschnitte isolieren, die ein interessierendes Gen tragen.
Ende der siebziger Jahre waren dann die Molekularbiologen allerorts eifrig dabei, DNA mittels Restriktionsenzymen und sogenannten Oligonucleotid-Sonden zu erforschen. Ein solches Oligonucleotid besteht, wie die Vorsilbe andeutet, aus einigen aneinandergeketteten Nucleotiden in vorgegebener Reihenfolge. Unter geeigneten Bedingungen heftet es sich spezifisch an eine komplementäre Sequenz von einzelsträngiger DNA. Mit radioaktiv markierten, künstlich hergestellten Oligonucleotiden als Sonde läßt sich daher feststellen, ob eine DANN-Probe eine bestimmte Nucleotidsequenz oder ein bestimmtes Gen enthält. Zur Herstellung eben solcher Sonden stellte mich die Firma Cetus in Emeryville (Kalifornien) dann 1979 ein.
Vier Jahre später freilich hatte die Aufgabe erheblich an Reiz verloren —und die meisten von uns, die damit zu tun hatten, waren sogar froh darüber. Schon das mühsame, doch antiquitiert anmutende Retortenkunststück Oligonucleotide gleichsam von Hand zu verfertigen, hatte uns langsam abgestumpft; inzwischen aber gab es ein automatisches Verfahren, das noch weniger Geist erforderte. Dafür war es zuverlässig und sicherlich ein enormer Fortschritt.
Im Gefolge dieser kleinen industriellen Revolution fanden wir Nucleotid-Chemiker uns auf einmal glücklich unterbeschäftigt. Wir fütterten und überwachten Laborgeräte, die fast mehr Oligonucleotide fabrizierten, als wir in unseren Gefrierschränken unterbringen konnten — sicherlich aber mehr, als die Molekularbiologen je bei ihren Experimenten zu verbrauchen vermochten; sie schienen ohnehin nun noch langsamer und umständlicher zu arbeiten, als wir schon längst geargwöhnt hatten. Daher hatten wir in meinem Labor bei Cetus recht viel Zeit, um nachzudenken und herumzuspielen. Und eh ich mich's versah, spielte ich mit Oligonucleotiden herum.
Ein Schuß Naivität
Ich wußte genau : Eine Methode, mit der man exakt das jeweilige Nucleotid in einer bestimmten Position des DNA-Moleküls bestimmen könnte, wäre äußerst nützlich — besonders dann, wenn sie auch bei hochkomplexer DNA (wie der menschlichen) und bei winzigen verfügbaren Mengen funktionieren würde. Ich sah keinen Grund, warum dies mit dem Enzym DNA-Polymerase und einer Abwandlung der Didesoxy-Sequenzanalyse nicht gehen sollte; daher dachte ich mir in aller Unschuld ein Experiment aus, um meine Idee zu prüfen.
Um diesen Versuchsansatz zu verstehen, müssen wir etwas weiter ausholen. In einer DNA-Doppelhelix sind die beiden komplementären Stränge gegenläufig angeordnet: Das sogenannte 3'-Ende (sprich: drei-Strich) des einen Strangs ist mit dem 5'-Ende des anderen gepaart, und umgekehrt. (Die Numerierung bezieht sich auf die Positionen der fünf Kohlenstoffatome in der Desoxyribose; am 3'-Ende etwa sind die chemischen Gruppen des dritten Kohlenstoffs frei.)
Im Jahre 1955 hatten Arthur Kornberg und seine Mitarbeiter an der Universität Stanford (Kalifornien) die besagte DNA-Polymerase entdeckt. In der Natur sind Enzyme dieser Art —man kennt inzwischen mehrere — für diverse Aufgaben zuständig, vor allem jedoch für die Reparatur und Verdoppelung der DNA. Sie können ein kurzes Oligonucleotid, den Starter oder Primer, an seinem 3'-Ende verlängern — allerdings nur, wenn es mit einem komplementären Strang gepaart ist, der als Matrize dient. Das umgebende Medium muß außerdem Nucleosidtriphosphate als Bausteine enthalten, das heißt, die als Nucleosid bezeichnete Verbindung von Base und Zucker trägt drei Phosphatgruppen — und nicht nur eine wie die Nucleotide der DNA.
Die Polymerase klinkt nun dem Starter jeweils den Baustein mit der zum Matrizenstrang komplementären Base an (die beiden energieliefernden Phosphatgruppen werden dabei abgespalten). Enthält das nächste Nucleotid der Matrize beispielsweise ein A, dann bekommt der Starter ein T-Nucleotid angehängt, bei einem G ist es ein C-Nucleotid. Auf diese Weise kann die Polymerase das 3'-Ende des Starters bis zum 5'-Ende der Matrize verlängern. Bei Reparatur oder Verdoppelung der Doppelhelix dient jeder Strang als Matrize für den anderen.
Was nun die Didesoxy-Sequenzanalyse anbelangt, so wird sie nach einem ihrer Erfinder, dem Biochemiker Frederick Sanger vom Molekularbiologischen Laboratorium des Britischen Medizinischen Forschungsrats in London, oft auch als Sanger-Methode bezeichnet. Man benutzt dabei eine DNA-Polymerase, Matrizenstränge, Startermoleküle sowie die normalen vier Desoxynucleosidtriphosphate (dNTPs) und — in geringerer Menge — sogenannte 2',3'-Didesoxynucleosidtriphosphate (ddNTPs), um die Abfolge der Bausteine in der DNA zu bestimmen. Ein solches ddNTP läßt sich zwar ebenso wie ein normales zur Verlängerung der wachsenden Starterketten verwenden; da ihm aber auch in der 3'-Position ein Sauerstoffatom fehlt, kann die Polymerase dem so maskierten 3'-Ende gar nichts mehr anfügen.
Die Sanger-Methode liefert daher unterschiedlich weit verlängerte Starter mit einem maskierten Ende. Wenn man diese Fragmente nach ihrer Länge ordnet und außerdem das jeweilige dd-Nucleotid am Ende kennt, läßt sich die Abfolge der Nucleotide und damit der Basen im Matrizenstrang bestimmen. Endet zum Beispiel die Kette an einer bestimmten Position in einem dd-Nucleotid mit Adenin als Base, dann muß die entsprechende komplementäre Base im Matrizenstrang Thymin sein; bei einem mit Guanin hingegen muß es ein Cytosin sein.
Bei der Abwandlung dieser Methode, die mir vorschwebte, sollte das Reaktionsgemisch nur Polymerasen, Matrizen, ddNTPs und Startermoleküle enthalten, nicht aber die normalen Nucleosidtriphosphate (ihr d wollen wir der Einfachheit halber weglassen). Daher würden die Starter jeweils nur um einen einzigen Baustein verlängert werden. An der Art des eingebauten dd-Nucleotids wollte ich dann die entsprechende Base im Matrizenstrang identifizieren, die unmittelbar neben der Stelle läge, an die sich der Starter gebunden haben sollte.
Auch noch Ahnungslosigkeit
Meine Idee konnte allerdings, was ich damals nicht wußte, aus mehreren triftigen Gründen gar nicht funktionieren. Oligonucleotide paaren sich gelegentlich auch mit anderen als den gewünschten Sequenzen, und das hätte mir mehrdeutige Ergebnisse eingebracht. Selbst bei größter Sorgfalt und Übung wäre es nie gelungen, die Oligonucleotide so spezifisch an die menschliche Gesamt-DNA binden zu lassen, daß ein auch nur annähernd aussagekräftiger Befund zu erwarten gewesen wäre.
Aus diesem Grund hatten Wissenschaftler bei der Analyse menschlicher DNA auf schwierigere Verfahren zurückgreifen müssen. Sie haben beispielsweise die DNA mit Restriktionsenzymen in verschieden große Fragmente zerlegt und diese durch Elektrophorese der Größe nach sortiert: Damit war das gewünschte Fragment bis zu einem gewissen Grade von aller anderen DNA befreit, bevor man die Oligonucleotid-Sonde ansetzte. Auf diese Weise ließen sich irrtümliche Paarungen oder Hybridisierungen gerade so weit reduzieren, daß man einigermaßen aussagekräftige Ergebnisse erhielt. Außerdem war die Methode sehr zeitaufwendig und ließ sich zudem auf teilweise abgebaute oder denaturierte DNA-Proben nicht anwenden.
Man kann eine interessierende menschliche DNA-Sequenz auch in einen kleinen DNA-Ring, ein sogenanntes Plasmid, einbauen und in Bakterien vermehren — diesen Vorgang bezeichnet man als Klonieren. Mittels Oligonucleotiden und der Didesoxy-Sequenzanalyse läßt sich dann die Abfolge der Bausteine bestimmen. Die meisten Sequenzen menschlicher DNA, die man Anfang der achtziger Jahre kannte, waren auf diese Weise ermittelt worden. Für Routinezwecke ist ein solches Vorgehen allerdings viel zu umständlich.
Bei meinem etwas ahnungslos geplanten Experiment hatte ich stillschweigend angenommen, daß weder eine Klonierung noch ähnliche Schritte erforderlich wären, um spezifische menschliche DNA-Sequenzen mit einer einzigen Oligonucleotid-Hybridisierung zu ermitteln. Immerhin gab es für meine abwegigen Gedankenspielereien eine gute Entschuldigung: Auch eine andere Arbeitsgruppe unserer Firma — sie wurde von Henry A. Erlich, einem wirklich erfahrenen Wissenschaftler, geleitet — versuchte sich an einer Methode, die auf der Hybridisierung eines einzigen Oligonucleotids an interessierender menschlicher DNA beruhen sollte. Niemand verlachte Henry, und wir alle erhielten regelmäßig unser Gehalt. Wir wurden sogar so gut bezahlt, daß einige von uns schon voreilig glaubten, wir stünden kurz vor einem Durchbruch in der DNA-Technologie.
Mit den Gedanken spazierenfahren
An dem bewußten Freitagabend im Frühling 1983 fuhr ich nun zusammen mit einer Freundin — sie war Chemikerin — in die Gegend von Mendocino. Sie war eingeschlafen, und die Bundesstraße 101 verlangte keine große Aufmerksamkeit. Ich fuhr gern nachts; jedes Wochenende machte ich mich auf nach Norden zu meinem Ferienhaus : Drei Stunden lang nur Hände und Füße beschäftigt, die Gedanken frei. In jener Nacht sann ich über das Experiment nach, mit dem ich DNA-Sequenzen bestimmen wollte.
Mein Plan war zielstrebig. Zunächst wollte ich die interessierende DNA durch Erwärmen in Einzelstränge zerlegen und dann ein Oligonucleotid mit einer komplementären Sequenz in einem der Stränge hybridisieren lassen. Dieses DNA-Gemisch würde ich auf vier verschiedene Reagenzgläser aufteilen, die jeweils alle vier ddNTPs enthielten; in jedem sollte aber ein anderes radioaktiv markiert sein. Als nächstes käme DNA-Polymerase hinzu, die dann die hybridisierten Oligonucleotide jeweils um einen einzigen Baustein verlängern würde. Diese verlängerten Oligonucleotide ließen sich nach ihrer Ablösung elektrophoretisch von den verbliebenen freien ddNTPs trennen. Ein angebautes radioaktiv markiertes dd-Nucleotid verriete mir schließlich die komplementäre Base im fraglichen DNA-Strang. Ganz einfach.
In der Nähe von Cloverdale, wo die kalifornische Staatsstraße 128 von der Bundesstraße 101 abzweigt und sich in das Küstengebirge hochwindet, war ich mit meinen Überlegungen schon weiter: Die Ergebnisse würden genauer werden, wenn ich nicht nur ein Oligonucleotid einsetzte, sondern zwei. Die beiden Starter sollten das zu bestimmende Basenpaar flankieren, und wenn ich sie unterschiedlich groß machte, wären sie auch voneinander zu unterscheiden. Würde dabei ein Oligonucleotid zum jeweils anderen Strang der untersuchten DNA-Probe passen, erhielte ich komplementäre Informationen über die Sequenz beider Stränge. Damit hätte ich in mein Experiment ohne Mehraufwand eine interne Kontrolle eingebaut.
Als ich mit den beiden Oligonucleotiden im Geiste jonglierte, ihre 3'-Enden an den beiden Strängen des untersuchten Gens einander zugewandt, war mir noch nicht klar, daß ich nahe daran war, die Polymerase-Kettenreaktion zu erfinden. Ich merkte nur, daß ich gefährlich nahe am Rand der Bergstraße fuhr.
Die Luft war feucht und schwer vom Duft blühender Kastanien. Baum um Baum reckte seine weißen Blütenstände ins Licht meiner Scheinwerfer. Ich dachte an die neuen Teiche, die ich auf meinem Grundstück anlegen wollte, überlegte aber gleichzeitig weiter, was bei meinem Sequenzierungsexperiment alles schiefgehen könnte.
Als frischgebackener Doktor der Biochemie hatte ich am Labor von Wolfgang Sadee an der Universität von Kalifornien in San Francisco gearbeitet. Von daher wußte ich, daß meine DNA-Proben vereinzelt Spuren von normalen Nucleosidtriphosphaten enthalten konnten. Wenn die Polymerase die 3'-Enden der Starter zunächst mit solchen Bausteinen statt mit einem der markierten verlängerte, würde dies die Interpretation der Elektrophorese-Gele erschweren.
Vielleicht sollte ich, so eine Idee, alle freien normalen Nucleosidtriphosphate mit alkalischer Phosphatase erst einmal außer Gefecht setzen. Dieses bakterielle Enzym spaltet die reaktionsfähigen Phosphatgruppen ab, und ohne sie kann die Polymerase nichts mehr mit dem Material anfangen. Dann aber hätte ich anschließend die Phosphatase irgendwie ausschalten müssen, weil sie sich sonst an den nun hinzukommenden ddNTPs vergriffen hätte. Normalerweise kann man unerwünschte Enzyme durch Erhitzen inaktivieren, weil sie dadurch buchstäblich außer Form geraten — denaturieren. Die bakterielle alkalische Phosphatase vermöchte aber, so dachte ich, nach dem Abkühlen wieder ihre alte Form anzunehmen. Deshalb verwarf ich diesen Weg.
Dieser Irrtum war mein Glück. Hätte ich schon damals gewußt, daß die alkalische Phosphatase sehr wohl ein für allemal denaturiert, sofern die Lösung kein Zink enthält, hätte ich nicht weiter nach Alternativen gesucht.
Mit jeder Meile fiel mir eine andere Lösungsmöglichkeit ein, die ich ebenso schnell wieder verwarf. Dann aber, als die Straße ins Anderson Valley abtauchte, durchzuckte mich ein Gedanke, der an meinen Sinn für Ästhetik und Wirtschaftlichkeit rührte: Ich könnte doch dasselbe Enzym, nämlich die DNA-Polymerase, gleich zweimal benutzen — zuerst, um die noch vorhandenen normalen Nucleosidtriphosphate aus dem Ansatz zu entfernen, und dann, um davon die markierten ddNTPs verbauen zu lassen.
Meine Überlegung war nämlich: Wenn noch so viele normale Nucleosidtriphosphate vorhanden wären, daß sie das Experiment störten, dann reichten sie auch allein für eine Polymerase-Reaktion. Wenn ich also zunächst eine Art Leerlaufreaktion —mit Oligonucleotid-Startern und DNA-Polymerase, aber ohne ddNTPs —durchführte, müßten alle Bausteine zur Verlängerung der Oligonucleotide aufgebraucht werden. Durch Erwärmen ließen sich dann die gewachsenen Oligonucleotid-Ketten von der fraglichen DNA lösen. Sie wären zwar dann immer noch im Ansatz vorhanden, hätten aber gegenüber der erdrückenden Mehrheit unverlängerter Starter kaum eine Chance, beim anschließenden Abkühlen mit meiner DNA zu hybridisieren. Nach Zugabe von ddNTPs und weiterer Polymerase könnte ich schließlich mein Sequenzierungsexperiment durchführen.
Die Eingebung
Einige Fragen bohrten jedoch in mir weiter. Was wäre, wenn die bei der Leerlaufreaktion verlängerten Oligonucleotide den weiteren Ablauf störten, wenn sie statt nur um ein oder zwei Basen um ein größeres Stück verlängert worden wären — so weit sogar, daß ihre Sequenz eine Bindungsstelle für das zweite Startermolekül einschlösse? Das gäbe doch sicherlich Probleme.
Nein, keineswegs! Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Die Stränge der fraglichen DNA und der verlängerten Oligonucleotide hatten ja wechselseitig die gleiche Basensequenz. Alles in allem würde sich durch die Leerlaufreaktion die Zahl der analysierbaren DNA-Moleküle in meinem Ansatz verdoppeln! Plötzlich nahm ich den Duft nicht mehr wahr, nicht mehr die aufleuchtenden Blüten, nicht mehr die Frühlingsnacht.
Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht nicht so schnell die Bedeutung dieser Verdoppelung erkannt. Allein den gleichen Vorgang immer von neuem wiederholen zu müssen wäre mir wohl als unerträglich langweilig erschienen. Allerdings hatte ich viel Zeit mit Schreiben von Computerprogrammen zugebracht; so waren mir Iterationsschleifen, die eine mathematische Operation immer wieder auf das Ergebnis des vorherigen Durchgangsanwenden, wohlvertraut. Dabei hatte ich erfahren, welch lawinenartige Vermehrung re-iterative, exponentielle Wachstumsprozesse bedeuten. Und genau so ein Prozeß wäre die mir gerade eingefallene Methode zur DNA-Vermehrung.
Aufgeregt ging ich im Kopf die Zweierpotenzen durch : 2, 4, 8, 16, 32... Ich erinnerte mich dunkel, daß zwei hoch zehn schon ungefähr tausend ist, und zwei hoch zwanzig daher rund eine Million. Ich hielt an einer Ausweichstelle, von der aus man das Anderson Valley überblicken kann, und kramte aus dem Handschuhfach Bleistift und Papier hervor — ich mußte das nachrechnen. Jennifer, meine Beifahrerin, beschwerte sich schläfrig über den unnötigen Halt und das störende Licht. Als ich aufgeregt etwas von einer phantastischen Entdeckung stammelte, legte sie irritiert den Kopf wieder zur Seite. Ich überzeugte mich davon, daß zwei hoch zwanzig tatsächlich über eine Million ist, und fuhr weiter.
Eine runde Meile später wurde mir noch etwas anderes klar. Der ganze Zyklus — Verlängern der Starter, Trennung von der DNA, Anlagern neuer Starter und deren erneutes Verlängern — ergäbe nach mehreren Durchläufen sogar gleich lange, exponentiell vermehrte DNA-Stränge; denn die Länge war durch die 5'-Enden der Oligonucleotid-Starter festgelegt. Um größere Abschnitte der ursprünglichen DNA-Probe zu vermehren, mußte ich einfach nur Starter herstellen, die sich ein entsprechendes Stück weiter auseinander anlagerten. Man bekäme immer genau definierte Fragmente mit jeweils festgelegter Länge.
Wieder hielt ich an — diesmal, um hybridisierende, sich verlängernde DNA-Moleküle in Strichen aufs Papier zu werfen: Die Produkte eines Reaktionszyklus wurden zu Matrizen für den nächsten und so fort — eine Kettenreaktion...
Wieder protestierte Jennifer im Halbschlaf. »Du wirst es nicht glauben!« jubelte ich. »Es ist unfaßbar!« Sie ignorierte meine Sternstunde und schlief weiter.
Zweifel und Triumph
Ohne nochmals anzuhalten, fuhr ich zum Ferienhaus weiter. Es liegt im hintersten Winkel des Tales, wo die Mammutbaumwälder beginnen und wo schon immer die Tunichtgute gelebt haben. Meine Entdeckung indes erweckte in mir das merkwürdige Gefühl, als ob ich dabei wäre, mit dieser alten Tradition zu brechen. In jener Nacht konnte ich nur schwer Schlaf finden: In meinem Kopf detonierten Desoxyribonuklearbomben.
Doch am nächsten Morgen war meine Begeisterung mißmutiger Müdigkeit gewichen; ich konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, daß noch niemand irgendwo dieses Verfahren ausprobiert hätte. Tausende von Wissenschaftlern hatten aus den verschiedensten Gründen einzelne Oligonucleotide mittels Polymerasen verlängert; dabei mußte doch irgendeinem auch die Möglichkeit einer Kettenreaktion aufgefallen sein. Aber wenn sie funktioniert hätte, müßte ich auch davon gehört haben: Jeder hätte von da an DNA-Fragmente auf diese Weise vervielfacht, amplifiziert (wie der Fachterminus lautet).
Am Montag, zurück in der Firma, bat ich George McGregor, einen unserer Bibliothekare, um eine Literaturrecherche in Sachen DNA-Polymerase. Relevantes zur DNA-Vervielfachung tauchte dabei nicht auf. In den folgenden Wochen erklärte ich meine Idee jedem, der sie nur hören wollte. Niemand hatte je von einem Versuch dieser Art gehört; aber es kannte auch niemand einen triftigen Grund, warum das nicht funktionieren sollte — und doch war niemand davon sonderlich begeistert. Früher schon hatten die Leute meine Ideen über DNA im allgemeinen etwas abwegig gefunden, und manchmal mußte ich ihnen nach einigen Tagen recht geben. Diesmal aber war ich sicher, daß ich eine heiße Spur verfolgte.
Vor vielen Jahren, bevor es die Biotechnologie gab und die Leute hierzulande unter einem genetic engineer (Gentechniker) allenfalls einen »Erb«Maschinisten verstanden hätten, dessen Vater und Großvater sich auch schon mit öligen Händen an Pumpen oder Lokomotiven zu schaffen machten, hatte das Firmengebäude von Cetus der Shell-Entwicklungsgesellschaft gehört. In unseren Laborräumen mit großartigem Ausblick auf die Hügel von Berkeley war einst der »No-Pest-Strip« genannte Fliegenfänger entwickelt worden. Um es in freier Anlehnung an Watson und Crick zu sagen —es war meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, daß die Polymerase-Kettenreaktion möglicherweise einmal ebenso weite Verbreitung finden könnte wie jene Erfindung: der unverkennbar riechende, gelbe, klebrige und übrigens meist wie eine überdimensionale DNA-Doppelhelix spiralig von der Küchenlampe herabbaumelnde Kunststoffstreifen.
Monate vergingen mit den Vorbereitungen für mein erstes Experiment, das erweisen sollte, ob die Polymerase-Kettenreaktion wirklich funktioniert. Vielfach konnte ich nur mutmaßen: Was wären wohl die geeignetsten Pufferlösungen, die richtigen relativen und absoluten Konzentrationen der beteiligten Substanzen, der angemessene Grad der Erwärmung und Abkühlung, die nötige Dauer der Reaktion und so weiter? Hilfreich waren dabei einige alte Veröffentlichungen von Kornberg über die DNA-Polymerase. Als Testobjekt wählte ich schließlich ein Fragment von 25 Basenpaaren Länge aus einem Plasmid sowie zwei Oligonucleotid-Starter von 11 beziehungsweise 13 Basen Länge.
Schließlich stand ein Experiment nach meinem Geschmack bevor: mit einem einzigen Reagenzglas und einer einfachen Ja-Nein-Entscheidung. Würde die Polymerase-Kettenreaktion die gewählte DNA-Sequenz vermehren? Die Antwort lautete Ja.
Als ich recht spät am Abend das Labor verließ, sah ich Albert Halluin, den Patentanwalt von Cetus, noch in seinem Büro arbeiten. Ich teilte ihm meine Entdeckung mit. Schon etwa hundert Leuten hatte ich zuvor die Polymerase-Kettenreaktion erklärt, aber Al war der erste außer mir, der sie für bedeutend hielt. Er wollte sofort das Autoradiogramm des Gels mit den Ergebnissen sehen; es war noch feucht.
Manche Leute sind von einem Experiment in gerade einem Röhrchen voll Reagenzien nicht zu beeindrucken, bei Al jedoch bemerkte ich keine Skepsis. Er hatte meine Erklärung des Verfahrens schon in seinem Büro für sinnvoll gehalten; jetzt im Labor war er sogar ein wenig aufgeregt und schlug mir vor, weiter an dem Experiment zu arbeiten und einen Patentantrag zu schreiben. Bevor er ging, gratulierte er mir.
In den nächsten Monaten untersuchte und verfeinerte ich die Polymerase-Kettenreaktion weiter; dabei half mir Fred A. Faloona, ein junger genialischer Mathematiker, den ich über meine Tochter kennengelernt hatte. Fred hatte mir schon beim ersten Experiment geholfen; er sorgte für die zyklische Wiederholung der Polymerase-Reaktion. Es war sein allererstes biochemisches Experiment gewesen, und wir hatten den erfolgreichen Ausgang noch in der Nacht mit ein paar Gläsern Bier begossen.
In den folgenden Monaten wiederholten wir die Polymerase-Kettenreaktion mit immer längeren Stücken von Plasmid-DNA; sie funktionierte. Schließlich erhielten wir aus Erlichs Labor etwas menschliche DNA, und es gelang uns offenbar, ein Fragment von einem Gen zu vermehren, das darin nur in einer Kopie vorhanden war.
Heute sind viele der anfänglichen Unzulänglichkeiten des Verfahrens beseitigt, und es sind mehrere geringfügige Abwandlungen in Gebrauch. Ich empfehle gewöhnlich ein abwechselndes Erhitzen und Abkühlen der DNA-Proben zwischen 98 Grad Celsius —also knapp unter dem Siedepunkt —und 60 Grad. Ein solcher Zyklus braucht nur ein oder zwei Minuten zu dauern, und jedesmal verdoppelt sich dabei die Zahl der gewünschten DNA-Moleküle. Die Starter sind gewöhnlich 20 bis 30 Basen lang.
Eine der wichtigsten Verbesserungen des Verfahrens brachte eine spezielle DNA-Polymerase aus Bakterien der Art Thermus aquaticus, die in heißen Quellen lebt. Unsere ursprüngliche Polymerase war nicht wärmestabil, so daß man bei jedem Reaktionszyklus ein neues Quantum zusetzen mußte. Die DNA-Polymerase von Thermus aquaticus hingegen bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil und aktiv, so daß die zu Beginn zugefügte Menge ausreicht. Diese Hochtemperatur-Polymerase stellt man heute sehr einfach mit gentechnisch veränderten Bakterien her.
Ignoranz und Verwunderung
Die praktisch unbegrenzte Vermehrungsmöglichkeit von DNA mit der Polymerase-Kettenreaktion war so beispiellos, daß man ihr zunächst mit Skepsis begegnete. Niemand hatte mit einer Methode gerechnet, die jede gewünschte Menge einer DNA bereitstellen kann. Fred und mir erschien die Kettenreaktion ganz selbstverständlich, war sie doch unser Spielzeug; die meisten Leute freilich mußten damit erst vertrauter werden.
Im Frühjahr 1984, während ich am Patent arbeitete, präsentierte ich die Polymerase-Kettenreaktion mit einem Poster auf der wissenschaftlichen Jahreskonferenz von Cetus. Diese war immer sehr interessant, denn Cetus hatte einige erstklassige wissenschaftliche Berater, und mit ihnen wollte ich über meine Erfindung sprechen.
Doch niemand schien an meinem Poster interessiert. Langsam beschlich mich Furcht. Die Tagungsteilnehmer warfen einen Blick darauf — und gingen weiter. Schließlich bemerkte ich den Genetiker Joshua Lederberg, den Präsidenten der Rockefeller-Universität in New York, in meiner Nähe und lockte ihn herüber. Er betrachtete aufmerksam meine Ergebnisse und neigte mir dann sein gewaltiges nobelpreisgekröntes Haupt zu — eben den Kopf, der 1946 geschlossen hatte, daß Bakterien Geschlechtsverkehr ausüben können. »Funktioniert es?« Er schien amüsiert. Erfreut bejahte ich, und dann führten wir ein langes Gespräch. Dabei erwähnte er, er habe etwa zwei Jahrzehnte früher, kurz nach Entdeckung der DNA-Polymerase, zusammen mit Kornberg darüber nachgedacht, wie man mit Hilfe dieses Enzyms große Mengen von DNA herstellen könnte. Sie hätten aber keine genaue Vorstellung davon gehabt, wie das funktionieren sollte. Ich erinnerte ihn höflich daran, daß Oligonucleotide damals nicht so leicht verfügbar waren und daß man praktisch keine DNA-Sequenzen kannte.
Er aber wandte sich nochmals meinem Poster zu, und zwar mit einem Ausdruck, den ich fast erwartet hatte. Josh war wohl der erste, der — nachdem er die unglaubliche Einfachheit der Polymerase-Kettenreaktion gesehen hatte — sich das gleiche fragte wie inzwischen fast alle Molekularbiologen und andere mit DNA arbeitenden Wissenschaftler: »Warum bin ich nicht schon längst darauf gekommen?« Und niemand weiß wirklich, warum. Auch ich nicht; ich bin eines Nachts einfach darüber gestolpert.
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben