Stereotype: Wie misst man Vorurteile?
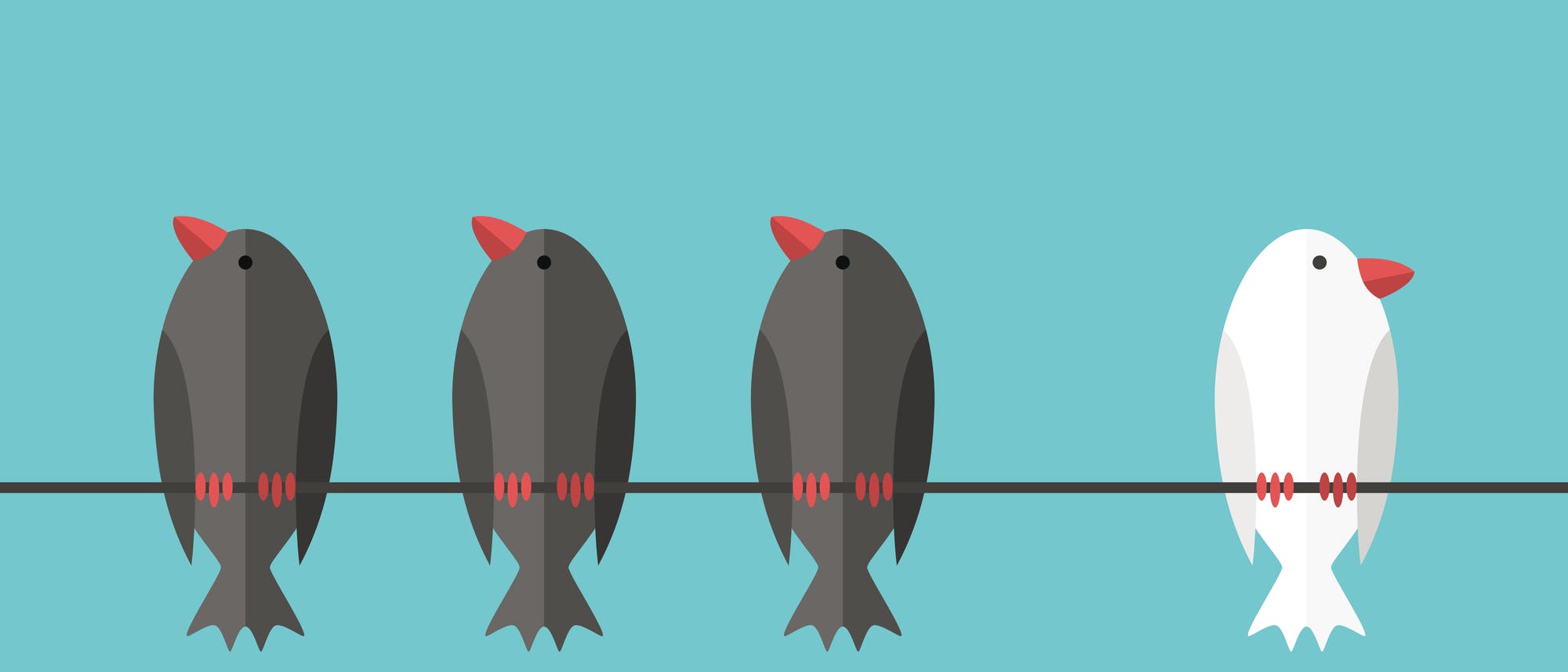
Nicht nur Sozialpsychologen sind daran interessiert herauszufinden, wie Menschen bestimmten Bevölkerungsgruppen gegenüber eingestellt sind. Natürlich könnten sie die Probanden einfach fragen, aber wer gibt schon gerne zu, etwas gegen Ausländer, Schwule oder Dicke zu haben? Manche Vorurteile sind so tief in unserer Kultur verwurzelt, dass selbst Menschen, die sich als liberal und fortschrittlich bezeichnen würden, nicht vor ihnen gefeit sind. Viele dieser Vorbehalte sind uns sogar nicht einmal bewusst, sodass wir gar nicht von ihnen berichten könnten. Wie also findet man heraus, welche Stereotype in den Köpfen lauern?
Dafür haben sich Psychologen eine Reihe cleverer Tests einfallen lassen, die Reaktionszeiten als indirektes Maß für die Geisteshaltung nutzen. Das älteste Verfahren ist das affektive Priming. Hier soll die Versuchsperson am Bildschirm präsentierte Wörter wie »Himmel« oder »Hölle« möglichst schnell per Tastendruck als positiv oder negativ bewerten. Kurz vor dem Wort wird jedoch noch ein anderer Reiz für rund 100 Millisekunden eingeblendet – etwa ein kaukasisches beziehungsweise ein afrikanisches Gesicht. Anschließend schaut man, wie schnell der Proband reagiert hat.
Psychologen haben sich eine Reihe cleverer Tests einfallen lassen, die Reaktionszeiten als indirektes Maß für die Geisteshaltung nutzen
Die Idee dahinter: Wer Dunkelhäutigen gegenüber negativ eingestellt ist, sollte länger brauchen, bei einem angenehmen Begriff die Positivtaste zu drücken, wenn er zuvor das Porträt eines entsprechenden Menschen gesehen hat. Umgekehrt müsste er in diesem Fall bei negativen Begriffen schneller die passende Taste betätigen. Die emotionale Bewertung des Fotos beeinflusst also die Reaktion auf das Wort. Das funktioniert sogar, wenn das Bild nur so kurz gezeigt wird, dass der Proband es gar nicht bewusst wahrnehmen kann. Werden Foto und Wort beide als positiv oder beide als negativ beurteilt, huscht der Finger schneller zur Taste.
Man macht sich hier zu Nutze, dass wir Dinge besser verarbeiten können, wenn ähnliche Konzepte in unserem Gedächtnis bereits aktiviert sind. Schon 1971 zeigte ein Team um den Psychologen David Meyer von der University of Michigan, dass Probanden rascher auf das Wort »Krankenschwester« reagieren, wenn sie zuvor das Wort »Doktor« gelesen haben, und langsamer, wenn stattdessen der Begriff »Baum« zu sehen war.
Der Implizite Assoziationstest
Das gleiche Prinzip nutzt der Implizite Assoziationstest (IAT): In zwei Durchgängen bekommt der Proband vier Typen von Reizen gezeigt. Jeweils zwei davon bilden einen Gegensatz, etwa positive und negative Wörter sowie Bilder von jungen und alten Menschen. Diesen sind allerdings nur zwei Antworttasten zugeordnet. Im ersten Durchgang muss der Teilnehmer nun sowohl auf positive Begriffe als auch auf Fotos von Senioren mit der einen Taste, auf negative Begriffe und Fotos junger Menschen mit der anderen Taste reagieren. Im zweiten Durchgang wird die Tastenzuordnung für »jung« und »alt« getauscht. Die meisten Versuchspersonen sind bei der Kopplung von »negativ« und »alt« schneller. Dieser Befund passt zur negativen Sicht auf das Altern, die in unserer Kultur verbreitet ist.
Solche Verfahren sind allerdings nicht unumstritten. Kritiker bezweifeln, dass relative Unterschiede in der Reaktionszeit automatisch auf verborgene Vorurteile schließen lassen. Möglicherweise ist Schwarzsein bei manchen Probanden ja auch positiv besetzt, nur eben weniger als Weißsein. Der betreffenden Person Rassismus vorzuwerfen, wäre dann schlicht unfair. Zudem deuten Studien darauf hin, dass Probanden solche Tests manipulieren können, wenn sie diese häufiger absolvieren und dann zum Beispiel absichtlich langsamer reagieren. Auch Dinge, die die Versuchspersonen vor dem Test erlebt oder gesehen haben, können das Ergebnis verändern. Wer sich beispielsweise vorher berühmte oder erfolgreiche Vertreter einer stigmatisierten Gruppe ins Gedächtnis ruft, kann entsprechende Gesichter anschließend schneller als positiv kategorisieren.
Selbst wenn implizite Tests nicht perfekt sind, erlauben sie dennoch einen Zugang zu automatischen Prozessen im Gehirn. Dabei dienen sie nicht nur als Werkzeug, um Stereotype zu untersuchen, sondern kommen auch in der Suchtforschung zum Einsatz: Bittet man Probanden, beim Anblick eines perlenden Glases Bier einen Joystick zu sich hinzuziehen beziehungsweise von sich wegzudrücken, unterscheiden sich abstinente Alkoholiker von Menschen ohne Suchtproblem. Gelegentliche Trinker sind schneller darin, die einladende Bewegung zu machen. Suchtpatienten dagegen schieben den Stick rascher weg – sie haben offenbar stark verinnerlicht, dass Schnaps und Co zu vermeiden sind. Dieser Effekt ist vor allem bei denjenigen Patienten besonders ausgeprägt, die auch Monate nach dem Versuch noch trocken bleiben.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.