April 2009: Die Neurobiologie des Vertrauens
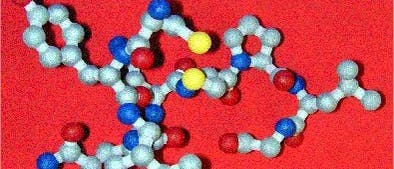
Wenn Sie jemand dazu auffordert: Würden Sie sich einfach rückwärts in die Arme eines Fremden fallen lassen? In Gruppentherapien wird diese Übung häufig angewandt und repräsentiert eine relativ extreme Situation. Allerdings bringen die meisten Menschen im Alltag auch Fremden ein gewisses Vertrauen entgegen. Im Gegensatz zu (anderen) Säugetieren verbringen wir viel Zeit in der Nähe unbekannter Artgenossen. Menschen, die in Städten leben, bewegen sich etwa regelmäßig durch ein Meer von Fremden und entscheiden sich dabei ständig dafür, gewisse Personen eher zu meiden. Ebenso gehen sie davon aus, dass auch die anderen hauptsächlich ihr eigenes Ziel vor Augen haben und sie keinesfalls attackieren werden.
Seit einigen Jahren interessieren sich die Wissenschaftler nun dafür, wie das menschliche Gehirn darüber befindet, ob eine fremde Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Meine Kollegen und ich konnten zeigen, dass bei diesem Vorgang ein sehr altes und kleines Molekül eine große Rolle spielt, das vom Gehirn produziert wird. Fachleute nennen es Oxytozin. Mit unseren Forschungen hoffen wir die Ursachen krankhafter Störungen im zwischenmenschlichen Bereich aufzuklären und besser behandeln zu können. Den Zusammenhang zwischen Oxytozin und Vertrauen konnte ich erst über einige Umwege aufklären. Zusammen mit Stephen Knack, Wirtschaftswissenschaftler der Forschungsgruppe für Entwicklung der Weltbank, untersuchten wir ab 1998, warum die Einstellung der Menschen untereinander innerhalb verschiedener Länder so stark variiert. Für unser Projekt entwickelten wir ein mathematisches Modell, das im jeweiligen Land die sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt, die das Zutrauen beeinflussen könnten.
Dabei fiel uns auf, dass die Vertrauensstärke einer der besten bekannten Indikatoren für den Reichtum eines Landes ist: Staaten mit einem geringen Vertrauensniveau sind in der Regel auch arm. Wie sich mit unserem Modell zeigen ließ, investieren die Menschen dieser Länder zu wenig in langfristige Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und das Einkommen steigern. Denn für solche Geldanlagen müssten die Vertragspartner sich ja darauf verlassen können, dass Vertragsbedingungen beidseitig eingehalten werden.
Da Vertrauen offensichtlich wichtig ist, um die Armut eines Landes zu senken, fragte ich mich, welche Faktoren zwei Menschen dazu bringen, einander Glauben zu schenken. Würde man diesen Prozess verstehen, könnten politische Entscheidungsträger ihn verstärken, indem sie entsprechende Wirtschaftsstrukturen schaffen. Laborstudien haben gezeigt, dass verschiedene solcher Systeme in der gleichen Situation zu einem unterschiedlichen Vertrauensverhältnis zwischen zwei Menschen führen können. Bis dahin hatte allerdings noch niemand einen überzeugenden Mechanismus vorgestellt, der klären würde, wie Vertrauen im Gehirn eigentlich entsteht. Daher beschloss ich, die neurobiologischen Grundlagen dieses Gefühls genauer zu untersuchen.
Das Hormon für Geburtswehen
Viele Ergebnisse aus der Tierforschung deuteten bereits an, dass Oxytozin dabei eine Rolle spielen könnte. Dieses kleine Protein, ein so genanntes Peptid, das aus lediglich neun Aminosäuren besteht, wird im Gehirn produziert und dient hier als Signalmolekül – als Botenstoff zwischen Nervenzellen (Neurotransmitter). Daneben fungiert Oxytozin auch als Hormon: Es wird in die Blutbahn ausgeschüttet und beeinflusst so weiter entfernte Gewebe. Bei Menschen war das Molekül bis dahin vor allem dafür bekannt, Geburtswehen auszulösen und den Milchfluss stillender Frauen anzuregen. Um die Kontraktion der Gebärmutter zu beschleunigen, erhalten rund die Hälfte aller gebärenden Frauen in den USA auch heute noch ein synthetisches Oxytozin (genannt Pitocin). Dagegen war es schwer, die weniger offensichtlichen Wirkungen des Peptids zu analysieren, denn seine Konzentration im Blut ist sehr niedrig, und es wird schnell abgebaut. Es gab jedoch die Hinweise aus Tierversuchen, dass bestimmte Säugetiere mit Hilfe von Oxytozin friedlicher zusammenleben – offensichtlich trauen sie damit einander eher. Darüber hinaus scheint bei anderen Lebewesen das dem Oxytozin nah verwandte Vasotozin das Miteinander zu fördern.
Nach Aussage von Evolutionsbiologen tauchte Vasotozin das erste Mal vor etwa 100 Millionen Jahren bei Fischen auf. Hier fördert es offenbar die geschlechtliche Vermehrung. Es verringert für die Zeit der Eiablage bei den Weibchen die natürliche Angst vor einem herannahenden Männchen. Dieser Mechanismus hat sich laut Biologen entwickelt, da der Nutzen des Geschlechtsverkehrs – wie Nachkommen und eine größere genetische Bandbreite – die mögliche Gefahr überwiegt, dem anderen Fisch als Mittagessen zu dienen.
In Säugetieren entwickelte sich Vasotozin in zwei miteinander nah verwandte Peptide: in Oxytozin und in Arginin-Vasopressin. Ende der 1970er Jahre begonnene Untersuchungen an Nagetieren zeigten, wie beide Moleküle die Beziehung zwischen Artgenossen erleichtern. So fand Cort A. Pedersen von der University of North Carolina in Chapel Hill heraus, dass Oxytozin das Brutpflegeverhalten von Nagetiermüttern anregt.
Bald darauf untersuchten C. Sue Carter und Lowell L. Getz (beide damals an der University of Illinois in Urbana-Champaign) Oxytozin in zwei genetisch und geografisch miteinander verwandten Arten von Wühlmäusen, den Bergund den Präriewühlmäusen. Männliche Präriewühlmäuse verhalten sich sozusagen vorbildlich: In der Regel verbringen sie ihr ganzes Leben mit derselben Partnerin. Die Nagetiere leben in sozialen Gruppen und sind fürsorgliche Väter. Männliche Rocky-Mountains-Wühlmäuse dagegen sind rechte Flegel: Sie wechseln häufig die Partnerin, sind einzelgängerisch und ignorieren ihre Nachkommen. Carter und Getz (und inzwischen auch andere Forschergruppen) führen die großen Unterschiede im Sozialleben der beiden Wühlmausarten darauf zurück, dass sich die Rezeptoren für Oxytozin und Arginin-Vasopressin an verschiedenen Orten des Gehirns befinden. Die Neurotransmitter des Gehirns wirken, indem sie an spezifische Rezeptoren auf der Oberfläche von Nervenzellen binden. Bei den Präriewühlmäusen konzentrieren sich diese Rezeptoren in Hirnregionen, welche bei Aktivierung die Monogamie fördern. Gemeint sind Regionen des Mittelhirns, in denen die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin reguliert wird. Er löst bei dem Präriewühlmaus-Männchen ein angenehmes Gefühl aus und belohnt so Gemeinschaftsleben und Brutpflege.
Die Tierversuche gingen nicht der Frage nach, wie Vertrauen genau entsteht, doch sie bewiesen: Oxytozin spielt dabei eine Rolle. Daraus folgerte ich, dass dieses Molekül möglicherweise bei der Entwicklung von Zutrauen beteiligt ist, was ja vermutlich die Voraussetzung für Nähe ist. Etwa zur gleichen Zeit entwickelten Wissenschaftler eine Methode, kleine Änderungen der Konzentration an Oxytozin im Blut schnell und zuverlässig zu messen.
Lässt sich die Vertrauensstärke zwischen Fremden messen?
Die damaligen Experimente an Nagetieren deuteten darauf hin, dass friedliche Signale eines Tiers die Freisetzung von Oxytozin in dem kontaktierten Tier zur Folge hatten. So fragte ich mich, ob nicht auch bei Menschen Peptide freigesetzt werden, wenn sich ihnen ein Fremder nähert und dabei freundliche Absichten signalisiert. Daraufhin suchten meine Kollegen – Robert Kurzban (Psychologe, heute an der University of Pennsylvania) sowie William Matzner (mein damaliger Student an der Claremont Graduate University) – nach Belegen dafür. Wir wollten herausfinden, ob zwischenmenschliches Verhalten einen Einfluss auf die Oxytozinproduktion haben kann, und ob umgekehrt diese womöglich das menschliche Sozialverhalten verändert.
Wir überlegten uns, wie sich die Vertrauensstärke zwischen einander unbekannten Menschen messen ließe. Bei Experimenten mit Nagetieren hatten Forscher bisher einfach zwei fremde Tiere zusammen in einen Käfig gesetzt und beobachtet, ob friedliches Verhalten des einen die Ausschüttung von Oxytozin in dem anderen Nager auslösen würde. Dagegen sind die Fähigkeiten des Menschen, eine soziale Situation einzuschätzen, viel zu hoch entwickelt, um mit Hilfe eines so einfachen Versuchsschemas erfasst werden zu können. Menschliche Reaktionen können von vielen anderen Faktoren beeinflusst werden, wie zum Beispiel dem körperlichen Erscheinungsbild einer Person, seiner Kleidung et cetera. Glücklicherweise hatten der Wirtschaftswissenschaftler Joyce Berg (University of Iowa) sowie John Dickhaut und Kevin McCabe (beide damals an der University of Minnesota) bereits Mitte der 1990er Jahre einen Test entwickelt, der das Problem umging. Hierbei demonstrieren die Versuchspersonen ihr Vertrauen in eine ihnen fremde Testperson, in dem sie dieser ihr eigenes Geld spenden. Sie schicken es an den Fremden, weil sie erwarten, dass er sich dafür erkenntlich zeigen und mehr Geld zurückschicken wird. Die Forscher nannten dies das »Vertrauensspiel«.
In meinem Labor führen wir das Vertrauensspiel folgendermaßen durch: Meine Mitarbeiter rekrutieren die Testpersonen, die sich einverstanden erklären, anderthalb Stunden mit uns zu verbringen. Dafür erhält jeder 10 Dollar. Anschließend bilden wir aus den Teilnehmern zufällige Paare, die sich nicht sehen und auch nicht miteinander sprechen können. Im Folgenden sollen sie entscheiden, wie viel Geld sie an den Partner abgeben möchten. Bei jedem Versuchspaar wird eine Person Proband 1 und die andere Proband 2 genannt. Zu Beginn des Spiels erklären wir beiden Teilnehmern die Regeln. Zunächst fragt ein Computer Proband 1, ob er einen Teil seines Versuchslohns von 10$ dem Testpartner überlassen möchte. Der Anteil, den Proband 1 abgibt, wird verdreifacht und auf das Konto von Proband 2 überwiesen. Entscheidet sich Proband 1 etwa, 6$ an Proband 2 zu schicken, besitzt dieser schließlich 28$ (dreimal 6$ plus 10$), während Proband 1 noch 4$ verbleiben.
Im nächsten Schritt teilt der Computer Proband 2 mit, wie viel Geld er erhalten hat, und fragt ihn, ob er nun auch einen bestimmten Geldbetrag an Proband 1 zurücksenden möchte. Dabei ist die Entscheidung von Proband 2 allein ihm selbst überlassen. Zudem wird den Versuchsteilnehmern volle Vertraulichkeit zugesichert. Der von Proband 2 gewählte Betrag wird im Verhältnis 1 : 1 von seinem Konto abgezogen (das heißt, in diesem Fall wird der Geldwert nicht verdreifacht). Täuschung ist nicht möglich – die endgültige Auszahlung erfolgt auf Grund dieser Entscheidungen. Danach entnehmen wir den Testpersonen Blutproben, um ihren Oxytozingehalt zu bestimmen.
Experimentelle Wirtschaftsforscher nehmen gewöhnlich an, dass der erste Geldtransfer das Vertrauen und der zweite eher die Vertrauenswürdigkeit misst. Sie haben dieses Vertrauensspiel immer wieder in vielen Ländern durchgeführt – auch mit hohen Geldbeträgen.
Bei unseren Versuchen entschieden sich etwa 85 Prozent der Proband-1-Personen dafür, ihrem Partner Geld zu schicken. 95 Prozent der Beschenkten wiederum sandten einen Betrag an Proband 1 zurück. Interessanterweise konnten die Menschen hinterher nicht wirklich sagen, warum sie dem anderen vertrauten oder ihnen selbst vertraut wurde. Analog zu den Ergebnissen der Nagetierversuche vermutete ich, dass das Vertrauen von Proband 1 bei Proband 2 dazu führte, dass dessen Oxytozinspiegel stieg. Dabei sollte, so meine Hypothese, umso mehr Oxytozin freigesetzt werden, je mehr Geld überwiesen worden war.
Tatsächlich konnten wir zeigen, dass im Gehirn von Proband 2 nach Erhalt des Geldbetrags Oxytozin ausgeschüttet wurde. Dieser biochemische Vorgang erzeugte bei dem Probanden unserer Ansicht nach das Gefühl von »Glaubwürdigsein«. Entwickelte Proband 1 ein größeres Zutrauen und überwies einen höheren Geldbetrag, so stieg auch bei Proband 2 der Oxytozinspiegel stärker an. Nun mussten wir noch prüfen, ob Oxytozin tatsächlich das Gefühl von »Zuverlässigsein« auslöste. Dazu führten wir folgenden Kontrollversuch durch: Eine Gruppe von Teilnehmern erhielt rein zufällige Geldzahlungen, die nicht von einer anderen Person abgeschickt waren und daher auch keinen Vertrauensvorschuss auf Wechselseitigkeit bedeuten konnten. Der Test sollte ausschließen, dass Oxytozin allein auf Grund des Geldes im Gehirn freigesetzt würde. In der Tat konnten wir in dieser Kontrollgruppe keinen Anstieg des Oxytozinpegels feststellen.
Ein weiteres Ergebnis unserer Untersuchung war, dass sich Proband-2-Personen mit einem höheren Oxytozinwert vertrauenswürdiger zeigten als andere mit niedrigeren Werten: Sie sandten mehr Geld an ihre Partner zurück, die zuvor ja auch auf sie gesetzt hatten. Offenbar stimmt uns ein Fremder schon allein dadurch freundlich, dass er uns vertraut.
Warum entwickelten sich die Mechanismen der Oxytozinwirkung beim Menschen so, wie wir sie mit unseren Versuchen gemessen haben? Eine mögliche Erklärung wäre, dass wir Menschen eine sehr lange Kindheit haben. Möglicherweise besaßen die Individuen einen Selektionsvorteil, die lange und intensive Bindungen zu anderen eingehen konnten – bis die Jungen eben erwachsen genug waren, um selbstständig zu leben. Während Schimpansen, unsere nächsten genetischen Verwandten, mit sieben oder acht Jahren geschlechtsreif sind, brauchen wir Menschen dafür fast doppelt so lange und müssen die ganze Zeit hindurch von unseren Eltern betreut werden (und mit ihnen verbunden bleiben). Ein Nebeneffekt der ausgedehnten Fürsorge könnte die ausgesprochene Neigung der Menschen sein, sich an andere zu binden. So fühlen sie sich auch zu Nichtverwandten hingezogen, werden Freunde, Nachbarn oder Ehepartner. Wenn diese Vermutung stimmt, brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, dass Menschen ihr Herz auch an Haustiere hängen, an bestimmte Orte und sogar an ihre Autos.
Freundlichkeit – nur eine Sache der Chemie?
Unsere Resultate aus dem Vertrauensspiel besagten, dass nur bei Proband-2-Personen vermehrt Oxytozin ausgeschüttet wurde. Nur diese Testpersonen hatten vom Partner das Signal erhalten, vertrauenswürdig zu sein. Darüber hinaus stellten wir fest, dass Proband-1-Personen unabhängig von dem ursprünglichen Geldwert entschieden, wie stark sie sich auf den Partner verließen. In anderen Worten, sie übertrugen nicht mehr Geld an Proband-2-Personen, wenn ihre anfängliche Konzentration an Oxytozin gegenüber anderen Probanden erhöht war. Diese Beobachtung erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Sie stimmt aber mit den Ergebnissen aus Tierversuchen überein, die belegen, dass Oxytozin nur freigesetzt wird, wenn die Tiere sozialen Kontakt mit anderen hatten. Offensichtlich ist die Veränderung, das heißt der Anstieg des Vertrauenshormons wichtig und nicht sein absoluter Wert. Somit könnte man sich vorstellen, dass soziale Signale und Kontakte im Gehirn Schalter umlegen können. Werden sie umgelegt, spüren wir: Dieser Mensch ist uns freundlich gesinnt. Das wird durch den Anstieg des Oxytozins vermittelt.
Was würde passieren, wenn wir die Oxytozinspiegel künstlich erhöhten? Träfe unsere Schaltertheorie zu, müsste der Versuch bei Proband 1 das Vertrauen in Proband 2 erhöhen und ihn dazu veranlassen, mehr Geld an den fremden Partner zu überweisen. Dieser Fragestellung ging ich zusammen mit dem Wirtschaftsforscher Ernst Fehr und seiner Arbeitsgruppe von der Universität Zürich nach. Wir ließen 200 männliche Probanden ein oxytozinhaltiges Nasenspray inhalieren (damit der Wirkstoff direkt in das Gehirn gelangte). Anschließend verglichen wir das Verhalten dieser »Geldinvestoren« mit 200 anderen Testpersonen, die lediglich ein Placebospray eingeatmet hatten. Die Männer der Oxytozingruppe überwiesen dabei 17 Prozent mehr Geld an ihre Testpartner als die Teilnehmer der Kontrollgruppe. Besonders beeindruckend war, dass doppelt so viele Oxytozin wie Placebo Männer (fast die Hälfte der gesamten Gruppe) maximales Vertrauen zeigten: Sie übersandten Proband 1 nämlich ihr gesamtes Geld. Der Versuch belegte, dass ein Anstieg der Oxytozinwerte unser natürliches (und sinnvolles) Misstrauen vor Fremden verringert. Es bleibt zu erwähnen, dass einige Probanden trotz Oxytozingabe kaum verstärktes Vertrauen zeigten. Bei diesen Menschen reichte eine Zunahme des Oxytozinwertes allein noch nicht aus, um ihre Scheu vor Fremden zu überwinden.
Oxytozin und Großzügigkeit
Stellen Sie sich (als Proband 1) vor, Sie sollten Ihren Einsatz mit einem Fremden teilen (Proband 2). Akzeptiert dieser Ihr Angebot, erhalten Sie beide einen bestimmten Betrag; lehnt der andere ab, gehen Sie beide leer aus. Welche Summe würden Sie wählen? Wenn Sie in der Rolle der anderen Person (Proband 2) wären, welche angebotene Summe würden Sie akzeptieren?
Das Spiel misst die Großzügigkeit der Mitspieler. Dabei wird jemand als großzügig definiert, der der anderen Person mehr anbietet, als sie benötigt. Im Labor des Autors wurde kürzlich eine Versuchsreihe zu diesem Spiel durchgeführt. Ergebnis: Die Proband-1-Per- sonen, die zuvor Oxytozin inhaliert hatten, boten ihren Partnern einen um 80 Prozent höheren Geldbetrag an als die Personen der Kontrollgruppe, die ein Placebospray eingenommen hatten. Darüber hinaus akzeptierten alle Proband-2- Personen, die Oxytozin eingenommen hatten, den ihnen vorgeschlagenen Geldbetrag. Daraus lässt sich schließen, dass Oxytozin unser Vertrauen in andere fördert. Darüber hinaus stärkt es unser Bedürfnis, anderen zu helfen.
Hier möchte ich etwas klarstellen. Unsere Versuche haben nichts damit zu tun, Menschen zu manipulieren, um ihnen etwa Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Testpersonen verwandelten sich während unseres Experiments keineswegs in willenlose Automaten. Es würde auch Vertretern oder Politikern wenig nützen, einfach Oxytozin in die Luft zu spritzen oder es ins Essen und Trinken zu mischen, um das Vertrauen anderer Menschen zu erzwingen. Oxytozin wird im Darm abgebaut, so dass es bei oraler Gabe das Gehirn gar nicht erreichen würde. Eine intravenöse oder nasale Verabreichung kann aber nicht unbemerkt erfolgen. Darüber hinaus steigt der Oxytozinspiegel des Gehirns nur unwesentlich, wenn man das Molekül verdünnt über die Luft einatmet.
Während eines Experiments erregte sich einmal eine weibliche Testperson darüber, dass ihr Partner ihr gar kein Geld überwies. Ihre Reaktion weckte in uns die Frage, was wohl in Menschen vorgeht, die Misstrauen erleben. Viele wichtige Systeme des Gehirns werden mit Hilfe zweier gegensätzlich arbeitender Kräfte kontrolliert. So wird unser Essverhalten im Wesentlichen über Hormone geregelt, die jeweils melden, wann wir hungrig oder satt sind. Soziales Verhalten könnte ähnlich reguliert werden. Oxytozin fördert sozialen Kontakt. Es fühlt sich buchstäblich gut an, wenn man das Vertrauen anderer erlebt. Dieses Gefühl wiederum wirkt darauf hin, dem Gegenüber ebenfalls zu trauen. Wie bereits erwähnt, fördert Oxytozin das Brutpflegeverhalten von Säugetiermüttern, indem es Dopamin in tieferen Bereichen des Mittelhirns freisetzt, die auch bei Angenehmem wie Sex oder Essen beteiligt sind. In den nachfolgenden Untersuchungen fanden wir wenigstens bei Männern Hinweise auf ein zusätzliches Molekül, das der kontaktfördernden Wirkung des Oxytozins entgegenwirkt.
Wenn den männlichen Proband-2-Personen misstraut wurde (das heißt, wenn ihre Partner ihnen kein Geld sandten), stieg bei ihnen die Konzentration für Dihydrotestosteron (DHT), einen Abkömmling des Testosterons. Je weniger ihre Partner sich auf sie im Vertrauensspiel verließen, desto stärker stieg ihr DHT-Wert. DHT ist ein sehr leistungsfähiges Testosteron. Es steuert viele der auffälligen Veränderungen in der Pubertät männlicher Jugendlicher, wie Wachstum der Körperhaare, vermehrte Muskelbildung oder Stimmbruch. Bei hohem DHT-Spiegel steigt die Bereitschaft, sich in sozialen Situationen körperlich auseinanderzusetzen. Dieses Ergebnis belegt, dass Männer auf Misstrauen mit aggressivem Verhalten reagieren.
Frauen und Männer berichteten gleichermaßen, dass es ihnen missfiel, für nicht zuverlässig gehalten zu werden. Allerdings erfolgte bei den Frauen nicht die »heiße« physiologische Reaktion, vermehrt DHT auszuschütten. Die meisten männlichen Proband-2-Personen, denen misstraut worden war, schickten ihren Partnern einfach kein Geld zurück. Die meisten Proband-2-Frauen dagegen reagierten proportional, das heißt sie gaben unabhängig von der beteiligten Summe ungefähr den gleichen Geldwert zurück wie den, den sie bekommen hatten. Wir halten die Frauen daher für die »kühleren« Spielpartner, ohne jedoch zu verstehen, was auf physiologischer Ebene genau passiert. Die Aussicht, mit einer aggressiven Reaktion rechnen zu müssen, stimmt uns vielleicht manchmal vertrauensvoller. Wenn wir wissen, dass ein Signal des Misstrauens den anderen wütend machen kann, versuchen wir, diese Reaktion zu vermeiden, und geben uns zutraulicher, als wir eigentlich sind.
Zwei Prozent aller Probanden verhielten sich wie Soziopathen
Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomografie haben wir während des Vertrauensspiels die Hirnaktivität der Probanden beobachtet. Dabei fiel uns auf: Vertraute ein Proband seinem fremden Mitspieler, stieg seine Hirnaktivität in den tiefen Bereichen des Mittelhirns, in denen Dopamin bindet. Werden die Dopaminrezeptoren aktiviert, erleben wir ein Belohnungsgefühl. Das erklärt, warum die Proband-2-Personen, die Geld bekommen hatten, in der Regel auch eine gewisse Summe wieder zurückschickten, selbst wenn das für sie ökonomisch von Nachteil war. Offensichtlich wird die Proband-2-Person durch ihre positiven Gefühle psychisch belohnt, wenn sie Proband 1 mit Vertrauen antwortet. Daneben bestärkt dieser Mechanismus sie darin, auch in Zukunft vertrauenswürdig zu handeln.
Obwohl sich die meisten Menschen vertrauenswürdig verhielten, benahmen sich zwei Prozent unserer Probanden auffallend unzuverlässig: Sie behielten sämtliches Geld, das sie erhalten hatten, für sich. Bezeichnenderweise besaßen sie einen ungewöhnlich hohen Oxytozinspiegel. Möglicherweise liegen die Rezeptoren für Oxytozin dieser Menschen in falschen Hirnbereichen (etwa in Regionen, die die Freisetzung von Dopamin nicht beeinflussen). Eine andere Erklärung wäre, dass die Oxytozinrezeptoren dieser Testpersonen nicht funktionieren. Im letzteren Fall wären die Nervenzellen einer Oxytozinausschüttung gegenüber so gut wie unempfindlich, egal, wie stark der Wert sich verändert. Die Personen erinnerten uns insgesamt an Soziopathen, welche sich gegenüber dem Leiden anderer gleichgültig oder sogar erfreut zeigen.
Zurzeit beschäftigen wir uns in meinem Labor mit der Frage, ob ein Mangel an Oxytozin im Gehirn für Störungen des sozialen Umgangs verantwortlich sein kann. So besitzen zum Beispiel Menschen mit Autismus einen niedrigen Oxytozinspiegel. In einem Experiment wurde bereits versucht, das mangelnde Peptid bei autistischen Patienten zu ersetzen. Die Betroffenen nahmen nach der künstlichen Erhöhung ihres Oxytozinwerts jedoch nicht stärker am sozialen Leben teil. Möglicherweise sind bei Autisten wie auch bei den Menschen, die in unserem Spiel keinerlei Vertrauen offenbarten, diese Rezeptoren defekt.
Ebenso gibt es Patienten, deren Hirn in Bereichen mit einer hohen Dichte an Oxytozinrezeptoren verletzt ist. Sie können in der Regel nur schwer entscheiden, wem sie vertrauen können. Bei vielen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen verhalten sich die Patienten im sozialen Bereich auffällig. Beispiele dafür sind Schizophrenie, Depressionen, Alzheimer, Sozialphobien sowie die Huntington-Krankheit. Genau wie im Fall der gänzlich vertrauenslosen Menschen könnte auch bei solchen Leiden ein defektes Oxytozinsystem zu dem Krankheitsbild beitragen. Wenn es uns gelänge, dieses System besser zu verstehen, könnten wir daraus möglicherweise auch neue Therapieansätze für die Heilung entwickeln.
Die Oxytozinkonzentration verhält sich im ganzen Körper sehr dynamisch. Das Peptid wechselwirkt mit anderen Neurotransmittern und Hormonen, die selbst ihre Konzentration innerhalb von Minuten oder innerhalb eines Lebens verändern. So verstärkt beispielsweise Östrogen die Aufnahme von Oxytozin in das Gewebe, während Progesteron genau das Gegenteil bewirkt. Aus diesen Prozessen kann man schließen: Sowohl die Umwelt als auch innere physiologische Vorgänge beeinflussen unsere Bereitschaft, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Darüber hinaus vermuten wir, dass eigene Erfahrungen den Nullpunkt unseres Oxytozinregelkreislaufs verschieben können.
Das würde auch erklären, warum sich unsere Grundeinstellung, wie leicht wir anderen Menschen vertrauen, im Lauf des Lebens ändern kann. Möglicherweise wird mehr Oxytozin freigesetzt, wenn wir Vertrauen erleben und uns dabei in einer sicheren und fürsorglichen Umgebung befinden. Die Folge wäre, dass wir dann auch eher geneigt wären, uns auf andere Menschen einzulassen. Faktoren wie Stress, Unsicherheit und Isolierung von anderen verhindern, dass sich eine vertrauensvolle Grundeinstellung entwickelt. Mit weiterer Forschung werden wir verstehen, wie wir mit Hilfe eines einfachen Peptids für völlig fremde Menschen empfinden und ihnen vertrauen.
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben