November 1992: Molekulare Grundlagen des Lernens
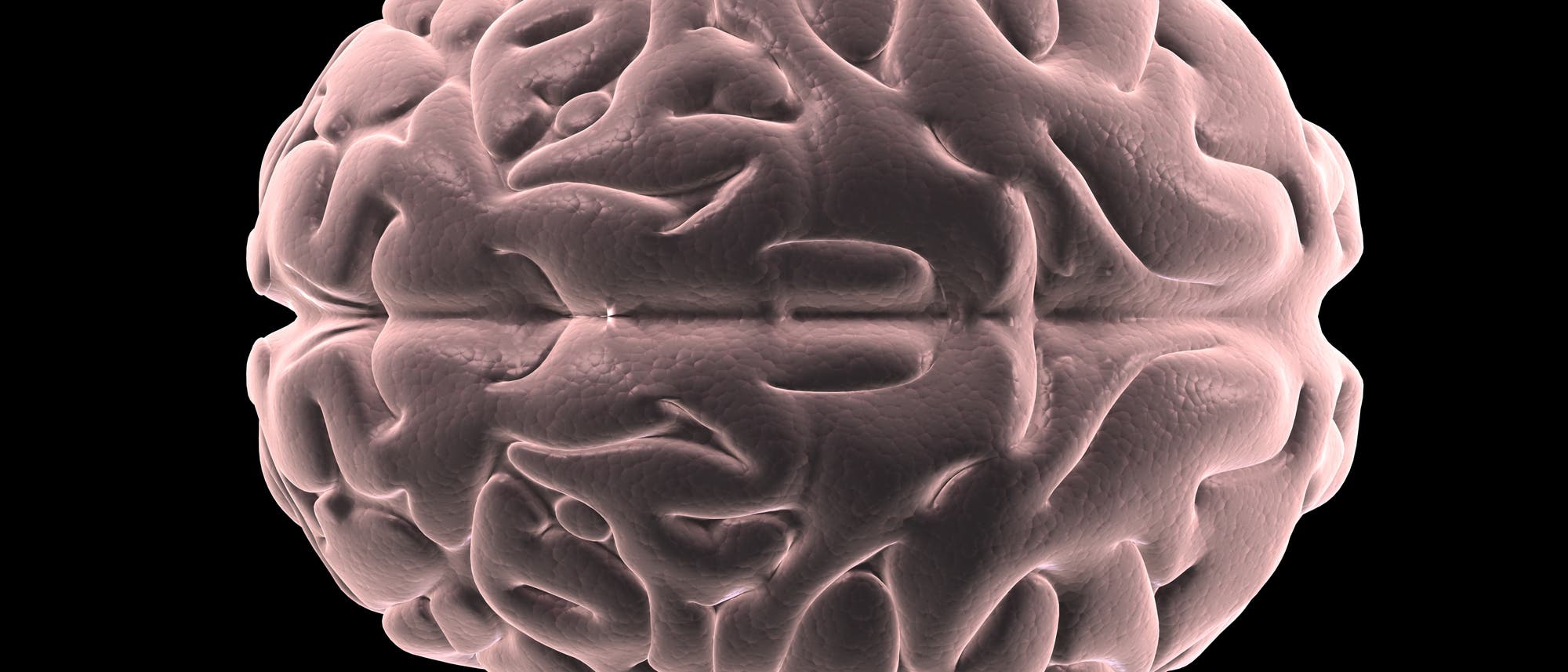
In den letzten Jahrzehnten sind zwei ursprünglich getrennte Wissenschaftsgebiete erst allmählich, dann aber immer schneller zusammengewachsen: die Neurobiologie, also die Wissenschaft vom Gehirn, seinem Aufbau und seinen Strukturen, und die kognitive Psychologie, die sich mit den geistigen Prozessen befaßt. Als Ergebnis hat sich ein neuer wissenschaftlicher Rahmen zur Erforschung von Phänomenen wie Wahrnehmung, Sprache, Gedächtnis, Denken oder Bewußtsein herausgebildet: Man vermag nun solche mentalen Funktionen auch auf ihr biologisches Substrat hin zu untersuchen.
Dazu gehört auch das Lernen. Was an Erkenntnissen darüber in den letzten Jahren gewonnen worden ist, demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des neuen Ansatzes. Elementare Aspekte, einzelne Schritte der für verschiedene Lernformen wichtigen neuronalen Mechanismen, lassen sich heute detailliert auf zellulärer und sogar molekularer Ebene untersuchen. Die Erforschung des Lernens könnte zum erstenmal einen Einblick in die an einem mentalen Geschehen beteiligten molekularen Prozesse erlauben. Vielleicht finden sich so die ersten Bausteine zu einem Brückenschlag zwischen Kognitionspsychologie und Molekularbiologie.
Unter Lernen versteht man den Erwerb neuen Wissens, unter Gedächtnis die Fähigkeit, dieses Wissen wiederfindbar zu bewahren. Das meiste, was wir von der Welt wissen, haben wir gelernt. Somit sind Lernen und Gedächtnis zum einen wesentlich für das, was die Individualität jedes einzelnen ausmacht, zum anderen sind es überindividuelle Funktionen, durch die kulturelle Inhalte von Generation zu Generation tradiert werden. Lernen ist unerläßlich für flexible Verhaltensanpassung und zugleich eine treibende Kraft des sozialen Fortschritts. Darum bedeutet Gedächtnisverlust, die Verbindung zu seinem Selbst, seiner Vergangenheit und seiner Umwelt samt den Mitmenschen zu verlieren.
Bis Mitte dieses Jahrhunderts hielten die meisten Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung von Verhalten befaßten, das Gedächtnis nicht für eine eigene geistige Funktion, nicht für etwas, das unabhängig ist von Bewegung. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit oder Sprache. Diese Phänomene bestimmten Hirngebieten zuzuordnen war schon länger gelungen; ob gleiches jemals für das Gedächtnis möglich sein würde, schien zweifelhaft.
Der erste, der auf eine derartige Region stieß, war der Neurochirurg Wilder G. Penfield am Neurologischen Institut in Montreal (Kanada). In den vierziger Jahren begann er, wenn er Epileptiker operierte, an der freigelegten Hirnrinde mit Hilfe schwacher Stromstöße die für Bewegung. Wahrnehmung und Sprache wichtigen Areale abzugrenzen, ehe er den Anfallsherd auszuschalten versuchte. Weil das Gehirn selbst nicht schmerzempfindlich ist, lassen sich solche Eingriffe unter lediglich örtlicher Betäubung durchführen. Der Patient bleibt also wach und kann mitteilen, was er bei Reizung verschiedener Stellen verspürt.
Penfield tastete Oberflächenbereiche der Hirnrinde von mehr als tausend Patienten ab. Gelegentlich rief der elektrische Reiz ein früheres Erlebnis hervor: Der Patient erinnerte sich in allen Einzelheiten an eine bestimmte Begebenheit. Diese gedächtnisartigen Reaktionen wurden nun ausnahmslos bei Stimulation der Schläfenlappen evoziert.
Weitere Hinweise, daß die Schläfenlappen beim Gedächtnis eine Rolle spielen, fand man Mitte der fünfziger Jahre bei einigen wenigen Epileptikern, denen beidseits der Hippocampus und die angrenzenden Gebiete der Schläfenlappen entfernt worden waren. Der erste und am gründlichsten untersuchte Patient war ein 27 Jahre alter Fließbandarbeiter. H. M., von dem Brenda Milner vom Neurologischen Institut in Montreal berichtete. Er hatte seit mehr als zehn Jahren unter unbehandelbaren, kräftezehrenden epileptischen Anfällen gelitten, die von den Schläfenlappen ausgingen. William B. Scoville, der Operateur, schnitt dem Kranken den der Hirnmittelachse zugewandten Bereich beider Schläfenlappen heraus. Daraufhin besserte sich die Epilepsie tatsächlich erheblich. Jedoch zeigte sich gleich nach der Operation eine andere schwere Beeinträchtigung: H. M. litt nun an einer verheerenden Gedächtnisstörung – er hatte die Fähigkeit verloren, irgend etwas Neues länger zu behalten, also im Langzeitgedächtnis zu speichern.
Was er früher gewußt hatte, war dagegen noch abrufbar. Er kannte seinen Namen, meisterte die Sprache und behielt auch seinen Wortschatz bei ; sein Intelligenzquotient entsprach durchaus dem guten Durchschnitt. Er erinnerte sich genau an Geschehnisse vor der Operation, so an seine frühere Arbeit, und konnte sich lebhaft Kindheitserlebnisse in Erinnerung rufen. Auch sein Kurzzeitgedächtnis – es hat die Funktion, Wahrnehmungen einige Augenblikke oder Minuten lang zu behalten – war völlig intakt. H. M. war es allerdings unmöglich, Eindrücke aus dem Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Zum Beispiel konnte er sich normal mit dem Krankenhauspersonal unterhalten, aber nie jemanden wiedererkennen, auch nicht die Menschen, die er jeden Tag sah.
Zunächst dachte man, die Gedächtnisstörung nach einer Operation beider Schläfenlappen würde alles Lernen gleichermaßen betreffen. Doch vermochten die Patienten, wie Brenda Milner bald feststellte, trotz aller Ausfälle infolge des Eingriffs ganz bestimmte Typen von Lernaufgaben weiterhin zu meistern, geradesogut wie Gesunde, und das Gelernte dann lange Zeit zu behalten. H. M. eignete sich beispielsweise neue Bewegungsabläufe durchaus normal an. Wie Brenda Milner und danach auch Elizabeth K. Warrington vom Nationalen Krankenhaus für Nervenkrankheiten in London sowie Lawrence Weiskrantz von der Universität Oxford (England) feststellten, können die Patienten auch für solche Lerninhalte ein Gedächtnis haben, die sich auf vergleichsweise einfache Art einprägen, etwa weil dabei nur ein Reflex in seiner Stärke zu verändern ist; zu solch elementaren Arten des Lernens gehören die Habituation (Reizgewöhnung), Sensitivierung (Empfindlichkeitssteigerung) und die klassische Konditionierung (das assoziative Verknüpfen von Reiz und Reaktion in Nervenbahnen).
Explizites und implizites Lernen
Aus diesen Befunden ließ sich schließen, daß es offensichtlich grundsätzlich verschiedene Formen des Wissenserwerbs gibt. Auch wenn man bislang nicht weiß, wieviele Lern und Gedächtnissysteme nun eigentlich existieren, besteht doch Konsens darüber, daß die Ausfälle bei Schädigungen der Schläfenlappen Lern und Gedächtnisformen betreffen, die bewußtes Registrieren eines Sachverhalts erfordern. Nach einem Vorschlag von Neal J. Cohen von der Universität von Illinois, Larry R. Squire von der Universität von Kalifornien in San Diego und Daniel L. Schacter von der Universität Toronto ( Kanada) nennt man diese Art Lernen und Gedächtnisaufbau deklarativ oder explizit. Dagegen geschieht das nichtdeklarative oder implizite Lernen und Gedächtnisbilden, das bei den operierten Epileptikern erstaunlicherweise völlig intakt blieb, ohne Beteiligung des Bewußtseins.
Explizites Lernen geht schnell: Es kann im Experiment schon während eines einzigen Versuchs stattfinden. Oft werden dabei gleichzeitig auftretende Reize verknüpft (assoziiert). Deshalb vermag man von einem bestimmten Ereignis die genauen Umstände und Einzelheiten im Gedächtnis zu behalten; so bleiben frühere Erlebnisse vertraut.
Implizites Lernen dagegen läuft langsam ab und erfordert, damit der Inhalt ins Gedächtnis übergeht, vielfache Wiederholung. Auch müssen die zu assoziierenden Reize oft zeitlich aufeinander abgestimmt erfolgen. Dieses Lernen vermittelt Wissen über vorhersagbare Beziehungen zwischen bestimmten Ereignissen.
Implizites Lernen zeigt sich vor allem darin, daß jemand etwas besser beherrscht als zuvor, ohne allerdings angeben zu können, was er nun eigentlich gelernt hat. Die beteiligten Gedächtnissysteme greifen auch nicht auf das Allgemeinwissen und frühere Erfahrungen eines Menschen zurück, bauen sie nicht mit ein, wie sich wiederum an Schläfenlappen-Operierten erkennen läßt. Denn fragt man jemanden wie N.M., warum er eine bestimmte Aufgabe nach fünf Tagen Übung besser beherrsche als zu Anfang, wird er etwa antworten: »Was meinen Sie eigentlich? Ich habe das noch nie gemacht.«
Durch explizites Lernen ein Gedächtnis aufbauen können Säugetiere nur mittels Strukturen in den Schläfenlappen (andere Tiere mit hoch entwickeltem Lernvermögen nur mit analogen Hirnstrukturen). Dagegen sind für das durch implizites Lernen aufgebaute Gedächtnis vermutlich die durch die jeweilige Lernsituation aktivierten sensorischen und motorischen Systeme im Gehirn selbst zuständig; daß auf diese Weise etwas aufgenommen und gespeichert wird, liegt an der ihnen inhärenten Plastizität. Deswegen findet sich diese Art des Gedächtnisaufbaus bei den verschiedensten Reflexsystemen sowohl von Wirbeltieren als auch von Wirbellosen – und hier schon stark ausgeprägt auf ziemlich einfachen Entwicklungsstufen.
Die Existenz zweier grundverschiedener Lernformen hat die Reduktionisten unter den Neurobiologen fragen lassen, ob sich nicht dazu eine Entsprechung auf zellulärer Ebene finden lasse. In beiden Fällen vermögen die gedächtnisaufbauenden neuronalen Systeme Information über die Assoziation von Reizen zu speichern. Aber funktionieren beide im zellulären Bereich nach denselben Regeln, oder hat jedes seine eigene?
Zwei zelluläre Mechanismen
Ursprünglich nahm man an, zum Aufbau eines assoziativen Gedächtnisses und zwar des impliziten wie des expliziten seien ziemlich komplexe neuronale Verschaltungen erforderlich. Einer der ersten, der diese Position angriff, war der Psychologe Donald 0. Hebb von der McGillUniversität in Montreal, bei dem auch Brenda Milner studiert hat. Hebb schlug einen einfachen zellulären chanismus für assoziatives Lernen vor. Eine Assoziation kann sich demnach durch gleichzeitige neuronale Aktivität ausbilden: »Erregt das Axon (die Nervenfaser, die Impulse weitergibt) einer Zelle A eine Zelle B und hat es wiederholt oder anhaltend am Feuern ( von anderen) auf Zelle B teil, dann finden in einer oder beiden Zellen Wachstumsprozesse oder Stoffwechselveränderungen statt, wodurch sich die Wirkung von A als einer der anfeuernden Zellen auf B verstärkt.« Der entscheidende Punkt nach der Hebb-Lernregel ist, daß die Aktivitäten der vor und der nachgeschalteten Zelle (des prä- und des postsynaptischen Neurons) zusammenfallen müssen, damit ihre Verbindung – die Synapse – stärker, also effizienter wird; man nennt dies präpostassoziativen Mechanismus.
Einen zweiten Mechanismus für assoziatives Lernen entwarfen 1963 Ladislav Taue und einer von uns (Kandel), als wir am Institut Marey in Paris forschten. Am Nervensystem der marinen Nacktschnekke Aplysia entdeckten wir, daß die synaptische Verbindung zwischen zwei Neuronen sich verstärken läßt, ohne daß die nachgeschaltete Zelle aktiv wäre; vielmehr muß dafür ein drittes Neuron auf die präsynaptische Zelle verschaltet sein und feuern. Diesen Dritten im Bunde nennen wir modulatorisches Neuron. Mit seiner Aktivität bewirkt es, daß das präsynaptische Neuron an den eigenen axonalen Endigungen mehr Transmitter (den jeweiligen Überträgerstoff an Synapsen ) ausschüttet. Nach diesem Modell sollte eine Assoziation stattfinden, wenn die Nervenimpulse in der präsynaptischen Zelle mit solchen in der modulatorischen einhergehen.
Dieser prämodulatorische assoziative Mechanismus wurde dann auch experimentell nachgewiesen – von uns und unseren Kollegen Thomas J. Carew und Thomas W. Abrams von der Columbia-Universität in New York sowie Edgar T. Walters und John H. Byrne vom Zentrum für Gesundheitswissenschaft der Universität von Texas in San Antonio. Wir fanden ihn bei Aplysia; bei dieser Schnecke wirkt er bei der klassischen Konditionierung mit, also bei einer Form impliziten Lernens.
Der von Hebb postulierte Mechanismus kommt, wie Holger J A. Wigström und Bengt E. W. Gustafsson von der Universität Göteborg (Schweden) dann 1986 nachwiesen, im Hippocampus von Säugetieren vor. Er dient dort synaptischen Veränderungen im Zusammenhang mit explizitem räumlichem Lernen. Somit waren für assoziatives Verknüpfen zwei verschiedene zelluläre Lernmechanismen gefunden. Weder implizites noch explizites Lernen erfordern demnach unbedingt die Beteiligung komplexer Neuronennetze. Vielmehr spiegelt die Fähigkeit, Assoziationen zu erkennen, möglicherweise nur die Fähigkeiten wider, die in gewissen zellulären Interaktionen selbst stecken.
Haben aber diese offenbar unterschiedlichen Lernmechanismen dennoch irgendwie miteinander zu tun? Bevor wir uns damit befassen, möchten wir beide erst einmal näher beschreiben, zuerst den prämodulatorischen Mechanismus, der bei einer klassischen Konditionierung von Aplysia eine Rolle spielt.
Einfaches Lernen bei einer Schnecke
Diesen Lerntyp hat als erster um die Jahrhundertwende der russische Physiologe Iwan Pawlow untersucht und gleich als einfachste Art des assoziativen Lernens erkannt. Bei der klassischen Konditionierung wird ein Reiz, der normalerweise eine bestimmte Reaktion – einen bestimmten Reflex – nicht oder nur relativ schwach auslöst, wiederholt zusammen mit einem Reiz präsentiert, der diese Reaktion – diesen Reflex – immer und leicht hervorbringt. Der von allein stark wirksame Stimulus heißt unkonditionierter oder unbedingter, der andere konditionierter ( richtiger wäre eigentlich: zu konditionierender) oder bedingter Reiz.
Nach einigen Versuchen löst auch der bedingte Reiz die Reaktion aus – oder, wenn er es vorher schon in geringem Maße tat, nun viel stärker: Konditionierung – Lernen – hat stattgefunden. Das Läuten einer Glocke beispielsweise kann für einen Hund zum bedingten Reiz werden und ihn ein Bein zurückzucken lassen, wenn der Ton wiederholt mit einem Schmerz am Bein (dem unbedingten Reiz) gepaart wurde. Damit eine Konditionierung dieser Art zustande kommt, muß allerdings der bedingte Reiz gewöhnlich dem unbedingten jedesmal um eine bestimmte Zeitspanne vorausgehen. Das Versuchstier (in vergleichbaren Experimenten auch der Mensch) lernt dann offenbar, einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den beiden Reizen herzustellen: Wird der eine verspürt, ist der andere auch gleich zu erwarten.
Das Zentralnervensystem von Aplysia weist nur etwa 20.000 Neuronen auf, von denen viele bereits funktional zugeordnet werden können und die zudem außerordentlich große Zellkörper haben. Es eignet sich darum besonders gut zur Untersuchung der klassischen Konditionierung und anderer noch einfacherer Mechanismen auf zellulärer Ebene. Das Tier zeigt eine Reihe einfacher unwillkürlicher Reaktionen, darunter den Kiemenrückziehreflex, der besonders gründlich untersucht ist: Normalerweise zieht es die Kiemen (das große Atmungsorgan auf dem Rücken) ein, wenn es etwa am Rand des Mantels, der die Kiemen schützt, oder an der Atemröhre – dem Siphon – gereizt wird.
Mantelrand und Siphon werden jeweils von einer eigenen Population von sensorischen Neuronen innerviert, die auf mechanische Reize ansprechen. Jede Population hat zum einen direkten Kontakt zu den für den Rückziehreflex zuständigen Motoneuronen der Kiemenmuskeln, zum anderen zu verschiedenen Klassen erregender und hemmender Zwischenneuronen, die auch auf die Motoneuronen verschaltet sind.
Wie wir und unsere Kollegen Carew und Walters herausfanden, läßt sich sogar dieser einfache Kietnenrückziehreflex konditionieren. Der bedingte Reiz kann etwa eine leichte Berührung des Siphons sein, der unbedingte zum Beispiel ein kräftiger Schmerzreiz – ein Elektroschock – am Schwanz. Eine Reizung des Mantelrandes unabhängig vom Schmerzreiz kann dann als Kontrollversuch dienen (sie wird dafür ebensooft ausgeübt wie die des Siphons, nur eben nicht gepaart mit dem Schmerzreiz am Schwanz).
Bereits nach jeweils fünf Versuchen ist die Reaktion auf den Siphonreiz allein bereits stärker als die auf den Mantelrandreiz. Man kann auch die Prozedur umkehren und nun die Berührung des Mantelrandes mit dem Schmerzreiz am Schwanz koppeln. Dann wird nach einigen Durchgängen die Reaktion auf alleinige Reizung des Mandelrandes stärker als die bei Reizung des Siphons. Diese differenzierte Reaktionsweise erinnert in mancher Hinsicht verblüffend an bestimmte Konditionierungsphänomene bei Wirbeltieren.
Wir wollten herausfinden, was dabei in den Neuronen der Schnecke im einzelnen geschieht, und konzentrierten uns dazu auf die Verschaltungen zwischen den Sinnesnervenzellen und ihren Zielzellen, den Moto und den Zwischenneuronen. Die Stimulation der Sinnesnervenzellen des Siphons beziehungsweise des Mantelrandes ruft bei beiden Sorten von Zielzellen erregende synaptische Potentiale hervor. Die Motoneuronen feuern daraufhin, erzeugen also ein Aktionspotential, und die Schnecke zieht nun ihre Kiemen ruckartig ein.
Der Schmerzreiz am Schwanz aktiviert verschiedene Neuronengruppen, von denen einige ebenfalls ein Einziehen der Kiemen veranlassen. Darunter sind wenigstens drei Gruppen modulatonischer Neuronen; eine davon benutzt Serotonin als Neurotransmitter, als Überträgerstoff an den Synapsen. Diese modulatorischen Neuronen sind auf die Sinnesnervenzellen von Siphon und Mantelrand verschaltet. Sie erzeugen durch ihre Aktivität an deren Synapsen eine sogenannte präsynaptische Bahnung, das heißt, die synaptischen Endigungen der Sinnesnervenzellen schütten nun leichter Transmitter aus. Diese Art – nichtassoziativen – Lernens heißt Sensibilisierung: Das Tier führt verschiedene Abwehrreflexe auf einen unangenehmen Reiz hin heftiger aus (siehe »Kleine Verbände von Nervenzellen« von Eric R. Kandel, Spektrum der Wissenschaft, November 1979, Seite 58). Eine Verknüpfung zweier Stimuli ist dafür nicht erforderlich.
Weil die modulatorischen Neuronen mit den Sinnesnervenzellen sowohl des Siphons als auch des Mantelrandes verschaltet sind, ist zu fragen, wie denn die spezifische Konditionierung von nur jeweils einem der beiden Reizwege zustande kommt. Hier erwies sich der Zeitfaktor als wichtige Einflußgröße. Wir haben schon erwähnt, daß bei der klassischen Konditionierung der bedingte Reiz dem unbedingten im allgemeinen um ein optimales, oft eng bemessenes Intervall vorausgehen muß – beim Kiemenrückziehreflex von Aplysia dem Schmerzreiz am Schwanz um etwa eine halbe Sekunde. Setzt man die gepaarten Reize in kürzerem oder längerem Abstand oder in umgekehrter Reihenfolge, gelingt die Konditionierung erheblich schlechter oder mißlingt gänzlich. Beim Kiemenrückziehreflex rührt das spezifische Timing unter anderem daher, daß die konditionierten wie die unkonditionierten Stimuli an individuellen Sinnesnervenzellen zusammenlaufen: Den konditionierten Reiz haben die Zellen selbst aufgenommen und repräsentieren ihn durch ihre Aktivität; der unkonditionierte, vom Schwanz kommende Stimulus wirkt sich auf sie durch die Aktivität der modulatorischen Neuronen aus, insbesondere jener, die Serotonin als Transmitter ausschütten.
Die präsynaptische Bahnung durch die letztlich vom Schmerzreiz aktivierten modulatorischen Neuronen erwies sich als stärker, wenn die stimulierten Sinnesnervenzellen von Mantelrand oder Siphon gerade selbst gefeuert hatten. Kommt hingegen das vom unbedingten Reiz ausgehende Signal bei den Sinnesnervenzellen schon an, bevor sie selbst auf den bedingten Reiz hin mit Aktionspotentialen geantwortet haben, hat es keine Wirkung.
Es handelt sich hier also um eine aktivitätsabhängige präsynaptische Bahnung. Weil dabei dieselbe zeitliche Abstimmung erforderlich ist wie auf Verhaltensebene bei der Konditionierung, könnte sie daraus erklärlich sein. Auch sieht es so aus, als handele es sich bei dem zellulären Mechanismus für die klassische Konditionierung im Falle des Kiemenrückziehreflexes um eine Weiterentwicklung der präsynaptischen Bahnung, wie sie bei der oben beschriebenen Sensibilisierung auftritt, der Verstärkung eines Reflexes bei wiederholter Reizung. Das war ein erster Anhalt für die Überlegung, daß Zellen gewissermaßen über ein Alphabet zum Lernen verfügen dürften, über einfache Mechanismen, aus denen sich durch Kombination oder Weiterentwicklung komplexere Lernformen ergeben könnten.
Molekulare Kaskaden und Schleifen
Als nächstes war zu klären, wieso die präsynaptische Bahnung durch den – unkonditionierten – Schwanzreiz stärker ausfällt, wenn die Sinnesnervenzellen im Mantelrand oder Siphon gerade gefeuert haben.
Wir hatten zuvor herausgefunden, daß das von den modulatorischen Neuronen freigesetzte Serotonin in den Sinnesnervenzellen eine Serie biochemischer Veränderungen einleitet. Das Serotonin bindet sich an einen Rezeptor auf der Sinneszelle, der daraufhin das Enzym Adenylatcyclase aktiviert. Dieses wandelt nun ATP (Adenosintriphosphat ; es gehört zu den Molekülen, die der Zelle Energie bereitstellen) in cyclisches AMP (Adenosinmonophospat ) um. Das cyclische AMP wirkt in der Zelle als sekundärer Botenstoff. (Als primäre Botenstoffe bezeichnet man unter anderem Neurotransmitter wie Serotonin. die zwischen Zellen vermitteln, als sekundäre Botenstoffe Substanzen, die innerhalb von Zellen Signale weitergeben.) Es aktiviert seinerseits eine Proteinkinase. ein Enzym, das anderen Proteinen eine Phosphatgruppe überträgt und sie dadurch aktiviert oder inaktiviert.
In diesem Falle phosphoryliert die Kinase Kaliumkanäle in der Zellmembran oder Proteine, die mit diesen Kanälen wechselwirken. Dies reduziert den Ausstrom von KaliumIonen, der normalerweise bewirkt, daß nach einem Aktionspotential an der Membran sogleich wieder die ursprünglichen Ladungsverhältnisse hergestellt werden. Der Effekt ist, daß das Aktionspotential länger anhält und dadurch auch die Calciumkanäle am Ende des Axons länger geöffnet bleiben – entsprechend mehr CalciumIonen können in die präsynaptische Endigung einströmen.
Calcium hat verschiedene zelluläre Funktionen. Unter anderem sorgt es dafür, daß die bläschenartigen Transmitterspeicher ihren Inhalt in den synaptischen Spalt entleeren. Wenn also wegen des länger anhaltenden Aktionspotentials mehr Calcium in das Axonende gelangt, werden auch mehr Transmittermoleküle freigesetzt.
Außerdem mobilisiert das Serotonin – ebenfalls über eine Proteinkinase-Aktivierung – Transmitterbläschen aus dem Vorrat der Zelle: Sie wandern zur Synapse hin, zu den spezifischen Stellen, wo sie später ihren Inhalt in den Spalt ausschütten können. So wird die Freisetzung von Transmitter unabhängig davon erleichtert, ob der Calcium-Einstrom zunimmt oder nicht. Bei diesem Vorgang wirkt cyclisches AMP parallel zu Proteinkinase C, einem weiteren sekundären Botenstoff. der ebenfalls von Serotonin aktiviert wird.
Wieso verstärkt nun ein Aktionspotential der Sinnesnervenzelle, das unmittelbar vor dem Signal des unbedingten Reizes an der Endigung eintrifft, die Wirkung von Serotonin? Bei einem Aktionspotential strömen Natrium und Calciumlonen in die Zelle ein und kurz danach KaliumIonen aus ihr aus; dadurch kehrt sich das Membranpotential kurzfristig um. Wie Abrams und einer von uns (Kandel) herausfanden, ist der Einstrom von CalciumIonen das Entscheidende für die aktivitätsabhängige Bahnung. Sie binden sich in der Zelle nämlich an Calmodulin, ein Protein, das nun die Aktivierung der Adenylatcyclase durch Serotonin verstärkt, so daß sie mehr cyclisches AMP bereitzustellen vermag.
Die Adenylatcyclase ist also für die aktivitätsabhängige Bahnung ein Schlüsselglied: Dadurch, daß sich an diesem einen Enzym zwei unterschiedliche Signale – über die Calciumtonen und über Serotonin – auswirken, laufen die vom bedingten und vorn unbedingten Reiz ausgelösten molekularen Reaktionen in der Zelle zusammen. Das 0,5-SekundenIntervall zwischen diesen beiden Reizen – die Voraussetzung für Lernen beim Kiemenrückziehreflex – entspricht möglicherweise der Zeit, in der sich das Calcium in der Zelle anreichert, an Calmodulin anlagert und in Form dieses Komplexes die Adenylatcyclase ansprechbarer macht, so daß sie in Reaktion auf Serotonin dann mehr cyclisches AMP (CAMP) als sonst produziert. Die aktivitätsabhängige Verstärkung des cAMP-Weges ist durchaus nicht für Aplysia spezifisch. Auf einen ähnlichen molekularen Mechanismus für Konditionierung weisen auch genetische Untersuchungen bei der Taufliege Drosophila hin. Dieses kleine Insekt läßt sich normalerweise ebenfalls konditionieren. Es wurden aber Mutanten mit einem einzigen veränderten Gen gefunden, die einen Lerndefekt haben.
Eine solche Mutante, rutabaga genannt, haben William G. Quinn vorn Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Margaret Livingstone von der benachbarten HarvardUniversität und Yadin Dudai vorn WeizmannInstitut für Wissenschaft in Rehovot (Israel) untersucht.
Das Gen codiert für eine calciumcalmodulinabhängige Adenylatcyclase; sie läßt sich bei den Mutanten nicht mehr von dem CalciumCalmodulinKomplex stimulieren. Ronald L. Davis und seine Kollegen am ColdSpringHarborLaboratorium (Bundesstaat New York) haben nun festgestellt, daß diese Adenylatcyclase insbesondere in einer speziellen Struktur des Fliegengehirns vorkommt: in den Pilzkörpern, die für verschiedene Formen assoziativen Lernens erforderlich sind. Mithin weisen sowohl die zeltbiologischen Untersuchungen an Aplysia als auch die genetischen an Drosophila darauf hin, daß das molekulare System der Nervenzellen, in dem das cyclische AMP als sekundärer Botenstoff wirkt, für bestimmte elementare Formen von implizitem Lernen und Gedächnisaufbau bedeutsam ist.
Neuroplastizität im Hippocampus von Säugetieren
Welche zellulären Entsprechungen gibt es beim expliziten Lernen, also bei komplexeren Formen assoziierenden Verknüpfens? Die Mechanismen müßten sich von denen für implizites Lernen unterscheiden, denn anders als bei der klassischen Konditionierung gelingt explizites Lernen oft dann am besten, wenn die beiden zu assoziierenden Ereignisse simultan stattfinden. Ein flüchtig bekanntes Gesicht beispielsweise erkennt man leichter wieder, wenn man den Menschen im selben Umfeld wiedersieht. Das Gedächtnis hat sich die Stimuli von beidem eingeprägt und kann die Erinnerung an die Person leichter im Zusammenhang abrufen.
Wie eingangs ausgeführt, sind beim Menschen für explizites Lernen die Schläfenlappen unentbehrlich. Zunächst war allerdings nicht klar, von welcher Größe an beidseitige Schädigungen die Gedächtnisbildung merklich stören. Hilfreich waren hier Untersuchungen sowohl am Menschen wie an Versuchstieren. Mortimer Mishkin von den amerikanischen National Institutes of Health in Bethesda (Maryland) sowie Squire, David G. Amaral und Stuart Zola-Morgan von der Universität von Kalifornien in San Diego folgerten daraus, der Hippocampus, ein halbmondförmig gekrümmter Wulst am inneren Rand der nach unten eingerollten Schläfenlappen, sei beim Gedächtnis entscheidend beteiligt. Allerdings beeinträchtigen Hippocampus-Läsionen lediglich das Abspeichern neuer Gedächtnisinhalte; denn Patienten wie H. M. erinnern sich an frühere Erlebnisse gut.
Der Hippocampus scheint für das Langzeitgedächtnis nur ein Zwischenspeicher zu sein. Er bewahrt und verarbeitet die neu erlernte Information lediglich einige Wochen oder Monate und überführt sie dann zum dauerhafteren Abspeichern in dafür zuständige Areale der Großhirnrinde (siehe den Beitrag von Antonio R. Damasio und Hanna Damasio auf Seite 80). Auf diese Speicher hat dann das sogenannte Arbeitsgedächtnis des präfrontalen Cortex Zugriff (siehe den Beitrag von Patricia S. GoldmanRakic auf Seite 94).
Timothy Bliss und Terje Lorno, die damals in Per Andersens Labor in Oslo arbeiteten, wiesen 1973 erstmals nach, daß Neuronen im Hippocampus beträchtliche plastische Eigenschaften haben, die sie für Lernvorgänge prädestinieren. Durchläuft eine kurze, hochfrequente Salve von Aktionspotentialen eine der Hippocampus-Bahnen, werden die darin eingeschalteten Synapsen stärker. Bei narkotisierten Tieren hält dieser Effekt einige Stunden an, bei wachen Tieren, die sich frei bewegen dürfen, Tage und sogar Wochen.
Bliss und Lorno nannten den Verstärkungseffekt Langzeitpotenzierung (englisch longterm potentiation, LTP). Sie hat, wie sich später zeigte, an den verschiedenen Synapsentypen des Hippocampus unterschiedliche Eigenschaften. Wir werden uns hier auf einen bestimmten assoziativen Typ der Potenzierung beschränken, bei dem die assoziative Verknüpfung gemäß dem Hebbsehen Modell vor sich geht: Für die Bahnung der Synapse müssen vor und nachgeschaltetes Neuron gleichzeitig aktiv sein. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Spezifität – die Langzeitpotenzierung betrifft nur Synapsen der stimulierten Nervenbahnen.
Wieso müssen dafür die prä- und postsynaptischen Neuronen gleichzeitig feuern? Als Transmitter fungiert in den Hauptnervenbahnen des Hippocampus die Aminosäure Glutamat. Sie bewirkt eine Langzeitpotenzierung, indem sie sich an spezifische Rezeptoren der Zielzellen (der postsynaptischen Zellen) bindet. Davon gibt es zwei relevante Arten: die NMDA-Rezeptoren (benannt nach der synthetischen Substanz N-Methyl-D-Aspartat, die sich gleichfalls anlagern kann) und die Nicht-NMDA-Rezeptoren.
Letztere dominieren bei den meisten synaptischen Übertragungen, weil die mit den NMDA-Rezeptoren assoziierten lonenkanäle normalerweise von Magnesium-Ionen blockiert sind und erst freigegeben werden, wenn die Membran der postsynaptischen Zelle depolarisiert wird. Zudem müssen für eine optimale Aktivierung der NMDA-Rezeptorkanäle in der postsynaptischen Zelle die beiden Signale zeitlich zusammentreffen – Glutamat muß sich also an den Rezeptor binden, während die Zelle depolarisiert ist.
Demnach hat der NMDA-Rezeptor – wie die Adenylatcyclase bei Aplysia die assoziative Eigenschaft, Koinzidenzen zu erkennen. Seine andere zeitliche Charakteristik hingegen, daß die Aktivierung gleichzeitig (nicht nacheinander wie bei Aplysia) stattfinden muß, macht ihn eher für explizite als für implizite Lernformen geeignet.
Behalten des Gelernten
Entscheidend für eine Langzeitpotenzierung ist nämlich, daß durch die entblockierten NMDA-Rezeptorkanäle Calcium in die postsynaptische Zelle strömt. Das haben Gary Lynch von der Universität von Kalifornien in Irvine sowie die Gruppe von Roger A. Nicoll und Robert S. Zucker an der Universität von Kalifornien in San Francisco gezeigt. Calcium evoziert eine Langzeitpotenzierung. indem es mindestens drei Typen von Proteinkinasen aktiviert.
Während die Einleitung einer Langzeitpotenzierung offensichtlich auf den bisher beschriebenen Prozessen – postsynaptische Depolarisation, CalciumEinstrom und dann Aktivierung der Proteinkinasen – beruht, muß zu ihrem Erhalt die präsynaptische Endigung mehr Transmitter ausschütten. Dies haben mehrere Arbeitsgruppen nachgewiesen, so Bliss und seine Kollegen, John Bekkers und Charles Stevens vom SalkInstitute für Biologische Studien in San Diego (Kalifornien) sowie Roberto Malinow und Richard Tsien von der Universität Stanford ( Kalifornien).
Bedarf es zum Aufbau einer Langzeitpotenzierung eines postsynaptischen Ereignisses, zum Weiterbestehen aber eines präsynaptischen, dann muß – wie als erster Bliss anmerkte – irgendein Signal vom nach zum vorgeschalteten Neuron gelangen. Eben das ist für die Neurowissenschaftler ein Problem.
Der spanische Mediziner und Histologe Santiago Ramön y Cajal (1852 bis 1934; er erhielt 1906 zusammen mit Camillo Golgi den Nobelpreis für Medizin) hatte den Grundsatz aufgestellt, daß Nervenzellen polar funktionieren, also Signale immer nur in einer Richtung fortleiten; und seither haben sich auch sämtliche untersuchten chemischen Synapsen als polar erwiesen. (Chemische Synapsen heißen solche, die zur Signalübertragung einen Transmitterstoff ausschütten.)
Bei der Langzeitpotenzierung zeichnet sich nun ein anderes, früher nicht bekanntes Prinzip neuronaler Kommunikation ab. Die durch Calcium aktivierten Prozesse in der nachgeschalteten Zelle, vielleicht auch diese Ionen selbst, scheinen zu bewirken, daß die nachgeschaltete Zelle in aktivem Zustand einen quasi rückwärts wirkenden Plastizitätsfaktor freisetzt, der in die vorgeschaltete Nervenendigung diffundiert und dort einen oder auch mehrere sekundäre Botenstoffe aktiviert. Diese steigern dann den Transmitterausstoß – so bleibt die Langzeitpotenzierung erhalten.
Die postsynaptischen Endigungen können einen solchen Faktor allerdings nicht wie die präsynaptischen ihren Transmitter in besonderen Vesikeln anreichern und bei Bedarf an dazu geeigneten Membranstrukturen freisetzen; ihnen fehlt jegliches spezielle Gebilde dafür. So kam die Idee auf, bei dem rückwärts wirkenden Botenstoff könne es sich um eine Substanz handeln, die schnell aus der Zelle und über den synaptischen Spalt in die vorgeschaltete Nervenendigung diffundiert. Bis 1991 hatten mehrere Forschergruppen Hinweise darauf gefunden, daß der gesuchte Stoff Stickstoffmonoxid sein könne, darunter Thomas J. O'Dell und Ottavio Arancio in unserem Labor (siehe auch »Stickstoffmonoxid – Regulator biologischer Signale« von Solomon H. Snyder und David S. Bredt, Spektrum der Wissenschaft, Juli 1992, Seite 72): Das Einsetzen einer Langzeitpotenzierung ließ sich verhindern, indem die Synthese von Stickstoffmonoxid im nachgeschalteten Neuron unterbunden und auch, indem diese Verbindung im Zellaußenraum abgefangen wurde. Umgekehrt bewirkte die Zugabe von Stickstoffmonoxid, daß die präsynaptische Zelle mehr Transmitter freigab.
Als wir sowie Scott A. Small und Min Zhuo Gewebescheiben des Hippocampus mit Stickstoffmonoxid versetzten, entdeckten wir zu unserer Überraschung, daß die Substanz nur dann eine Langzeitpotenzierung bewirkt, wenn zur gleichen Zeit die präsynaptischen Neuronen aktiv sind; auch bei Aplysia war ja die präsynaptische Bahnung von der eigenen Aktivität der Zelle abhängig gewesen. Vielleicht kommt es auch im Hippocampus außerdem auf den Calcium-Einstrom in die präsynaptische Zelle an.
Es sieht mithin so aus, daß bei der Langzeitpotenzierung zwei an sich unabhängige assoziative synaptische Lernmechanismen kombiniert werden: ein Hebbscher NMDA-Rezeptor-Mechanismus und ein aktivitätsabhängiger präsynaptischer Bahnungsmechanismus. Die Hypothese besagt, daß die Aktivierung der NMDA-Rezeptoren auf den postsynaptischen Neuronen ein auf die vorgeschaltete Zelle rückwirkendes Signal erzeugt, dessen Träger wahrscheinlich Stickstoffmonoxid ist. Dieses Signal setzt einen aktivitätsabhängigen Mechanismus in Gang, der das Freisetzen von Transmittersubstanz aus den präsynaptischen Endigungen erleichtert.
Allgemeine zellinhärente Prinzipien für Lernen?
Was könnte der funktionale Vorteil davon sein, daß zwei verschiedene assoziative Zellmechanismen in dieser Weise zusammenwirken? Eine in die präsynaptischen Endigungen diffundierende Substanz könnte theoretisch auch in benachbarte Nervenbahnen gelangen. Tatsächlich zeigen Untersuchungen von Tobias Bonhoeffer und seinen Kollegen am MaxPlanckInstitut für Hirnforschung in Frankfurt, daß eine in einer postsynaptischen Zelle induzierte Langzeitpotenzierung durchaus auf benachbarte postsynaptische Zellen übergreift. Der Umstand, daß die präsynaptische Bahnung aktivitätsabhängig ist, könnte des weiteren sicherstellen, daß nur bestimmte präsynaptische Signalwege – nämlich die aktivierten – verstärkt werden.
Daß in den behandelten Fällen impliziten wie expliziten Lernens offensichtlich Veränderungen an Synapsen eine Rolle spielen. eröffnet eine überraschende reduktionistische Perspektive. Da assoziative synaptische Veränderungen anscheinend keine komplexen neuronalen Netzwerke erfordern, könnten diese Lernformen eine direkte Entsprechung in den Grundeigenschaften von Zellen haben. Und diese Eigenschaften scheinen, zumindest in den beschriebenen Fällen, wiederum auf Eigenschaften bestimmter Proteine – der Adenylatcyclase beziehungsweise des NMDA-Rezeptors – zu beruhen, die nachweislich auf zwei unabhängige Signale ansprechen können (wie die vom bedingten und vom unbedingten Reiz).
Gewiß sind diese molekularen Vorgänge nicht von dem vielfältigen übrigen Geschehen in und zwischen Neuronen isoliert. Diese Zellen wiederum sind Komponenten von Netzen mit beträchtlicher Redundanz, Parallelität und Verrechnungskapazität, so daß die elementaren Mechanismen im Zusammenhang der hochkomplexen Strukturen und Funktionen zu sehen sind.
Daß im Hippocampus als einem maßgeblichen gedächtnisbildenden Organ Langzeitpotenzierung stattfindet, ließ fragen, ob diese auch etwas mit der Gedächtniskonsolidierung in dieser Hirnregion zu tun habe. Hinweise darauf fanden Richard Morris und seine Kollegen an der Medizinischen Fakultät der Universität Edinburgh. Blockierten sie im Hippocampus von Versuchstieren die NMDA-Rezeptoren, versagten die Tiere bei einer bestimmten räumlichen Aufgabe. Demnach dürften zumindest am räumlichen Lernen Mechanismen beteiligt sein, bei denen die NMDA-Rezeptoren involviert sind; und somit könnte auch Langzeitpotenzierung dabei mitspielen.
Noch haben wir offengelassen, durch welche Mechanismen die synaptischen Veränderungen beim expliziten und impliziten Lernen gefestigt werden und wie schließlich ein langanhaltendes Gedächtnis entsteht.
Wie Experimente mit Aplysia und auch mit Säugetieren zeigen, erfolgt die Konsolidierung in Stufen. Die Anfangsphase, eine Form des Kurzzeitgedächtnisses, hält einige Minuten bis Stunden an; unter anderem verändert sich dabei, wie beschrieben, die Stärke vorhandener synaptischer Verbindungen. Am selben Ort treten zwar auch die langanhaltenden, Wochen oder Monate bleibenden Veränderungen auf. Diese Form des Speicherns erfordert aber völlig anders geartete Vorgänge, nämlich die Aktivierung von Genen, die Expression bestimmter Proteine und das Wachstum neuer synaptischer Verbindungen. Bei Aplysia vermehren sich die präsynaptischen Endigungen, wenn Reizkonstellationen eine langfristige Sensibilisierung oder klassische Konditionierung bewirken; dies haben das Team von Craig H. Bailey, Mary C. Chen und Samuel M. Schacher an der Columbia-Universität sowie Byrne und seine Kollegen zeigen können. Im Hippocampus von Säugetieren treten nach Langzeitpotenzierung ähnliche anatomische Veränderungen auf.
Individualität: immerwährende Feinanpassung
Bedeutet dies, daß sich anatomisch stets etwas im Gehirn ändert, wenn wir etwas lernen oder vergessen ? Widerfährt uns das beispielsweise, wenn wir dieses Heft lesen und uns einiges daraus merken? Viele Forscher haben sich schon damit befaßt, aber zum vielleicht Aufregendsten gehört. was Michael Merzenich und seine Kollegen von der Universität von Kalifornien in San Francisco entdeckt haben. Sie untersuchten die Repräsentation der Hand in der sensorischen Großhirnrinde bei Affen. Die Hautempfindungen der einzelnen Körperpartien und eben auch der Finger sind dort Arealen zugeordnet. Bislang galt. daß diese Karte, nachdem sie einmal entstanden ist, lebenslang unverändert bleibt. Doch in Wirklichkeit wandelt sie sich fortwährend. je nach Gebrauch der sensorischen Bahnen.
Jeder von uns wächst in einer anderen Umgebung auf, ist anderen Reizen ausgesetzt und beansprucht seine sensorischen und motorischen Fähigkeiten auf andere Art. Entsprechend wird, auch noch im Erwachsenenalter, die Feinarchitektur des Gehirns bei jedem Individuum auf immer etwas andere Weise abgewandelt. Unsere Individualität beruht nicht nur darauf, daß sich alle Menschen in ihrer genetischen Ausstattung unterscheiden. sondern auch auf solchen fortwährenden Entwicklungsprozessen.
Dazu lieferte Merzenich eindrucksvolle Daten. Er brachte einem Affen bei, eine Scheibe nur mit den drei mittleren Fingern der einen Hand zu drehen. Nach einigen tausend Rotationen (mehreren Monaten täglich ein bis zwei Stunden Übens ) waren die Hirnareale, die diese Finger repräsentieren, größer geworden, teilweise auf Kosten der anderen.
Welche Mechanismen könnten solche Veränderungen bewirken? Nach neueren Befunden scheinen sich die Nervenverknüpfungen in der somatosensorischen Hirnrinde (der Körperfühlsphäre, wo auch die Sinnesempfindungen der Haut eingehen) immerfort leicht umzuorganisieren und zu aktualisieren, und zwar gemäß korrelierter Aktivität. Der beteiligte Mechanismus ähnelt offenbar dem für Langzeitpotenzierung.
Erste Ergebnisse von zellbiologischen Studien zur Gehirnentwicklung (vergleiche hierzu den Beitrag von Carla J. Shatz auf Seite 44) lassen vermuten, daß die aufgefundenen Lernmechanismen auch auf anderen neurobiologischen Forschungsfeldern weiterhelfen. Daß die Feinabstimmung der Neuronenkontakte in späteren Entwicklungsstadien möglicherweise einen aktivitätsabhängigen assoziativen synaptischen Mechanismus erfordern könnte, der dem für Langzeitpotenzierung ähnelt, ist eine durchaus berechtigte Annahme.
Sollte das auch auf molekularer Ebene gelten, sollten also bei der Entwicklung und Ausdifferenzierung des Gehirns teilweise die gleichen molekularen Prozesse ablaufen wie beim Lernen, dann würde die Lernforschung dazu beitragen. die kognitive Psychologie und die Molekularbiologie auch des menschlichen Organismus in weit umfassenderer Weise als bisher zusammenzubringen. Unter einem solchen einheitlichen Forschungsansatz würde auch die Entmystifizierung geistiger Prozesse rascher vorankommen. Dann fänden diese Untersuchungen ihr rechtes Umfeld – in dem an der Evolution orientierten Gedankengebäude der Biologie.
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben