Anthropologie: Die Urahnen der großen Mythen
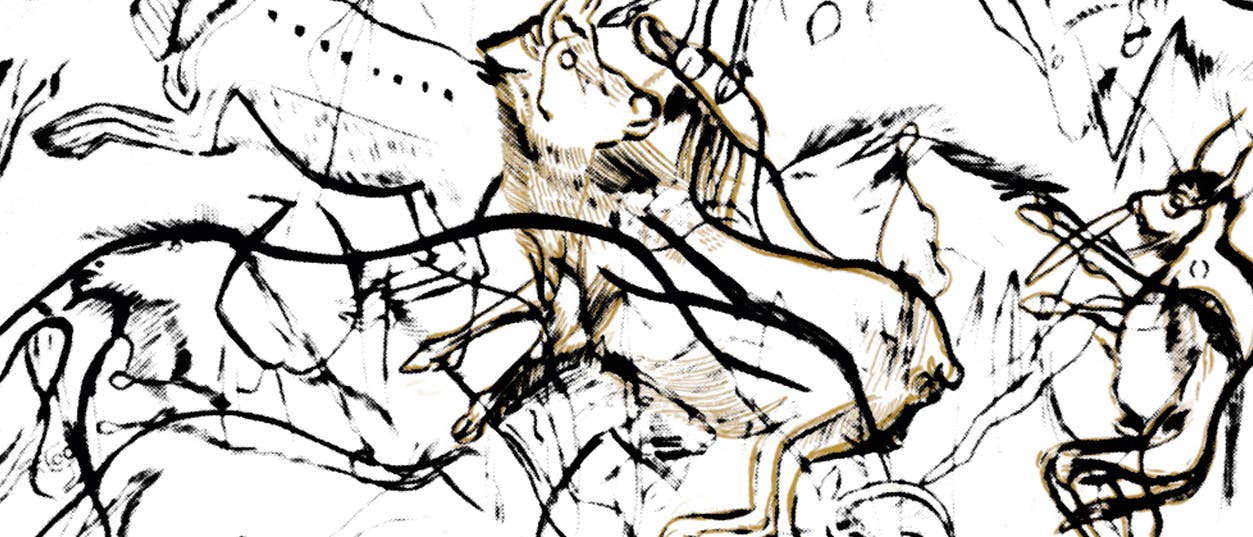
Einst begehrte Zeus, der Herr des Olymps, die schöne Nymphe Kallisto. Diese gehörte aber zum Gefolge der Jagdgöttin Artemis und war daher zur Keuschheit verpflichtet. Doch Zeus näherte sich der Nymphe in der Gestalt ihrer Herrin. Zu spät erkannte Kallisto den Betrug. Sie vermochte sich des mächtigen Gottes nicht zu erwehren. Die Schwangere wurde anschließend von Artemis verstoßen und nach der Niederkunft noch von Hera, der Gattin des Zeus, in eine Bärin verwandelt. Eines Tages stieß sie auf ihren Sohn Arcas, aus dem ein mutiger Jäger geworden war. Als der sich anschickte, die vermeintliche Bestie zu töten, griff Zeus ein und versetzte beide als Sternbilder an das nächtliche Firmament. Wir kennen sie unter den Namen Großer und Kleiner Bär.
Diese dramatische Erzählung aus der griechischen und römischen Antike klingt überraschenderweise auch in vielen Mythen anderer Völker der Welt an. Die in Sibirien lebenden Tschuktschen etwa deuten das Sternbild des Orion als einen Jäger, der ein Rentier verfolgt. Es entspricht dem einem »W« gleichenden Sternbild, das im Westen Kassiopeia heißt. In der obugrischen Tradition verfolgt der Jäger einen Elch, repräsentiert durch unseren Großen Bären. Eine solche »Kosmische Jagd« kennen auch Völker in Afrika und in der Neuen Welt. Bei den Irokesen im Nordosten Amerikas etwa jagen und verwunden drei Jäger einen Bären. Dessen Blut färbt die Blätter des Herbstwalds. Doch das Tier erklimmt einen Berg und springt von dort an den Himmel. Bär und Jäger verschmelzen daraufhin zum Sternbild des Großen Bären.
Projektionsfläche Sternenhimmel
Dass Menschen am Sternenhimmel Gestalten wahrnehmen, ist eine Eigenheit unseres kognitiven Systems, die wohl einen Überlebensvorteil bot: Wer ein im Blattwerk des Urwalds verborgenes Raubtier ausmachte, konnte sich in Sicherheit bringen. Dass manche Kulturen andere Konstellationen mit den jeweiligen Beutetieren identifizierten, verwundert nicht weiter. Interessant ist die bei allen Variationen auffallende grundlegende Struktur: Ein Jäger verfolgt oder erlegt ein Tier; beide werden zu Sternbildern. Viele Forscher betrachten daher die verschiedenen Erzählungen als Vertreter einer weltweiten Mythenfamilie: der »Kosmischen Jagd«.
Eine nahe liegende Erklärung dieses Phänomens wäre eine universelle Eigenschaft der menschlichen Psyche, die eine solche Geschichte als Erklärung der kosmischen Konstellationen bei Jäger-und-Sammlervölkern geradezu zwingend hervorbringt (bäuerliche Gesellschaften erkennen in Sternbildern eher domestizierte Tiere). Doch warum fehlen entsprechende Erzählungen in den mündlichen Traditionen Indonesiens, Papua-Neuguineas und Australiens? Ethnologen und Anthropologen der so genannten historisch-geografischen Theorie glauben, dass die Familie »Kosmische Jagd« auf eine Urerzählung zurückgeht, die sich weltweit über einen sehr langen Zeitraum ausgebreitet hat. So waren Eurasien und Nordamerika 25 000 bis 14 000 v. Chr. durch eine Landbrücke verbunden, was Migrationen ermöglichte. Genetische Studien bestätigen, dass die meist als Präclovis bezeichneten ersten Siedler Amerikas aus Ostasien stammten. Geht die traurige Geschichte um Kallisto also auf einen Mythos zurück, den sich Menschen schon in der Altsteinzeit am Lagerfeuer erzählten?
Das Phänomen solcher Familien, oft nur mündlicher Überlieferungen, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts offenbar - durch die Sammlungen von Sagen und Volksmärchen der Sprachwissenschaftler Jakob und Wilhelm Grimm. Den Brüdern fielen bereits Ähnlichkeiten deutscher Volkserzählungen mit solchen aus Indien, Persien und anderen Ländern auf. Bald entstand das historisch-geografische Modell, dem zufolge solche Parallelen Anzeichen einer Verwandtschaftsbeziehung sind, die eine Eingruppierung der verschiedenen Vertreter in Familien rechtfertigt.
Gleichsam würden Mythen von einer Generation zur nächsten weitervererbt, wobei ihre wichtigsten Merkmale zwar meist beibehalten werden, jedoch unter mehr oder minder bewusster Hinzufügung von Innovationen eine Entwicklung stattfindet. Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009) schrieb dazu: »In dem Glauben, lediglich ihren Inhalt wiederzugeben, verändert man die Mythen zugleich.« Über längere Zeiträume hinweg muss sich eine mündlich tradierte Erzählung also zwangsläufig verändern, und zwar umso stärker, je größer der zeitliche Abstand zu ihrem Ursprung wird.
Diese »Evolution« kann zudem eine geografische Dimension haben. Schon 1951 zeigte die schwedische Volkskundlerin Anna Birgitta Rooth, dass »Aschenputtel« auf ein 4000 Jahre altes orientalisches Märchen zurückgeht: Eine Kuh ernährt zwei Kinder, deren leibliche Mutter gestorben ist. Ihre Stiefmutter tötet das Tier, doch aus den vergrabenen Knochen wächst ein Baum, der sie fortan nährt. Aus diesem Märchen verschwand im Lauf der Zeit der Bruder, das Mädchen hütet die Kuh, während es am Spinnrad arbeitet. Nach dem Tod des Tiers sprießen Früchte aus seinem Kadaver, die jedoch nur jener Prinz ernten darf, der das Mädchen heiraten wird.
Vor etwa 2500 Jahren sei auf dem Balkan eine neue Version entstanden: Die nährende Rolle der Kuh und die Schlachtung bildeten noch immer den Kern des Geschehens, doch nun erscheinen prächtige Kleider dort, wo das Tier begraben wurde. Das ermöglicht der Heldin, eine Feier des Prinzen zu besuchen, wo sie ihren Pantoffel verliert. Der junge Mann sucht nach der Besitzerin, droht aber einer Betrügerin aufzusitzen. Doch ein Tier entlarvt diese, der Prinz heiratet die Richtige. Die Geschichte ist Rooth zufolge quer durch Osteuropa bis nach Skandinavien gewandert, wo sie um das Jahr 1000 als unser heutiges »Aschenputtel« auftauchte.
Die Anfänge statistischer Mythenforschung
Den Beziehungen unter den Angehörigen von Mythenfamilien gehen Forscher auf den Grund, indem sie strukturelle Elemente und Motive identifizieren und deren Modifikationen verfolgen. Ein Ziel solcher Forschung ist es, einen Stammbaum aufzustellen. Dieser mag Aufschlüsse über Migrationsbewegungen in der Vergangenheit geben oder helfen, die ursprüngliche Geschichte, sozusagen ihren Urahn, zu rekonstruieren. In den 1990er Jahren setzte Jun’ichi Oda von der Universität Tokio erstmals mathematische Verfahren ein, wie sie in der Evolutionsbiologie zur Rekonstruktion der stammesgeschichtlichen Entwicklung (der »Phylogenese«) verwendet werden. Dieser damals noch grobe Ansatz wird seitdem von einigen Forschern - darunter unserem Team - verfolgt, da er nicht nur mächtige, sondern auch verlässliche Werkzeuge bereitstellt. Denn wie wir erstmals zeigen konnten, geben die eingesetzten statistischen Verfahren Sicherheiten, die ein rein qualitatives Vorgehen nicht bieten kann.
Beispielsweise werfen Kritiker der historisch-geografischen Theorie vor, ihre Kriterien der Familiengruppierung seien willkürlich - mitunter werden nur ein oder zwei Charakteristika zur Kategorisierung verwendet - und zudem seien sie ethnozentrisch - die meisten Mythenfamilien nehmen Bezug auf den westlichen Kulturkreis. Dazu käme eine Stichprobenverzerrung, weil europäische Volkstraditionen weit intensiver studiert wurden als außereuropäische, was jede Stammbaumrekonstruktion verfälsche. Durch die Anwendung phylogenetischer Algorithmen auf die verfügbaren Datensätze lässt sich die Stabilität einer solchen Berechnung aber testen und eine einseitige Gewichtung von Stichproben korrigieren.
Diese Techniken haben wir nicht nur auf die »Kosmische Jagd«, sondern auch auf die Mythenfamilien »Polyphem« und »Pygmalion« angewendet. Versionen des Letzteren kennt man in Europa und in Afrika. Diese Sage kreist um einen Menschen, der sich in ein von ihm geschaffenes Kunstwerk verliebt. In der griechischen Überlieferung nach Ovid ist es eine weibliche Marmorskulptur. Der von realen Frauen enttäuschte Künstler kleidet sie, redet mit ihr, liebkost sie. Gerührt haucht Venus dem Stein Leben ein. Beim Volk der Venda im südlichen Afrika schnitzt ein Mann die Frauenskulptur aus einem Holzblock, die mal durch einen Priester, mal durch einen Gott lebendig wird. Als der Häuptling sie begehrt, wirft der Künstler die Frau zu Boden, wo sie wieder zu Holz wird.
In den Mythen vom Polyphemtypus wagt sich ein Held in die Höhle eines Monsters und entkommt in einer Tierherde verborgen. In Europa retten ihn meist Schafe. Die hier zu Lande bekannteste und namengebende Fassung stammt wieder aus dem griechischen Sagenkreis: Der Held Odysseus dringt mit seinen Gefährten auf der Suche nach Nahrung in eine Höhle ein, nicht ahnend, dass sie dem Zyklopen Polyphem als Schafstall dient. Der nimmt die Männer gefangen, um sie zu fressen. Zwar gelingt es den Griechen, Polyphem mit einer glühenden Pfahlspitze zu blenden, doch der Riese bewacht weiterhin den Ausgang. Im Bauchfell der Schafe versteckt, gelingt dann endlich die Flucht.
Ähnliche Erzählungen findet man auch in Nordamerika, so beispielsweise bei den Niitsitapi, vier Stämmen des algonkinen Sprach- und Kulturkreises. Sie erzählen von einem Raben, der Bisons in eine Höhle einsperrt. Ihrer wichtigsten Nahrungsquelle beraubt und vom Hungertod bedroht, nehmen Stammesmitglieder den Vogel gefangen und halten ihn über einen qualmenden Schacht, was das schwarze Gefieder erklärt und zudem an die Rolle des Feuers in der griechischen Sage erinnert. Der Rabe verspricht, die Tiere freizulassen, hält sich jedoch nicht daran (in gewisser Weise hatte auch der Zyklop ein Versprechen gebrochen: das den Griechen heilige Gebot der Gastfreundschaft, an das Odysseus appellierte). Nun verwandelt sich ein Mensch in einen Stab und ein zweiter in einen Welpen. Die Tochter des Raben empfängt sie und führt sie in die Höhle. Dort verwandeln sich die beiden abermals, der eine in einen großen Hund und der andere in einen Menschen. Sie führen die Bisons ins Freie, doch um dem scharfen Blick des am Eingang wachenden Raben zu entgehen, verstecken sich beide im Fell eines Bisons.
»Es gibt einen Helden«
Die phylogenetischen Algorithmen verarbeiten diskrete Informationen, zum Beispiel die Abfolge der vier verschiedenen Nukleotide in der menschlichen DNA. Um die raumzeitlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Sagen nachzuvollziehen, haben wir daher jede Erzählung jeder Familie in Abfolgen der kürzest möglichen Sätze zerlegt, die wir als Mytheme bezeichnen. Vorsicht: Dies entspricht nicht der gängigen Definition, in der Mytheme bereits Kernelemente von Mythen darstellen! Für unsere Zwecke ist es ausreichend, Sätze wie »Es gibt einen Helden« oder »Der Held ist ein Jäger« zu verwenden. In der Zusammenschau der Mytheme kristallisieren sich dann die definierenden Merkmale der großen Mythenfamilien heraus. Manche kommen in nur einer oder zwei Fassungen der Geschichte vor, andere dagegen sind allen Versionen gemeinsam. Jedes Mitglied lässt sich anhand einer Merkmalsliste beschreiben. Indem wir Anwesenheit oder Abwesenheit eines bestimmten Mythems mit 1 beziehungsweise 0 codieren, können wir sie mit den statistischen Methoden der Phylogenetik vergleichen, von anderen Familien abgrenzen und Stammbäume erstellen.
Die von uns verwendeten Algorithmen belegen, dass Ähnlichkeiten in den Merkmalslisten verschiedener Versionen eher auf verwandtschaftlichen Verbindungen beruhen als auf Neudichtungen, die zufällig einander entsprechen. Wie in der Evolution von Lebewesen gibt es aber Mutationen, in diesem Kontext als Innovationen bezeichnet: Mytheme verblassen, andere werden aus anderen Geschichten entlehnt. An die Stelle eines einäugigen Riesen tritt dann vielleicht ein Rabe, der Bisons statt Schafe einsperrt. Zum Glück gibt es statistische Methoden zur Einschätzung solcher Effekte. So ermöglicht der Retentionsindex, den Anteil solcher Merkmale an der Gesamtliste zu ermitteln, die zwei oder mehr Geschichten gemeinsam sind, obwohl diese nicht von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen.
Computeralgorithmen ermittelten die wahrscheinlichsten Abstammungslinien der weltweit vorkommenden Versionen der »Kosmischen Jagd«. Ein Kriterium war, dass die Verzweigungen in mindestens der Hälfte aller berechneten möglichen Bäume enthalten sind. Alle Varianten stammen von einer Version 0 aus paläolithischer Zeit ab, die wir wie folgt rekonstruierten: »Ein Mensch jagt ein großes, Gras fressendes Huftier mit Hörnern. Diese Jagd findet im Himmel statt, oder sie führt die Beteiligten dorthin. Das Tier überlebt und verwandelt sich in das Sternbild des Großen Bären.«
In einer ersten Verzweigung entspringen diesem Original neun Varianten in Eurasien. Während die meisten dort bleiben, gelangt eine nach Afrika, zwei kommen nach Amerika. In der inzwischen verschwundenen Version 1 wird aus dem Tier das Sternbild Orion. Die nun folgende achtfache Verzweigung bringt insbesondere die deutlich veränderte Version 2 hervor: »Ein großes, Gras fressendes Huftier mit Hörnern wird bis in den Himmel verfolgt. Das Tier ist schon tot, als es unter die Sterne versetzt wird. Durch einen Fehltritt eines Familienmitglieds werden seine Jäger ebenfalls verwandelt, meist in die Plejaden, mitunter auch in den Orion.«
Während der Stamm der Chilcotin von British Columbia bei dieser Version stehen bleibt, erzählen die südamerikanischen Kali’na und Akawaio, das Tier sei ein Tapir gewesen und das betreffende Familienmitglied eine Frau, die ein Tabu brach. Die resultierende Version 3 erlangte damit einen größeren gesellschaftlichen Nutzen. Die Akawaio fügten einen Ehebruch und weitere Sternbilder hinzu, womit wir Version 4 erhalten: »Eine Frau nimmt sich einen Tapir zum Geliebten. Dieser verspricht, sie mit in den Osten zu nehmen, wo der Himmel auf die Erde trifft. Die Frau wartet auf eine Gelegenheit, als ihr Ehemann auf einen Baum steigt, um ihm die Beine abzuhacken. Jedoch wird der Bedauernswerte von seiner Mutter geheilt. Mit Hilfe einer Krücke macht er sich daran, die Liebenden zu verfolgen, und holt sie ein. Er hackt dem Tapir den Kopf ab. Die Frau fliegt zusammen mit dem Geist des Tiers in den Himmel, verfolgt von ihrem Ehemann.« Letzterem entspricht das Sternbild Orion, die Plejaden stellen die Frau dar, und die Hyaden formen den Kopf des Tapirs.
Die obige Darstellung ordnet die verschiedenen Versionen der Kosmischen Jagd nach der Anzahl gemeinsamer Mytheme an. Der Abstand zum Protomythos ist dabei umso länger, je mehr Innovationen in eine Erzählung eingebaut wurden. Querverbindungen symbolisieren einen Austausch zwischen benachbarten Versionen. Insgesamt zeigt diese Darstellung des Stammbaums deutlich, dass die Mehrzahl der Mythen einer begrenzten Anzahl von Kulturräumen angehört.
Indem die Algorithmen nach Verzweigungspunkten suchen, an denen möglichst wenige Innovationen auftreten, ermitteln sie direkte Abstammungslinien, mithin Mythenstammbäume. Dabei offenbart sich eine zeitliche Dimension: Verzweigungen einander ähnlicher Versionen können nicht weit auseinanderliegen.
Übernimmt ein Volk eine Erzählung seiner Nachbarn, besteht eine Tendenz zur Verdrehung von Koordinaten. So werden beispielsweise mitunter Frauen in Männer verwandelt, oben und unten, Rohes und Gekochtes vertauscht. Im Extremfall lässt sich die Verwandtschaft nicht einmal mehr erkennen - weshalb derart starke Transformationen in unserer Studie keinen Eingang finden.
Solange man sich an eine eindeutig identifizierte Mythenfamilie hält, kann man davon ausgehen, dass Innovationen in der Merkmalsliste nur punktuell auftreten, so dass sie die genealogische Aussage nicht verschleiern. Daher beobachtet man trotz aller Varianten, dass sich die Versionen einer Mythenfamilie meist in einer schlüssigen Anordnung gruppieren lassen, nämlich nach Kontinenten, geografischen Zonen und Sprachgemeinschaften. Dies zeugt von einer großen Beständigkeit der Erzählungen im Verlauf der Zeit.
Kulturtransfer durch Migration
An der sukzessiven Veränderung einer solchen von einer Generation zur nächsten vererbten Geschichte kann man Wanderungsbewegungen ablesen. Beispielsweise lassen sich Parallelen zwischen der Ausbreitung des Pygmalionmythos und einer Migration von Bevölkerungsgruppen aus dem Nordosten Afrikas ins südliche Afrika ziehen, die vor etwa 2000 Jahren stattgefunden hat. Die Polyphemerzählungen gelangten in einer ersten Expansionswelle noch in der Altsteinzeit weit über Europa hinaus bis nach Nordamerika; eine zweite Welle erfolgte in der Jungsteinzeit im Gefolge der Landwirtschaft.
Es genügte nämlich nicht, dass beispielsweise ein Volk mit einem entfernt lebenden im Warenaustausch stand, um neue Elemente in einen letztlich identitätsstiftenden Mythos zu importieren. Gemeinsam mit Kollegen konnte Quentin Atkinson von der University of Auckland bestätigen, dass ethnische und sprachliche Barrieren die Verbreitung von Folkloreelementen sogar stärker aufhalten als die von Genen. Die Verbreitung einer solchen Überlieferung erforderte also eine Migration ihrer Überlieferer.
Auch der Stammbaum der »Kosmischen Jagd« lässt darauf schließen, dass dieser Mythos Amerika in mehreren Schüben erreicht hat. Überraschenderweise vereint ein Ast die griechischen Versionen mit denen der algonkinen Sprachen und Kulturen. Das stimmt mit einigen Resultaten der Genetiker überein, die anhand von DNA-Vergleichen die Besiedlung Amerikas rekonstruieren wollen: Beiden Volksgruppen ist die so genannte Haplogruppe X2 gemeinsam, ein Genkonglomerat, das immer komplett vererbt wird und von eurasischen Vorfahren stammt, die vor etwa 30 000 Jahren lebten.
Ein zweiter Ast des Stammbaums der »Kosmischen Jagd« weist auf die Überquerung der Beringstraße hin und setzt sich über die Inuitkulturen bis weit in den Nordosten Amerikas fort. Schließlich gibt es einen dritten Zweig, der vermuten lässt, dass Teile des Mythos von Asien ausgehend sowohl in Richtung Afrika als auch nach Amerika diffundierten.
Mit jeder Differenzierung wuchs ein Ast des Stammbaums, und je länger er wurde, desto weniger hatten die Versionen am äußeren Ende mit ihrem Ursprung gemein. Eine solche Beziehung beschreibt, was man in der Biologie als punktuelles Gleichgewicht bezeichnet. Hiervon spricht man, wenn Arten während langer Zeiträume stabil bleiben, jedoch nach Eintreten eines erbgutverändernden Ereignisses (einer so genannten Punktuation) relativ schnell mutieren. Genau so verhielte es sich den berechneten Stammbäumen nach auch bei den Mythen, bei denen sich Phasen hoher Evolutionsgeschwindigkeit durch verschiedene Faktoren erklären lassen. Insbesondere migriert immer nur eine begrenzte Zahl von Menschen, was die Stabilität ihres kulturellen Gedächtnisses mindert. In einem Umfeld von um Ressourcen konkurrierenden Gruppen kann die Modifikation der Mythologie dazu beitragen, sich von den jeweils anderen zu unterscheiden - ein gut dokumentiertes Phänomen in der Ethnologie. Ohnehin ist es sehr menschlich, Glaubensinhalte im Spiegel neuer Umwelt- und Kultureinflüsse zu revidieren.
Suche nach der Urform
Phylogenetische Algorithmen helfen nicht nur, solche Prozesse nachzuvollziehen. Ihre besondere Bedeutung in der vergleichenden Mythologie besteht darin, die jeweilige Urform zu rekonstruieren. Denn sie ermitteln die Wahrscheinlichkeit, ob ein bestimmtes Mythem bereits im Prototyp des Originals enthalten war oder nicht. Damit bestätigen sie die Annahme der historisch-geografischen Theorie, jeder großen, weit verzweigten Mythenfamilie müsse eine Urform zu Grunde liegen, und machen obendrein verloren gegangene beziehungsweise entlehnte Mytheme sichtbar. Die Berechnungen lassen sich immer wieder aktualisieren, sobald weitere Versionen in sie aufgenommen werden.
Eine der ersten Pygmalionversionen lautete demnach etwa wie folgt: »Ein Mann schnitzt aus einem Baumstumpf eine Frauengestalt, um seine Einsamkeit zu durchbrechen. Ein Gott haucht der Skulptur Leben ein, und sie verwandelt sich in eine schöne junge Frau. Sie wird zur Gattin ihres Schöpfers, jedoch gibt es daneben einen zweiten Mann, der sie gerne zur Gefährtin hätte.« Auf die Polyphemfamilie angewandt berechneten die phylogenetischen Verfahren folgende Geschichte: »Ein Jäger dringt in eine Höhle ein, in der eine Tierherde eingesperrt ist. Doch der Ausgang wird mit einem schweren Stein verschlossen, und ein Monster setzt alles daran, ihn zu töten. Als es die Tiere nach draußen lässt, tastet es sie einzeln ab. Doch dem Helden gelingt die Flucht, indem er sich am Bauch eines Tiers festklammert.» Und die Urform der »Kosmischen Jagd« lautete mit hoher Wahrscheinlichkeit: »Ein Huftier wird von einem Jäger verfolgt, wobei sich dies am Himmel abspielt oder dorthin versetzt wird; das Tier lebt noch, als es unter die Sterne versetzt wird, und dieses Sternbild wird Großer Bär genannt.«
Bemerkenswert ist, dass die rekonstruierten Ursprünge der letzten bis in die Jüngere Altsteinzeit (Jungpaläolithikum) zurückreichen, also weit vor dem von der heutigen vergleichenden Sprachwissenschaft erfassten Zeitraum liegen. Aus diesem Abschnitt der Menschheitsgeschichte stammt eine Höhlenmalerei in der Drei-Brüder-Höhle (Grotte des Trois-Frères) in den französischen Pyrenäen. Sie zeigt ein Wesen mit dem Körper eines Menschen, aber dem Kopf eines Bisons; es hält einen Stab oder kurzen Bogen in den Händen. Ein Bison in einer Herde wendet sich ihm zu, und die beiden Gestalten scheinen einen Blick auszutauschen. Betrachtet man das Hinterteil und insbesondere die Beine des Tiers genauer, erweisen sie sich aber ebenfalls als menschlich. Der Prähistoriker André Leroi-Gourhan (1911-1986) deutet sogar die Umrisse des scheinbaren Tiers als die eines Menschen. Bemerkenswert ist außerdem die detaillierte Darstellung des Afters. Tatsächlich erzählen manche nordamerikanischen Polyphemmythen, Helden hätten sich im Inneren eines Tiers versteckt, indem sie durch dessen Anus schlüpften. Zudem erinnern weitere Aspekte der Höhlenmalerei an den rekonstruierten Protomythos: Es gibt eine Höhle und eine Herde, das Mischwesen hält einen Stab, und es unterzieht sein Gegenüber einem prüfenden Blick.
Der Auftritt des Drachen Smaug gehört sicher zu den packendsten Szenen in der dreiteiligen Verfilmung des »Hobbit«. Als bösartige, geflügelte Feuerspucker kennen viele Märchen und Sagen des Abendlands die Drachen. In Ostasien ist ihre Bedeutung eher die von Gottheiten denn von Dämonen. Der Kaiserthron Chinas galt als Drachenthron. Trotz der Bedeutungsunterschiede wie auch vieler Verschiedenheiten in ihrer Gestalt stellten sich die Menschen weltweit Drachen als Wesen vor, deren Körper der einer riesigen Schlange sei, welche aber Beine hat und einen Kopf, der dem anderer Tiere gleicht.
»Spektrum«-Autor Julien d’Huy hat die phylogenetische Analyse auch auf diese mythologische Figur angewandt. So finden sich Darstellungen gehörnter Schlangen auf vielen prähistorischen Felszeichnungen Afrikas und Nordamerikas. Der Forscher ermittelte grundlegende Variablen (Mytheme) wie »keine Füße / zwei Füße / vier Füße« oder »ein Kopf / viele Köpfe«, »kann fliegen«, »ist mit Sturm verbunden«, »lebt in einer Höhle«. Insgesamt definierte er Abbildungen und Erzählungen mittels 69 Variablen.
Als Urform aller Drachen rekonstruierte er eine Gestalt mit dem Leib einer riesigen geschuppten Schlange, aber mit Hörnern und Haaren, die ein Gewässer bewacht und fliegen sowie Stürme und Fluten auslösen kann. Diese Form reicht verschiedenen Felsmalereien nach bis in die Altsteinzeit zurück.
Eine zweite Analyse befasste sich mit dem Kampf des griechischen Gottes Apollon gegen den Drachen Python um das Heiligtum Delphi. Das Motiv eines solchen Duells konnte d’Huy bis nach Asien zurückverfolgen. Die positive Sichtweise auf Drachen entstand demnach erst im Lauf der Zeit. (K.-D. L.)
Auch für die »Kosmische Jagd« könnte es eine bildliche Darstellung geben, eine Jagdszene aus der Höhle von Lascaux. Allerdings gingen hier die Spekulationen noch weiter: Ein dunkler Fleck am Übergang vom Hals des Bisons zum Rücken wäre dann ein Stern, die Haltung des Tiers würde den Aufstieg zum Himmel andeuten. Weitere Flecken am Boden wären sein Blut, das in manchen Versionen des Mythos die Herbstblätter färbt. Diese Beispiele sollen vor allem das Potenzial der Methode aufzeigen, längst vergangene Mythen zu neuem Leben zu erwecken.
Bleibt die Frage: Warum haben solche Erzählungen überhaupt eine derart lange Tradition? Den griechischen Erzählern der drei Sagen war sicher nicht bewusst, dass sie eine jahrtausendealte Überlieferung fortsetzten. Vermutlich brachten Mythen einer Gesellschaft Vorteile, beispielsweise indem sie Lebenserfahrungen weitergaben. Sicher halfen sie, der Welt eine Ordnung zu geben und so existentielle Ängste zu lindern. Vielleicht dienten sie auch einem viel einfacheren Drang des Menschen: die Welt zu verstehen.

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben