Demenz: Wird Aducanumab bald Alzheimerpatienten helfen?
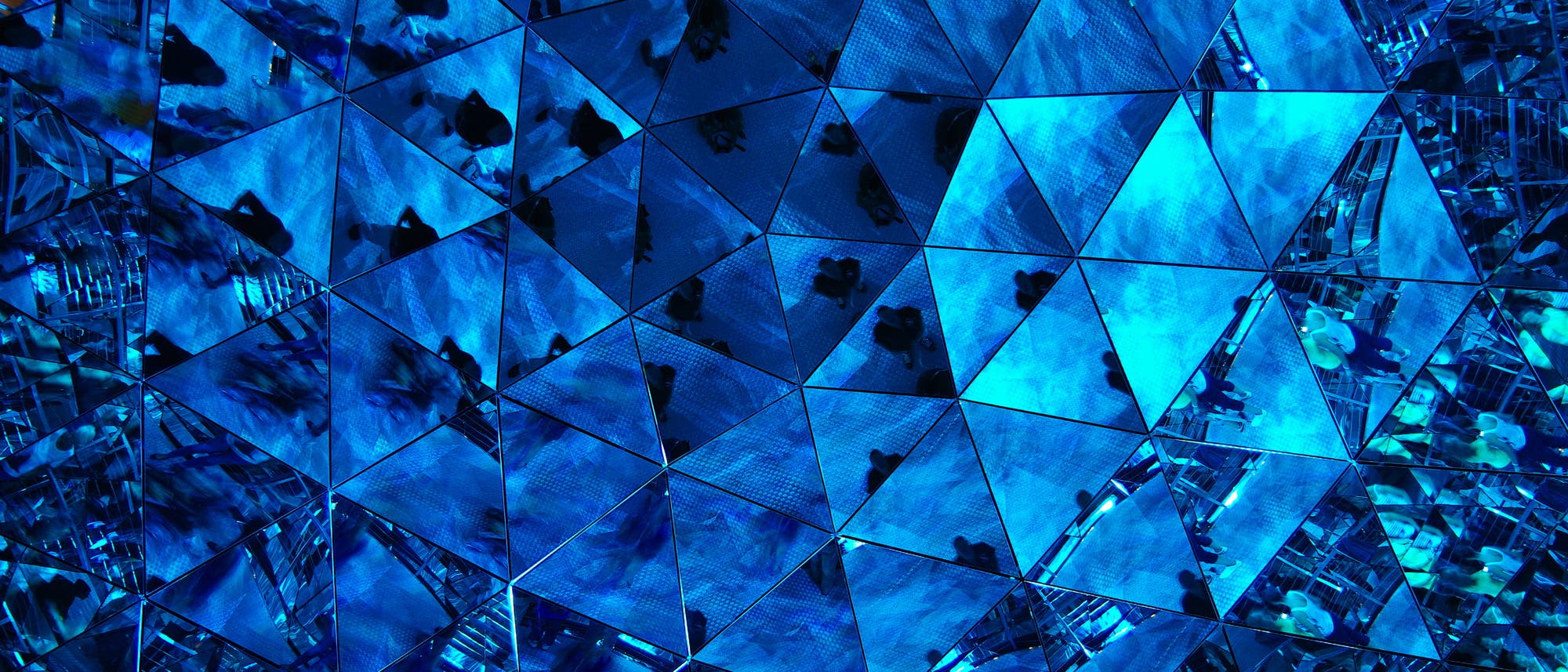
Was mancher schon als großen Erfolg in der Alzheimerforschung gefeiert hatte, gipfelte in einem Desaster – doch in einem, dessen Ausgang noch ungewiss ist. Im Fokus: der Wirkstoff Aducanumab, der Patientinnen und Patienten in einem frühen Stadium vor schweren Folgen der Demenzerkrankung bewahren soll.
In zwei großen Studien hat Aducanumab lange Zeit überzeugt. Bis die Phase-III-Untersuchungen »Emerge« und »Engage« im März 2019 überraschend als gescheitert galten. Nun gibt es nach einer neuen Datenauswertung wieder Hoffnung, und der Hersteller Biogen hat bereits Zulassungsanträge in den USA und Europa gestellt.
Bis Anfang Juni 2021 wollen die Verantwortlichen in den USA entscheiden, die Europäische Arzneimittelagentur soll ebenfalls in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen. Wie stehen die Chancen für den Wirkstoff? Wie soll Aducanumab wirken? Und warum ist es so schwer, Alzheimer zu therapieren? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten:
- Was ist Aducanumab?
- Warum ist der Wirkstoff umstritten?
- Die Entdeckung von Aducanumab
- Wie kam Biogen letztlich doch zu einem positiven Ergebnis?
- Warum ist nur ein Phase-III-Studienergebnis viel versprechend?
- Warum bewerten FDA und Expertenkomitee Aducanumab unterschiedlich?
- Was würde eine FDA-Zulassung für Europa bedeuten?
- Für wen wäre Aducanumab geeignet?
- Sollte sich die Alzheimerforschung auf Plaques konzentrieren?
- Warum ist es so schwer, die Krankheit zu therapieren?
- Ein Bluttest zur Alzheimer-Früherkennung
- Welche weiteren Behandlungsansätze gelten als viel versprechend?
- Was kann Alzheimer-Betroffenen dieser Tage helfen?
Was ist Aducanumab?
Aducanumab ist ein Antikörper. Er wird Alzheimerbetroffenen direkt in die Vene injiziert und richtet sich gegen die für die Krankheit charakteristischen Beta-Amyloide, kurz Aβ. Aus diesen Eiweißen bestehen die Ablagerungen im Gehirn, auch Plaques genannt, die mit für das Absterben der Nervenzellen verantwortlich sind.
»Im Gehirn angekommen, erkennt der Antikörper Aβ-Ablagerungen und setzt sich regelrecht auf sie drauf«, erklärt Christian Haass vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Die von Aducanumab markierten Plaques würden anschließend von den Immunzellen erkannt »und können von ihnen beseitigt werden«, erklärt der Biochemiker. Dass der Körper dank des Wirkstoffs Plaques abbaut, hatte die PRIME-Studie von Hersteller Biogen im Jahr 2016 gezeigt. Auch belegten die Daten, dass sich die Gedächtnisleistung der Probanden und Probandinnen leicht verbessert hatte.
Alzheimer – fortschreitende Erkrankung des Gehirns
In Deutschland leben laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz, rund zwei Drittel von ihnen haben Alzheimer. Weil Nervenzellen im Gehirn absterben, werden Menschen mit Alzheimer zunehmend vergesslich, verwirrt und orientierungslos. Wie genau die Erkrankung entsteht, ist bis heute nicht restlos geklärt.
Eine wichtige Rolle scheinen zwei verschiedene Eiweißablagerungen zu spielen: Plaques aus Beta-Amyloid und Fibrillen aus Tau. Im gesunden Gehirn wird das Eiweiß problemlos gespalten und abgebaut. Wird dieser Prozess gestört, entstehen Beta-Amyloid-Proteine (Aβ), die wiederum mit der Zeit zwischen den Nervenzellen verklumpen. Diese Ablagerungen werden auch ß-Amyloid-Plaques oder einfach Plaques genannt. Das Tau-Protein befindet sich hingegen nicht außerhalb, sondern im Inneren der Zellen und ist dort für die Stabilität und Nährstoffversorgung verantwortlich.
Die Alzheimererkrankung verändert das Tau-Protein chemisch. Ähnlich wie die Plaques lagert es sich dann in Form von Fasern ab: Die Zellen verlieren ihre Form, ihre Funktionen und zerfallen. Der Verlust der Nervenzellen führt zu den alzheimertypischen Symptomen wie Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit. Entzündungsprozesse scheinen bei der Entwicklung der Krankheit ebenfalls beteiligt. Etwa ein Prozent der Alzheimerfälle ist erblich bedingt.
Warum ist der Wirkstoff umstritten?
Im August 2016 hat das Pharmaunternehmen Biogen die Ergebnisse seiner PRIME-Studie veröffentlicht. Mehr als ein Jahr lang hatte das verantwortliche Team 166 Patienten und Patientinnen mit Alzheimer alle vier Wochen den Antikörper Aducanumab oder ein Kontrollmittel verabreicht. Das Resultat war verblüffend: Ab der 26. Behandlungswoche begannen die Amyloid-Ablagerungen zu verschwinden, die Wissenschaftler unter anderem für die Entstehung von Alzheimer verantwortlich machen. Je höher die Dosierung und je länger das Mittel verabreicht wurde, desto stärker war der Effekt. Bei einigen Patienten waren die Ablagerungen nach einem Jahr sogar nahezu vollständig entfernt. Auch ihr Gedächtnis hatte sich leicht verbessert. Das war der Auftakt.
Anschließend galt es, den Antikörper an mehr Betroffenen zu testen. Biogen startete zwei separate Studien mit insgesamt 3200 Teilnehmern, nur um im März 2019 beide wieder zu stoppen. Die Zwischenergebnisse würden keine Verbesserungen zeigen, lautete die Erklärung.
In der Fachwelt rumorte es. Die Forschung gehe in die falsche Richtung, hieß es etwa. Und: Sich allein auf die Beseitigung der Amyloid-Ablagerungen zu konzentrieren, sei ein großer Fehler.
Die Entdeckung von Aducanumab
Gefunden haben Aducanumab die Mediziner Roger Nitsch und sein Kollege Christoph Hock am Institut für regenerative Medizin an der Universität Zürich. Jedoch nicht bei Erkrankten, sondern bei Gesunden. Genauer gesagt bei geistig topfitten Hochbetagten. Die Idee: Menschen, die selbst im hohen Alter noch fit im Kopf sind, müssen ein Immunsystem besitzen, dem es gelingt, die für die Alzheimerkrankheit charakteristischen Beta-Amyloide (Aβ) in Schach zu halten.
Im Blut von mehreren bis zu 100-Jährigen fanden Nitsch und Hock dann tatsächlich spezielle Immunzellen, die in Kontakt mit Aβ die Produktion von Antikörpern gegen das verklumpende Eiweiß anregen. Nach jahrelanger Forschung entschlüsselten sie die Struktur, bauten diese im Labor nach und nannten den Antikörper »Aducanumab«. Später lizensierte die Firma Biogen Aducanumab – erwarb also das Recht, den Antikörper wirtschaftlich für ihre Zwecke zu nutzen.
Dann die Überraschung im Oktober 2019: Eine der beiden Studien sei doch erfolgreich, verkündete Biogen. Entsprechend beantragte die Firma bei der amerikanischen Arzneimittelagentur FDA die Zulassung.
In einer ersten Stellungnahme äußerte sich die FDA positiv. Doch dann geschah etwas, was laut Christian Haass vom DZNE in der Alzheimerforschung beispiellos ist: Ein unabhängiges Expertengremium, das die FDA berät, kam zum entgegengesetzten Ergebnis. »Der dokumentierte Nutzen ist zu gering«, hieß es. Und auch die hauseigenen Statistiker der Agentur zogen mittlerweile ein negatives Fazit. Ursprünglich wollte die FDA bis zum 7. März 2021 entscheiden, ob sie Aducanumab dennoch zulässt. Knapp einen Monat zuvor beschlossen die Verantwortlichen jedoch, die Review-Phase zu verlängern, die Entscheidung falle spätestens am 7. Juni 2021, heißt es derzeit.
Wie kam Biogen letztlich doch zu einem positiven Ergebnis?
Bevor ein neues Medikament die Zulassung erhält, müssen die Hersteller zeigen, dass es wirkt und keine bedenklichen Nebenwirkungen hat. Hierfür braucht es unter anderem Studien an mehreren tausend Patienten und Patientinnen, so genannte Phase-III-Studien, die weltweit an unterschiedlichen Testzentren stattfinden und mit Placebountersuchungen kontrolliert werden.
Als Biogen alle nötigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammenhatte, startete die Firma die Studie »Engage«, wenige Monate später folgte »Emerge«. Im März 2019 wertete Biogen erste Zwischenergebnisse aus, fand bei den Patienten keine nennenswerten Verbesserungen und stoppte die Studien. Das Ende war das jedoch nicht.
»Da die Zwischenanalyse einige Monate dauerte, liefen die Studien bis zum Stopp weiter«, sagt Christian Leibinnes von der Alzheimer Forschung Initiative, der die Debatte aufmerksam verfolgt. »Für die Gesamtauswertung wurden diese Daten dann nachträglich ausgewertet.« Das ist nicht unüblich. Sie würden häufig noch mal auf einem Kongress der Fachwelt präsentiert, erklärt Leibinnes, aus Fehlern lasse sich schließlich lernen. Das Aufsehen erregende Ergebnis: Einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von »Emerge« ging es nachweislich besser.
Am stärksten war der Effekt bei den Probanden und Probandinnen mit der höchsten Dosierung. Nach 78 Wochen bauten sie im Gedächtnistestverfahren »CDR-SB« beispielsweise 0,39 Punkte weniger ab als die Placebogruppe. Für Biogen Grund genug, bei der FDA die Zulassung zu beantragen.
Warum ist nur ein Phase-III-Studienergebnis viel versprechend?
Womöglich, weil die Studien zu unterschiedlichen Zeiten starteten und bestimmte Betroffene eine Zeit lang eine andere Dosis bekamen.
Aus der PRIME-Studie war bekannt, dass Aducanumab gewisse Nebenwirkungen hat. Die gravierendste ist eine Hirnschwellung, ausgelöst durch Wassereinlagerungen, ARIAs (amyloid-related imaging abnormalies). Rechtzeitig erkannt, wird das Medikament abgesetzt, und die Schwellung geht innerhalb weniger Wochen zurück. Unbehandelt kann sie jedoch Hirnblutungen verursachen.
Bekannt ist auch, dass Menschen mit Alzheimer der genetischen Variante APOE4 ein höheres Risiko für solche Schwellungen haben. Aus Sicherheitsgründen erhielten Studienteilnehmer dieser Gruppe daher eine niedrigere Dosierung. Im Lauf der Untersuchung sah Biogen jedoch, dass die Risikoprobanden Aducanumab gut vertrugen, änderte das Forschungsdesign und erhöhte die Dosis. Da »Engage« ungefähr einen Monat vor »Emerge« gestartet war, erhielten die APOE4-Teilnehmer dieser Studie also insgesamt eine etwas geringere Dosis. Laut Biogen ist das einer der Gründe, warum »Engage« negativ ausfiel. Das Unternehmen hat außerdem die Daten der APOE4-Patienten analysiert, die nach der Änderung des Studienprotokolls die höhere Dosierung erhielten. Im Vergleich zur Placebogruppe sehen sie in beiden Studien eine Verbesserung.
Die Argumentation sei schlüssig, sagt Alzheimerexperte Leibinnes. Solche Rechnereien im Nachhinein sieht er dennoch kritisch. Aus gutem Grund: Mit Hilfe der Statistik lässt sich jede Studie schönrechnen.
Wirkt ein Wirkstoff nur bei manchen Probanden, ist es wichtig herauszufinden, warum. Dafür braucht es jedoch keine Rechnerei, sondern eine neue Studie. Diverse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben diese gefordert, bislang jedoch hat sie nicht stattgefunden.
Warum bewerten FDA und Expertenkomitee Aducanumab unterschiedlich?
Das ist unklar. Sicher ist nur, dass die FDA sich positiv äußerte, bevor das Komitee getagt hat. Dieses kam nach einem gut sechsstündigen Gespräch dann zu einer gegenteiligen Einschätzung. Die Argumente reichten von »Der dokumentierte Nutzen ist zu gering« bis hin zur Aussage »Die Zulassung von Aducanumab würde die zukünftige Alzheimerforschung behindern«, berichtet die Fachzeitschrift »Science«.
Was würde eine FDA-Zulassung für Europa bedeuten?
Substanzen, die in den USA als »verkehrsfähig« gelten, dürfen nach Europa eingeführt werden. Mit einem entsprechenden Rezept können Betroffene es in der Apotheke bekommen. Zu welchem Preis, ist noch unklar. Grundsätzlich lässt sich das Rezept in jeder Apotheke einlösen. Da es jedoch sehr aufwändig ist, solche Arzneimittel zu beschaffen, haben sich einzelne Apotheken auf den Import spezialisiert.
Derweil hat Biogen bereits einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gestellt. Der Antrag wurde angenommen und wird vermutlich bis Ende 2021 entschieden. Sollte der Entscheid positiv ausfallen, muss Biogen mit den gesetzlichen Krankenkassen verhandeln, zu welcher Höhe sie die Kosten der Behandlung übernehmen.
Für wen wäre Aducanumab geeignet?
Die Immunisierung hilft Menschen, die sich in einem sehr frühen Stadium von Alzheimer befinden und bisher nur wenig geistige Leistungsfähigkeit eingebüßt haben. Denn Aducanumab baut zwar die eiweißhaltigen Ablagerungen im Gehirn ab, bereits verloren gegangene Nervenzellen bringt es allerdings nicht zurück. Das Medikament kann den Gedächtnisverlust also höchstens stabilisieren.
»Nicht zu vergessen die Nebenwirkungen«, sagt Christian Leibinnes von der Alzheimer Forschung Initiative. Gut ein Drittel der Probanden, die in den Biogen-Studien Aducanumab erhalten haben, entwickelten Hirnschwellungen durch Wassereinlagerungen, was Symptome wie Übelkeit und Schwindel auslöste. Die Hirnschwellungen hat das behandelnde Team zwar mit Hilfe regelmäßiger Untersuchungen immer rechtzeitig erkannt und das Medikament kurzfristig abgesetzt. »In der normalen Hausarztpraxis kann so eine engmaschige Betreuung allerdings kaum stattfinden«, sagt Leibinnes: Unerkannt können die Schwellungen zu Hirnblutungen führen.
Sollte sich die Alzheimerforschung auf Plaques konzentrieren?
Die Gruppe der Alzheimerforschenden ist in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die davon ausgehen, dass Alzheimer ursächlich durch die Eiweißablagerung Aβ verursacht wird (Amyloid-Hypothese). Auf der anderen Seite sind Kritiker wie Christian Behl, Direktor des Instituts für Pathobiochemie an der Universitätsmedizin Mainz: Sie halten die Tau-Proteine oder auch Entzündungsprozesse für die Ursache. Das Argument dafür ist, dass die bisherigen Versuche scheiterten, Alzheimer durch das Entfernen der Plaques zu bekämpfen. Sie fordern daher, die Forschung solle aufhören, sich allein auf die Antikörper zu konzentrieren, und stattdessen mehr die Tau-Proteine und Entzündungsprozesse erforschen.
»Was genau den Schwund der Nervenzellen verursacht, wissen wir nicht«, sagt Konrad Beyreuther vom Netzwerk AlternsfoRschung der Universität Heidelberg. »Wir wissen aber, dass nahezu alle Menschen, die Amyloide haben, gut zehn Jahre später Tau-Neuofibrillenbündel bekommen«, sagt der Molekularbiologe, der zu den weltweit führenden Alzheimerforschern gehört. Beides sei also wichtig und müsse aus dem Gehirn entfernt werden.
Zur Behandlung von Alzheimer seien Tau, Amyloid und Entzündung gleich wichtig, bestätigt Neurowissenschaftler Haass. Die Diskussion, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt die Alzheimerforschung ansetzen soll, findet er wichtig und richtig. Momentan sei die Debatte allerdings zu emotional aufgeladen. Selbst unter seinen nahen Kollegen und Kolleginnen gingen die Meinungen auseinander. Darunter leide nicht nur die Stimmung, sondern auch die Zusammenarbeit und letztlich die Forschung. Nicht zu vergessen die Betroffenen und deren Angehörige.
Warum ist es so schwer, die Krankheit zu therapieren?
»Die Veränderungen im Gehirn beginnen bis zu 20 Jahre vor dem Auftreten erster Symptome«, erklärt Molekularbiologe Beyreuther. Dass die Plaque-Ablagerungen und der damit verbundene Untergang von Nervenzellen das Gedächtnis erst mal nicht beeinträchtigen, liege daran, dass das Gehirn den Verlust anfangs kompensieren könne. »Sind die geistigen Reserven aufgebraucht, treten die ersten Anzeichen von Vergesslichkeit auf«, sagt Beyreuther.
Sogar bei einer milden Form von Alzheimer sei zu diesem Zeitpunkt in einigen Hirnregionen bereits gut die Hälfte der Nervenzellen untergegangen. Und diesen Verlust könne man bislang nicht rückgängig machen. »Umso wichtiger ist die Prävention«, betont Beyreuther, ein Forschungsgebiet, das in den vergangenen 30 Jahren »sträflich vernachlässigt« worden sei – ebenso wie die Früherkennung (siehe »Ein Bluttest zur Alzheimer-Früherkennung«).
Ein Bluttest zur Alzheimer-Früherkennung
Der Verlust von Nervenzellen und -verbindungen lässt sich bisher nicht rückgängig machen. Umso wichtiger ist neben der Prävention daher die Früherkennung, bevor die ersten Symptome auftreten. So einen Test gibt es bislang noch nicht, allerdings erste viel versprechende Versuche.
An der Ruhr-Universität Bochum hat der Biophysiker Klaus Gerwert mit seinem Team beispielsweise einen Bluttest entwickelt. Dieser erkennt die Beta-Amyloid-Proteine in einer Art Frühstadium der Verklumpung – nämlich wenn sie beginnen, sich falsch zu falten. Durch die Blutanalyse konnten Gerwert und sein Team unter 200 Probanden 22 Personen identifizieren, die später dann auch tatsächlich an Alzheimer erkrankt sind.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) konnten Veränderungen im Blut sogar schon 16 Jahre vor dem Auftreten erster Symptomen finden. Und zwar anhand der Bruchstücke, die entstehen, wenn Nervenzellen durch Alzheimer geschädigt werden, auch Neurofilament (Nfl) genannt. Noch sind die Tests allerdings zu unspezifisch und die Fehlerquote zu hoch.
Wie sinnvoll Prävention ist, zeigt unter anderem die finnische Finger-Studie von einem Team des Zentrums für Alzheimerforschung am Karolinska-Institut. Um herauszufinden, wie sich etwa Ernährung, Bewegung und Gedächtnistraining oder die Einstellung des Blutdrucks auf die Entwicklung von Demenz auswirken, haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mehr als 2500 über 60-Jährige mit milden Symptomen beobachtet. Die Hälfte von ihnen musste mit Beginn der Studie einen gesunden Lebensstil pflegen, die anderen sollen wie zuvor weiterleben.
In der Gruppe, die bewusst gesund lebte, ließen sich erste Demenzsymptome bis zu 7,5 Jahre hinauszögern. »Gesund« bedeutete in der Untersuchung: eine mediterrane Ernährung, Bewegung mindestens dreimal 30 Minuten pro Woche sowie die regelmäßige Teilnahme an einem Kognitionstraining und ein gut eingestellter Blutdruck.
Welche weiteren Behandlungsansätze gelten als viel versprechend?
Neben Aducanumab werden aktuell 16 Medikamente zur Verlangsamung oder Prävention von Alzheimer in Phase-III-Studien klinisch getestet, ebenso vier Medikamente gegen psychische Begleitsymptome der Erkrankung (Stand: September 2020). Darunter befinden sich nicht nur Antikörper, die sich wie Aducanumab gegen die Aβ-Ablagerungen richten, sondern auch Wirkstoffe wie Leuko-Methylthioninium, welche die Bildung der Tau-Proteinstränge hemmen sollen.
Am DZNE in München erforscht Neurowissenschaftler Christian Haass mit seinem Team wiederum die Immunzellen (Mikrogliazellen), welche die von Aducanumab markierten Plaques entfernen. Die Zellen fressen die Ablagerungen zwar weg, sind aber irgendwann erschöpft. Seit 2014 suchen Haass und sein Team deshalb einen Stoff, der die Immunzellen stimuliert. Sollten sie Erfolg haben, sei es auch in diesem Fall essenziell, früh mit der Behandlung zu beginnen, sagt Haass. Denn die Mikrogliazellen sollten die Betroffenen vermutlich ebenfalls bereits 20 bis 30 Jahre schützen, bevor der Arzt ein Gedächtnisproblem feststellen kann.
Ein weiterer Ansatz sind Stammzellen. Mit ihrem Team hat Magdalena Götz vom Institut für Stammzellforschung am Helmholtz Zentrum in München beispielsweise herausgefunden, dass Gliazellen, die das Stützgewebe des Nervensystems bilden, Eigenschaften von Stammzellen besitzen, aus denen sich wiederum neue Nervenzellen entwickeln können. Die Neurobiologin erforscht nun, wie sich abgestorbene Nervenzellen mit Hilfe von Gliazellen ersetzen lassen. Alzheimerforscher Beyreuther hält das für einen viel versprechenden Ansatz. Bis zu einem bedeutenden Ergebnis könne es jedoch noch ein bis zwei Jahrzehnte dauern.
Was kann Alzheimer-Betroffenen dieser Tage helfen?
Alzheimer selbst lässt sich nicht therapieren, die Begleitsymptome hingegen schon. »Viele Betroffene entwickeln beispielsweise Ängste oder Depressionen«, berichtet Leibinnes. In solchen Fällen könnten Antidepressiva oder Neuroleptika helfen. Auch versuchen Ärztinnen und Ärzte, die Gehirnleistung zu steigern; etwa indem sie den Abbau des Botenstoffs Azetylcholin verzögern. Je früher, desto besser. Denn länger als sechs Monate wirkt das nötige Medikament in der Regel nicht.
Ein Ansatz bei einer leichten bis mittelschweren Erkrankung, um das Wohlbefinden und die Lebensqualität ohne Medikamente zu steigern: Biografiearbeit, also mit Hilfe von Fotos, Geschichten, Musik oder Gerüchen gezielt Erinnerungen und Erfahrungen wecken. Weitere Möglichkeiten sind eine Ergotherapie, Verhaltenstherapie oder eine tiergestützte Behandlung.
»Wichtig ist, dass die Behandlung den Betroffenen in seiner Persönlichkeit anspricht und aktiviert«, fasst Leibinnes zusammen. Menschen mit Alzheimer würden zwar Stück für Stück ihr Gedächtnis und damit ihre Erinnerung verlieren, »aber sie verschwinden nicht einfach«.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.