Physik: Der magische Winkel
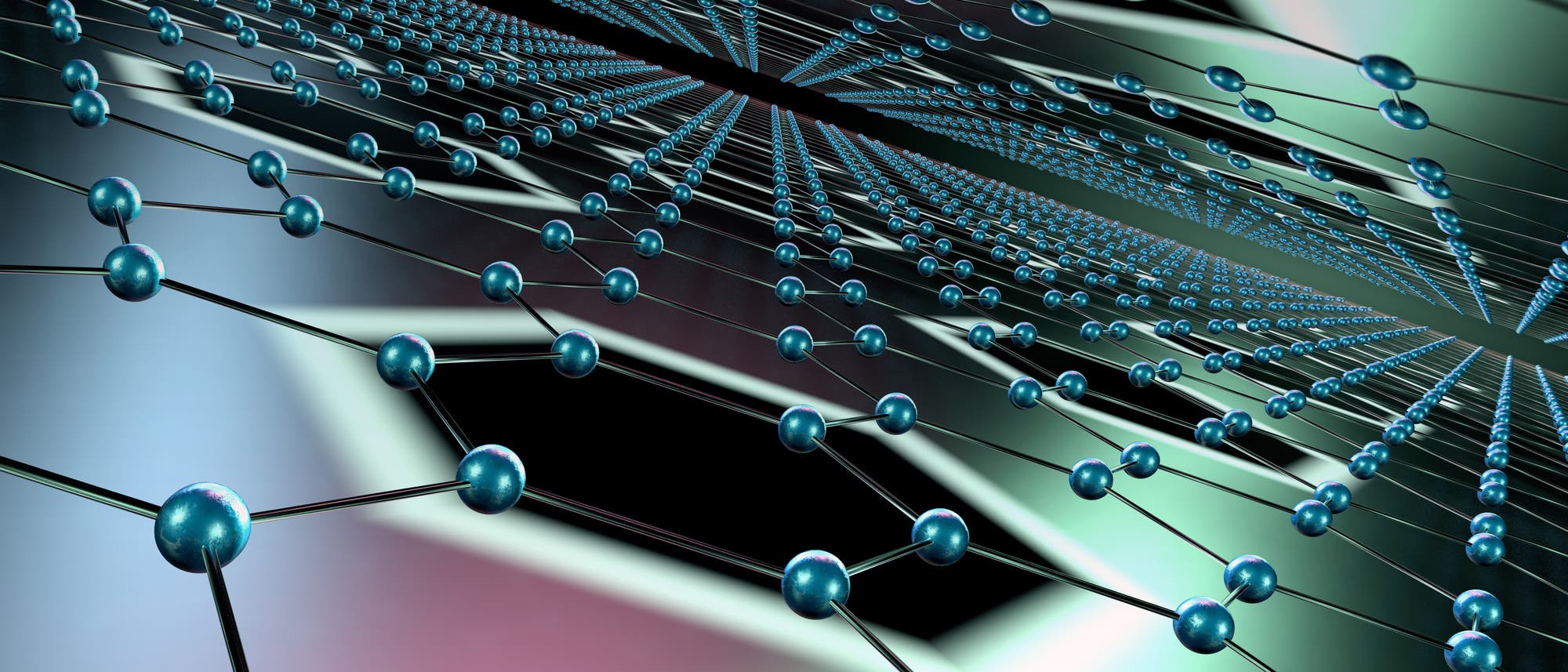
Für Elektronen ist das Material das reinste Paradies: Sie flitzen einfach so hindurch, vorbei an all den Atomrümpfen. Normalerweise geht den Elektronen irgendwann die Puste aus, aber hier reicht ihre Energie auf ewig. Billionenfach strömen sie durch das, was Physiker einen Supraleiter nennen.
Er überträgt Strom widerstandslos, ohne die sonst üblichen Verluste – und könnte damit unsere Welt verändern. Aber bisher funktioniert der Zauber nur bei extremen Minusgraden, meist im untersten Geschoss der Temperaturskala bei minus 273 Grad Celsius. Nur dort halten Atome so still, dass per Quantenphysik gekoppelte Elektronen zwischen ihnen hindurchsausen können.
Schon lange träumen Physiker von einem Material, das auch bei Plusgraden keinen elektrischen Widerstand aufweist. Aber aus welchen Elementen müsste solch ein Raumtemperatursupraleiter bestehen, und in welche Anordnung müsste man die Atome bringen? Seit 30 Jahren ist das eine der großen Fragen der Physik.
Diamantpressen und supraleitendes Graphen
Derzeit sehen sich die Experten einer Antwort so nah wie schon lange nicht mehr, aus zwei Gründen. Zum einen diskutieren die Forscher begeistert über Experimente mit so genannten Diamantpressen, die spezielle chemische Verbindungen extrem stark zusammendrücken. Mit ihnen haben Physiker zuletzt beeindruckende Temperaturrekorde für die Supraleitung aufgestellt.
Zum anderen stürzen sich Forscher auf einen schon länger bekannten Stoff: Graphen ist ein so genanntes 2-D-Material; es besteht nur aus einer hauchdünnen Schicht, in der Kohlenstoffatome ein Bienenwabenmuster bilden. 2018 stapelten Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology zwei Ebenen des Materials und verdrehten sie um exakt 1,1 Grad gegeneinander. Verblüfft stellten sie fest, dass Graphen dadurch zum Supraleiter wird.
Gerechnet hatte damit fast niemand. Über Nacht wurde der »magische Winkel« zur großen Hoffnung der Supraleiterjäger. Zweilagiges Graphen selbst bietet sich zwar nicht für einen Einsatz außerhalb des Labors an, da es die begehrte Eigenschaft nur knapp oberhalb des absoluten Temperaturnullpunkts hat. Doch es könnte sich wie kein zweites Material dazu eignen, die physikalischen Prozesse hinter der Supraleitung besser zu verstehen.
Leiter, Nicht-Leiter, Supraleiter
Wer diese Mechanismen entschlüsseln will, muss sich mit der Physik fester Körper auseinandersetzen. Darin sind Teilchen keine Einzelgänger, sondern eng zusammengepfercht. Materialien bestehen aus unzähligen Atomen, die für gewöhnlich in einem dreidimensionalen Gitter angeordnet sind.
Dadurch überlappen die Einflussbereiche der Atome; ihre Elektronen müssen sich den Raum mit fremden Sippen identischer Teilchen teilen. Statt diskreten Energieniveaus stehen den Ladungsträgern »Energiebänder« offen, die je nach Art des Atomgitters anders aussehen und unterschiedlich stark mit Elektronen befüllt sind.
In Kupfer gibt es pro Atom beispielsweise überdurchschnittlich viele Elektronen mit viel Bewegungsenergie. Sie sind an keinen Atomrumpf gebunden und können sich daher leicht von Atom zu Atom bewegen. Das macht das Metall zu einem guten Stromleiter, wenn auch zu keinem perfekten: Da die positiv geladenen Atomkerne stets an den Elektronen zerren, verlieren diese bei ihrem Weg durchs Gitter Energie.
Ganz anders sieht es in Isolatoren aus: Hier haben die Elektronen von vorneherein eher wenig Bewegungsenergie. Deshalb können sie die elektrostatische Anziehung der einzelnen Atomkerne überhaupt nicht überwinden. Entsprechend fließt kein Strom durch das Material.
Widerstand ist zwecklos
In Supraleitern haben sich die Elektronen etwas Besonderes ausgedacht. Sie helfen einander beim Weg durch den Festkörper, indem sie sich zu so genannten Cooper-Paaren zusammenschließen. Das haben die Physiker John Bardeen, Leon Cooper und John Schrieffer 1957 herausgefunden, 45 Jahre nachdem die Supraleitung erstmals in einem ultrakalten Quecksilberdraht aufgetaucht war.
Laut dieser »BCS-Theorie« läuft die Zusammenarbeit der Elektronen wie folgt ab: Eines von ihnen zieht auf seinem Weg durch das Gitter die Atome ein wenig zu sich. Dadurch bewegen sich auch die Nachbarn ein kleines Stück, nur um nach der Passage des Elektrons wieder in ihre Ausgangslage zu schwingen. Bis dahin hat jedoch bereits ein anderes Elektron das zeitweise verformte Atomgitter genutzt: Es surft gewissermaßen in der Kielwelle seines Schwesterteilchens.
Als Cooper-Paar bewegen sich die Elektronen ohne Verluste durch den Festkörper. Aber wie finden sie zueinander? Und weshalb trennen sie sich nicht nach kürzester Zeit wieder? Laut BCS-Theorie tauschen die Teilchen maßgeschneiderte Gitterschwingungen aus. Diese verändern das Atomgitter zielgenau. Die resultierende Anziehung zwischen den Elektronen ist dabei so stark, dass sie die elektrostatische Abstoßung der gleich gepolten Teilchen überkompensiert.
Der Mechanismus funktioniert allerdings nur nahe des absoluten Temperaturnullpunkts. Lediglich dort halten die Atomrümpfe so still, dass die von den Cooper-Paaren ausgesandten Gitterschwingungen ihre Wirkung entfalten können. Zappeln die Atome bei höheren Temperaturen hin und her, geht die Verbindung zwischen den Partnern unwiederbringlich verloren.
Ein Supraleiter, der bei höheren Temperaturen funktioniert, ist daher mit der BCS-Theorie nicht vereinbar. Lange war das ein Problem ohne echte Relevanz: Bis in die 1980er Jahre waren nur Materialien bekannt, die ihren elektrischen Widerstand bei weniger als minus 250 Grad Celsius verlieren.
Doch dann taten Physiker im IBM-Forschungslabor im schweizerischen Rüschlikon eine neue Klasse von Supraleitern auf, die Cuprate. Die kupferhaltigen Verbindungen sind eigentlich Isolatoren. Wenn man allerdings zusätzliche Atome und Elektronen in ihr Gitter einfügt, leiten sie auch noch viele Dutzend Grad oberhalb des absoluten Nullpunkts Strom, und zwar ohne Widerstand.
Kompliziert, komplizierter, Cuprate
Die Euphorie über die »Hochtemperatur«-Supraleiter war so groß, dass zwei Forscher ein Jahr später den Physik-Nobelpreis erhielten. Bald darauf machte sich jedoch Ernüchterung breit: Cuprate bestehen aus vier bis sechs Atomsorten. Wie genau ein daraus konstruiertes Gitter Elektronen beeinflusst, ist bis heute nicht ganz klar. Ähnlich ist es bei den eisenhaltigen Pniktiden, die 2008 die Bühne betraten.
»Wegen der vielen verschiedenen Bestandteile sind die theoretischen Modelle für solche Festkörper extrem kompliziert«, sagt Dante Kennes, Professor an der RWTH Aachen. Selbst mit Supercomputern komme man hier nicht weiter. So gibt es zwar unzählige Ideen für den Ursprung der Cuprate-Supraleitung. Aber keine davon könne alle vorhandenen Messdaten schlüssig erklären.
Dabei liegt darin die große Hoffnung des Forschungszweigs: Wenn man die »unkonventionelle« Supraleitung bei vergleichsweise hohen Temperaturen versteht, kann man vielleicht ein Material designen, dessen Gitter die Supraleitung quasi erzwingt; auch dann noch, wenn die Atome bei 20 Grad Celsius eifrig hin und her schwingen. »Die bekannten chemischen Elemente lassen so viele verschiedene Kombinationen zu, dass man auf solch ein Material hoffen kann«, sagt Kennes.
Der Weg zum magischen Winkel
Noch vor ein paar Jahren hielten es nur wenige Forscher für wahrscheinlich, dass Graphen hierbei eine entscheidende Rolle spielen würde. Der hauchdünne Kohlenstoff machte sich nach seiner Entdeckung im Jahr 2004 vor allem deshalb einen Namen, weil er ein sehr guter gewöhnlicher Stromleiter ist. Forscher handelten Graphen daher eine Weile als möglichen Ersatz für das weit verbreitete Halbleitermaterial Silizium, allerdings zeigten sich dabei bald große praktische Probleme.
In Sachen Supraleitung fristete Graphen dagegen ein Nischendasein: Zwar überlegten manche Forscher, den besonderen Zustand zu erzwingen, indem man andere Atomsorten in Kontakt mit dem einlagigen Gitter bringt. Da das auch mit vielen anderen Materialien klappt und dafür großer Aufwand nötig ist, hielt sich das Interesse der Fachwelt jedoch in Grenzen.
Immer wieder experimentieren Wissenschaftler auch mit gestapelten Graphenschichten. Die Theoretiker Allan MacDonald und Rafi Bistritzer spekulierten 2011, dass etwas Besonderes passieren müsste, wenn man zwei der Ebenen um 1,1 Grad gegeneinander verdreht – der größte von mehreren »magischen« Winkeln, die es aus heutiger Sicht bei Graphen geben müsste.
Nicht viele Forscher schenkten der Vorhersage Glauben, aber für Pablo Jarillo-Herrero fühlte sich die Sache richtig an. Mit seiner Gruppe am Massachusetts Institute of Technology experimentierte er um das Jahr 2011 herum eifrig mit Graphen. Er dachte auch schon länger darüber nach, wie man es in einen Supraleiter verwandeln könnte.
Nach mehreren Jahren gelang es seinem Team schließlich, Kohlenstoffebenen unter dem magischen Winkel zu verdrehen. Als Jarillo-Herrero und sein Doktorand Yuan Cao eine der Proben auf 1,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt abkühlten und den elektrischen Widerstand maßen, glaubten sie zunächst an einen Fehler. Es wollte partout kein Strom fließen; die Elektronen schienen sich einfach keinen Weg durch die beiden Schichten bahnen zu können.
Noch überraschter waren die MIT-Forscher, als sie die elektrische Spannung, die an beiden Enden der hauchdünnen Probe anlag, etwas veränderten. Dadurch gelangten mehr Ladungsträger in das Material, statt 1,6 Billionen tummelten sich plötzlich 1,8 Billionen in jedem Quadratzentimeter. Das schien den Ausschlag zu geben: Plötzlich flitzten die Elektronen ohne elektrischen Widerstand durch das zweilagige Gitter.
Der Trick mit dem Twist
Eine Sache elektrisierte die Forscher dabei besonders: Die Supraleitung in zweilagigem Graphen wies verblüffende Ähnlichkeiten zu den Vorgängen in Hochtemperatur-Cupraten auf. Auch dort hängen die Leitungseigenschaften empfindlich von der Elektronendichte ab; auch dort ist es nur ein kurzer Weg von Isolator zu Supraleiter. »Das hat die riesige Begeisterung ausgelöst«, sagt Dante Kennes.
Elektronen scheinen in magischem Graphen auf eine besondere Art und Weise miteinander zu interagieren, Physiker sprechen von »starken Korrelationen« zwischen Ladungsträgern. Für sie interessieren sich Experten schon lange. Denn sie spielen vermutlich auch bei reichlich exotischen Materiezustände eine wichtige Rolle, beispielsweise in dem Quark-Gluon-Plasma, welches das Weltall kurz nach dem Urknall füllte, oder im dicht gepackten Inneren von Neutronensternen.
Dass man Elektronen in Graphen zu dieser Form der Interaktion bringen kann, hatten bereits Allan MacDonald und Rafi Bistritzer in ihrem Aufsatz von 2011 vermutet. Die beiden sagten zwar keine Supraleitung voraus. Sie erkannten jedoch, dass zwei um 1,1 Grad verdrehte Graphenschichten ein so genanntes Moiré-Muster bilden.
Darin sind die Atome in bestimmten Regionen gerade so gestapelt, dass Elektronen leicht von einer Schicht in die andere »tunneln« können. Das raubt ihnen nahezu ihre gesamte Bewegungsenergie. »Die Elektronen bleiben fast stehen«, erläutert Dmitri Efetov, der am Institut für Photonische Wissenschaften und am Barcelona Institute of Science and Technology forscht.
Wenn sich Elektronen auf die Pelle rücken
Die Elektronen stranden gewissermaßen an einem Gitterplatz – und rücken so zwangsläufig ihresgleichen auf die Pelle. Statt einer ausgedehnten Bandstruktur steht den Ladungsträgern lediglich ein stark abgeflachtes Energieband offen. Statt Bewegungsenergie haben sie fast nur noch »potenzielle« Energie.
Konkret bedeutet das: Die Elektronen spüren zwar die elektrostatische Abstoßung ihrer Artgenossen, können aber nicht entkommen. In Fluchtrichtung, auf dem nächsten Gitterplatz, wartet schließlich gleich das nächste Atom mit gefangenem Elektron.
Daher treten plötzlich quantenphysikalische Effekte in den Vordergrund: Die »Wellenfunktionen« der Teilchen, mit denen sich ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit berechnen lässt, überlappen in starkem Maße. Die Elektronen kondensieren dadurch zu einer Art Quantenflüssigkeit, was ganz neue Dynamiken ins Spiel bringt.
Die theoretische Festkörperphysik stößt hier seit Langem an ihre Grenzen: Zwar gibt es Modelle für starke Korrelationen zwischen Elektronen, aber sie arbeiten mit groben Vereinfachungen. Die reale Situation, wie sie in echten Atomgittern auftritt, lässt sich wegen der gigantischen Zahl an Variablen allenfalls näherungsweise berechnen. »Wie so oft in der Physik sind es die interessantesten Probleme, die theoretisch sehr herausfordernd sind«, sagt Mathias S. Scheurer von der Harvard University.
Gitterschwingungen gegen Spinwellen
So ist es bislang ein Rätsel, wieso die stark wechselwirkenden Elektronen magisches Graphen in einen Isolator verwandeln, bei einer etwas anderen Ladungsträgerkonzentration aber auch Supraleitung zulassen. Ideen gibt es viele. Sie lassen sich grob in zwei Lager einordnen: Ein Teil der Forscher argumentiert, dass es – ähnlich wie in konventionellen Tieftemperatursupraleitern – Gitterschwingungen sind, welche die Elektronen aus ihrem Gefängnis befreien.
Die Schwingungen koppeln die Elektronen demnach zu Cooper-Paaren und bahnen ihnen so einen Weg durch den Festkörper. In diesem Fall hätte die Supraleitung in magischem Graphen nichts mit den Wechselwirkungen zwischen den eingesperrten Elektronen zu tun. Die starken Korrelationen wären vielmehr eine Eigenschaft des isolierenden Zustands, die verloren geht, sobald es zur Supraleitung kommt.
Andere Experten favorisieren ein insgesamt spannenderes Szenario. Ihm zufolge stecken die starken Interaktionen zwischen Elektronen sowohl hinter dem isolierenden Zustand als auch hinter der Supraleitung. Die beiden Zustände wären demnach keine Konkurrenten, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Gitterschwingungen müssten damit nicht mehr die Rolle als Mediator zwischen den Cooper-Paaren spielen.
Damit bräuchte man aber einen anderen Mechanismus, der die Elektronen aneinanderklebt. In Frage kommt eine Theorie, die Experten auch als Ursache der Supraleitung in Cupraten diskutieren. Ihr zufolge könnten periodische Schwankungen in den Spins der Elektronen die Cooper-Paare zusammenführen. Die Ausrichtung des Spins (eine Art quantenphysikalische Eigenrotation) legt den Magnetsinn der Teilchen fest, der andere Partikel beeinflussen kann. Entsprechend würden die Elektronen nicht Gitterschwingungen hin- und herschicken, sondern Magnetschwingungen.
Aber sind diese Spinwellen wirklich das Geheimnis hinter der Hochtemperatursupraleitung? Und wenn ja, wie genau geht der Prozess vonstatten? Trotz 30 Jahre intensiver Forschung mit Cupraten ist die Frage noch unbeantwortet. Zwar haben Wissenschaftler immer wieder experimentelle Fortschritte gemacht. So konnten sie beispielsweise zeigen, dass die Cooper-Paare in den Hochtemperatursupraleitern bestimmte Richtungen zu bevorzugen scheinen; Experten sprechen von einer d-Wellen-Symmetrie. Sie würde man auch erwarten, wenn die Cooper-Paare auf Spinfluktuationen zurückgehen.
Mit Graphen ist vieles leichter
Ein eindeutiger Beweis ist das aber noch nicht. Und die Untersuchung von Cupraten ist mühsam, nicht nur weil man ihre komplizierten, dreidimensionalen Atomgitter kaum simulieren kann. Man muss auch mit aufwändigen »Dotierungen« arbeiten, um die Zahl der Elektronen zu verändern. Gemeint sind Fremdkörperatome, die Forscher unter großem Aufwand in das Kristallgitter einfügen.
Bei zweilagigem, unter dem magischen Winkel verdrehten Graphen kann man sich diesen Aufwand sparen. Hier reicht es, die an eine Probe angelegte Spannung zu variieren, um die Elektronendichte zu verändern. Und anders als die Cuprate mit ihrer abschreckenden Chemie besteht Graphen nur aus einem einzelnen Element – den Atomen des Kohlenstoffs. »Es ist so simpel aufgebaut, dass wir die physikalischen Abläufe darin wahrscheinlich wirklich verstehen können«, sagt Kennes.
»Wenn in Graphen wirklich Elektron-Elektron-Interaktionen hinter der Supraleitung stecken, könnte man in der Tat einiges über die Hochtemperatursupraleitung lernen«, findet auch Mathias Scheurer. Zwar könne man von den verdrehten Kohlenstoffschichten nicht automatisch auf die Vorgänge in Cupraten schließen. »Aber mit Graphen könnte man dann die Modelle verfeinern und ausbauen«, sagt der Harvard-Theoretiker.
Hunderte Theorien, aber nur wenige Experimente
Bisher gibt es allerdings nur wenige experimentelle Untersuchungen, die der Supraleitung in magischem Graphen nachspüren. Von den etwa 15 Gruppen, die schon länger über die nötigen Techniken verfügen, hätte erst eine Hand voll Ergebnisse publiziert, erzählt Dmitri Efetov. Dem gegenüber stehen viele hundert Fachaufsätze mit theoretischen Überlegungen.
Efetovs Team am Barcelona Institute of Science and Technology gelang es vor kurzem, magisches Graphen eingehender zu untersuchen als andere Gruppen. Die Ende Oktober in »Nature« publizierten Daten erhärten einen von vielen Theoretikern gehegten Verdacht: Es scheint nicht nur eine Elektronenkonzentration zu geben, bei der magisches Doppelschichtgraphen supraleitend wird, sondern mehrere.
Ausschlaggebend ist demnach, wie viele überschüssige Elektronen sich durchschnittlich in einem etwa 13 Nanometer großen Bereich des flachen Gitters befinden, einer so genannten Moiré-Zelle. Hat man es mit einer ganzen Zahl (1, 2, 3 …) zu tun, erweist sich das Material als Isolator. Weicht die Konzentration geringfügig davon ab, kommt es zur Supraleitung. »Bisher verstehen wir leider noch nicht, wieso das so ist«, sagt Efetov.
Nach wie vor ist es eine Sisyphusarbeit, zwei Graphenschichten unter dem magischen Winkel zusammenzukleben. Die Forscher müssen dazu einen wenige Mikrometer großen Graphenschnipsel mit einer Art Roboterarm drehen und vorsichtig auf die zweite Schicht pressen, die Steuerung erfolgt mit einem Joystick. Per Mikroskop überprüfen sie, ob sie die richtige Orientierung treffen. »Nur zwei von 30 Proben eignen sich am Ende für weiterführende Tests«, erläutert Efetov.
Bislang haben die Wissenschaftler vor allem den elektrischen Widerstand solcher Proben gemessen und die Reaktion auf äußere Magnetfelder. Daneben gibt es erste Ergebnisse von Untersuchungen mit Rastertunnelmikroskopen, welche die Oberfläche mit einer extrem sensitiven Spitze abfahren. »Bisher ist hier allerdings schwer zu unterscheiden, welche der beobachteten Eigenschaften auf Unsauberkeiten in den Materialproben zurückgehen – und welche auf echte Physik«, sagt Scheurer.
Mittelfristig hoffen Fachleute noch auf eine dritte, sehr anspruchsvolle Analysemethode: Bei der so genannten Photoemissionsspektroskopie feuert man Strahlung auf die Probe und katapultiert so Elektronen ins Freie. Dadurch lässt sich nachvollziehen, welche Energieniveaus den Ladungsträgern offenstehen.
Der Traum von der Topologie
Auf diese Weise könnten Experimentatoren früher oder später die Frage beantworten, ob Cooper-Paare auch in Graphen bestimmte Richtungen bevorzugen. »Damit könnte man dann viele Modelle falsifizieren«, sagt Kennes. So würde eine d-Wellen-Symmetrie beispielsweise auf einen anderen Kopplungsmechanismus hindeuten als die aus der klassischen BCS-Theorie bekannten Gitterschwingungen.
Einige Theoretiker träumen gar von noch exotischeren Vorgängen. Manche Modelle sagen voraus, dass Spin und Bewegungsrichtung der supraleitenden Elektronen einander stark beeinflussen. Damit könnte magisches Graphen zur Klasse der »topologischen« Materialien zählen, an deren Oberflächen besonders robuste Ströme fließen. Das könnte eines Tages bei der Entwicklung störungsresistenter Quantencomputer helfen.
Erste Indizien, dass topologische Effekte zumindest im isolierenden Zustand eine Rolle spielen, fand Dmitri Efetov in seiner Untersuchung aus dem Oktober 2019. Er bemüht sich jedoch, die Erwartungen zu zügeln: »Das Feld ist noch sehr jung.« Auch mit Blick auf die Raumtemperatursupraleitung hätten er und seine Kollegen viel Arbeit vor sich. »Es kann sein, dass wir noch 10 oder 20 Jahre brauchen.« Aber das müsse ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein: »Wenn man jetzt zu schnell eine Erklärung findet, ist sie vielleicht nicht so interessant wie gedacht.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.