Teilchenphysik: Der Traum vom Myonenbeschleuniger
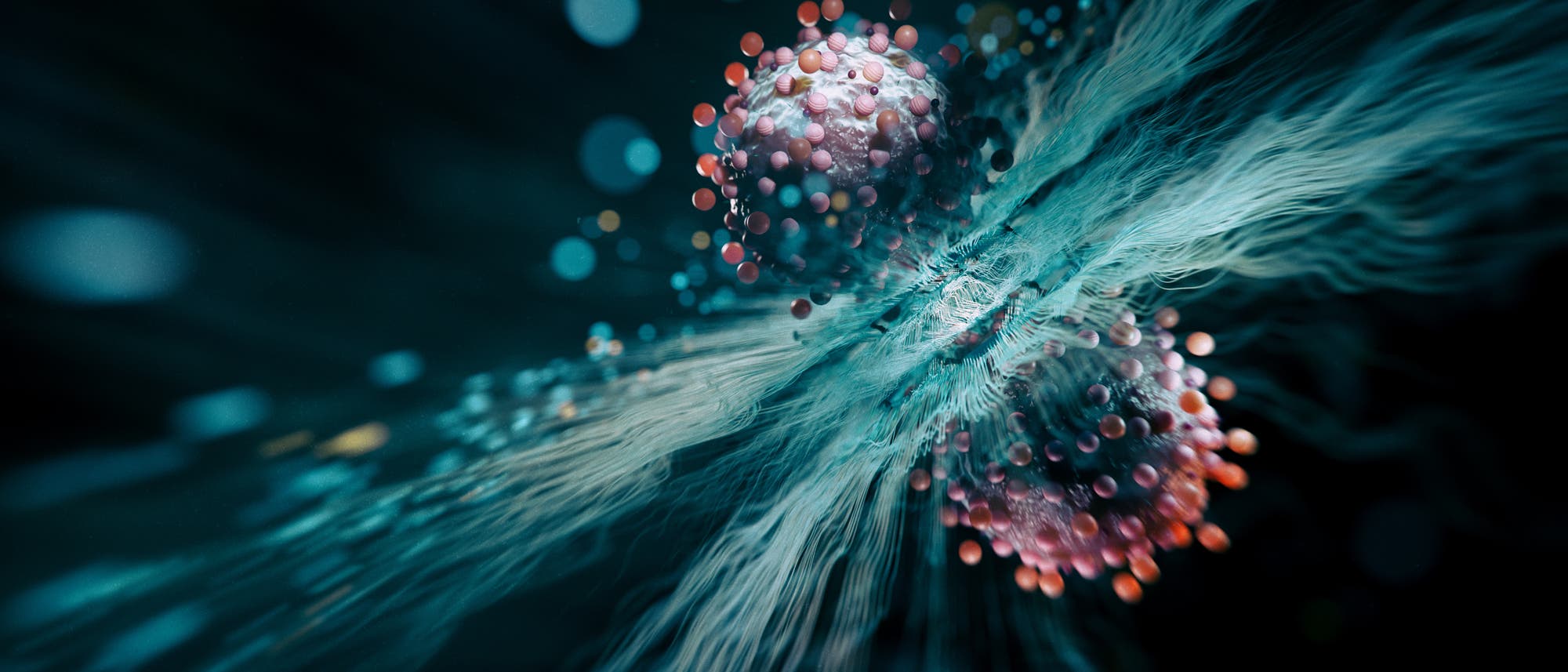
Seit Jahrzehnten ergründen Fachleute die Bausteine des Universums, indem sie subatomare Teilchen mit immer höheren Energien aufeinanderprallen lassen. Doch der nächste große Teilchenbeschleuniger wird möglicherweise erst in 50 Jahren fertiggestellt. Daher befürchtet etwa die Teilchenphysikerin Tova Holmes von der University of Tennessee in Knoxville, dass ihre gerade erst begonnene Karriere zu Ende sein könnte, bevor sie jemals eine solche Maschine zu Gesicht bekommt: »Ich werde dann definitiv nicht mehr arbeiten, vielleicht bin ich schon tot.«
Das ist einer der Gründe, warum sie sich gemeinsam mit Dutzenden ihrer Altersgenossen für die Entwicklung eines exotischen neuen Beschleunigers einsetzt. Der derzeit leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger ist der 27 Kilometer lange Large Hadron Collider (LHC) am Europäischen Laboratorium für Teilchenphysik CERN. Dort prallen Protonen bei enormen Energien zusammen, was 2012 den Nachweis des lange gesuchten Higgs-Bosons ermöglichte. Am CERN hofft man nun, einen viel größeren Protonenbeschleuniger mit höherer Energie bauen zu können. Er soll fast 100 Kilometer lang sein – aber erst zwischen 2070 und 2080 fertig werden. Deshalb untersuchen Holmes und andere eine Alternative: einen Beschleuniger, der energiereiche Myonen – die schwereren Cousins der Elektronen – auf ihre ebenso energiereichen Antiteilchen schmettert.
Ein Beschleuniger für Myonen könnte viel kleiner und günstiger sein als eine entsprechend energiereiche Variante für Protonen, argumentieren Befürworter der Technik. Er würde etwa auf den sich über 2750 Hektar erstreckenden Campus des Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) passen, des größten Teilchenphysiklabors der USA. Im Wettstreit um den Beschleuniger mit der höchsten Energie würden die Vereinigten Staaten damit die Führung übernehmen. Das Wichtigste sei aber, so sagen die jungen Befürworter, dass er schneller gebaut werden könnte als sein konventionelles Pendant – vielleicht schon in 25 Jahren. »Lasst uns noch zehn Jahre draufschlagen, das ist immer noch viel besser, als dann, wenn ich tot bin«, sagt Holmes.
»Wenn man die Herausforderung in einem Wort zusammenfassen will, dann wäre das die Instabilität des Myons«Sergo Jindariani, Teilchenphysiker
An der Sache gibt es nur einen Haken: Niemand weiß, ob sich ein Myonenbeschleuniger tatsächlich umsetzen lässt. Das liegt daran, dass das Myon im Gegensatz zum Proton oder Elektron nicht ewig existiert, sondern in nur einem Bruchteil einer Sekunde zerfällt. »Wenn man das Hauptproblem auf den Punkt bringen will, dann ist das die Instabilität des Myons«, erklärt Sergo Jindariani, Teilchenphysiker am Fermilab. »Daher muss jede Beschleunigungsstufe unglaublich schnell ablaufen«, von der Erzeugung der Myonen über die Fokussierung auf kompakte Strahlen bis hin zur Kollision, bei der dann neue Teilchen entstehen, die man beobachten will. Aus diesem Grund gibt es bei einer solchen Maschine bislang nicht da gewesene technologische Herausforderungen.
Dennoch wollen einige Fachleute, insbesondere in den USA, die Aufgabe angehen. Im Dezember 2023 legte der Beratungsausschuss Particle Physics Project Prioritization Panel (P5) eine Roadmap für das nächste Jahrzehnt der US-Forschung vor. Der Bericht fordert die Erforschung und Entwicklung eines Myonenbeschleunigers. Aber worauf genau zielen die Physiker ab? Und welche Hindernisse müssen sie überwinden, um die Maschine ihrer Träume zu verwirklichen?
Wie die Welt aufgebaut ist
Albert Einstein erkannte, dass Energie gleich Masse ist. Wenn man subatomare Teilchen aufeinanderprallen lässt, können daher aus der frei werdenden Bewegungsenergie neue Teilchen entstehen – flüchtige Partikel, wie sie seit dem Urknall nicht mehr existiert haben. Indem Fachleute solche Exoten erzeugt und ihren Zerfall beobachtet haben, konnten sie eine Theorie der Elementarteilchen erarbeiten: das Standardmodell der Teilchenphysik.
Dieses Modell umfasst vier Teilchen, aus der die gewöhnliche Materie besteht: das Elektron, das um den Atomkern kreist; das Elektronneutrino, das aus einer Art Kernzerfall hervorgeht, sowie das Up-Quark und das Down-Quark, die sich zu Dreiergruppen verbinden und die Protonen und Neutronen der Atomkerne bilden. Zwei Gruppen ähnlicher, aber schwererer Teilchen können kurzzeitig entstehen: das Myon, das Myonneutrino, das Charm-Quark und das Strange-Quark sowie das Tau (auch Tauon genannt), das Tauneutrino, das Top- und das Bottom-Quark (machmal auch als Beauty-Quark bezeichnet).
Das Standardmodell beschreibt, wie diese Teilchen und ihre Antiteilchen durch drei der vier Grundkräfte wechselwirken. Das sind erstens der Elektromagnetismus, zweitens die starke Kernkraft, die Quarks bindet, und drittens die schwache Kernkraft, die es Quarks und anderen Teilchen ermöglicht, zu zerfallen und sich ineinander zu verwandeln. Die Schwerkraft ist nicht Teil der Theorie. Die drei genannten Kräfte wirken, indem die Materieteilchen andere Teilchen austauschen. Die elektromagnetische Kraft wird durch das Photon übertragen, die starke Kernkraft durch das Gluon und die schwache Kernkraft durch das so genannte W- und Z-Boson. Das Higgs-Feld vervollständigt die Theorie, indem es den Teilchen eine Masse verleiht.
Ein Großteil der Theorie beruht auf Erkenntnissen aus Beschleunigerexperimenten – typischerweise mit Kreisbeschleunigern, die elektrisch geladene Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen lassen. Ein Beschleunigertyp schießt etwa Elektronen (e-) auf ihre Gegenstücke aus Antimaterie, die Positronen (e+). Diese so genannten e+e--Collider haben allerdings Schwierigkeiten, hohe Energien zu erreichen. Das liegt daran, dass kreisförmig bewegte geladene Teilchen Röntgenstrahlen aussenden; je leichter, desto intensiver. Elektronen haben nur 0,05 Prozent der Masse eines Protons, daher strahlen sie extrem stark, was ihre kinetische Energie begrenzt. Ab einem bestimmten Punkt verhält sich ein kreisförmiger e+e--Beschleuniger, dem man Energie zuführt, wie ein undichter Eimer, der genauso schnell Wasser verliert, wie es hineingepumpt wird.
Um höhere Energien zu erreichen, bauen Fachleute in der Regel größere, leistungsstärkere Beschleuniger, die Protonen entweder mit ihresgleichen oder mit Antiprotonen zusammenprallen lassen – so genannte Hadron-Collider. Aber auch diese Varianten haben ihre Grenzen. Ein Proton besteht aus Quarks und Gluonen. Wenn zwei Protonen aufeinanderprallen, ist es daher wahrscheinlich, dass nur je ein einziger Bestandteil aus den zwei Teilchen kollidiert. Dadurch werden weniger als zehn Prozent der Protonenergie in neue Partikel umgewandelt, was den Energievorteil der Maschine erheblich schmälert. Die verbleibenden Fragmente der Protonen erzeugen weitere Partikel. Im Gegensatz dazu verbraucht eine Elektron-Positron-Kollision die gesamte Energie der beiden Teilchen und lässt keine zusätzlichen Partikel entstehen. Daher verwenden Physiker häufig einen e+e--Beschleuniger als Präzisionsinstrument, um die an einem Hadron-Collider gefundenen neuen Teilchen eingehender zu untersuchen.
Forschende am CERN entdeckten zum Beispiel 1983 mit einem Proton-Antiproton-Collider bei einer Energie von 540 Gigaelektronvolt (GeV) die W- und Z-Bosonen der schwachen Kernkraft. Anschließend begann das CERN, den 27 Kilometer langen Tunnel an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich zu bohren, um den Large Electron-Positron Collider (LEP) zu bauen. Mit diesem ließen sich die beiden Teilchen im Detail untersuchen. Anhand der Ergebnisse ihrer Experimente schlussfolgerten die Beteiligten, dass es höchstwahrscheinlich nur drei Generationen von Materieteilchen gibt. Später baute das CERN im selben Tunnel den LHC, der Protonen mit 14 Teraelektronvolt (TeV) aufeinanderprallen lässt. So wurde schließlich das Higgs-Boson gefunden.
Diese Entdeckung vervollständigte zwar das Standardmodell, dennoch blieben die Fachleute ratlos zurück. Denn die Theorie weist weiterhin Mängel auf. Zum Beispiel schließt sie nicht die Dunkle Materie ein, jene mysteriöse Substanz, die offenbar 85 Prozent der Materie im Universum ausmacht. Physikerinnen und Physiker hofften, dass der LHC weitere neue Teilchen ausspucken würde, die ihnen zu einem tieferen Verständnis verhelfen würden. Bisher war das jedoch nicht der Fall.
Daher überlegt das CERN, nachdem der LHC im Jahr 2041 abgeschaltet wird, größere Beschleuniger zu konstruieren. Das Labor plant einen 91 Kilometer langen Tunnel mit einem e+e--Ring, dem Future Circular Collider-ee (FCC-ee), der etwa 16 Milliarden Euro kosten würde. Der soll mit 350 GeV betrieben werden, was wahrscheinlich die Grenze dieser Technik darstellt. Bis Mitte der 2040er Jahre soll der Beschleuniger fertig gestellt sein. Die Forschenden wollen damit das Higgs-Teilchen genauer untersuchen, als es der LHC vermag. 30 Jahre später würde das CERN ihn durch einen 100-TeV-Hadron-Collider namens FCC-hh ersetzen, der nach neuen Teilchen suchen und knapp 50 Milliarden Euro kosten könnte.
Die Vorteile eines Myonenbeschleunigers
Ein Myonenbeschleuniger könnte die Stärken von Hadron- und e+e--Beschleunigern vereinen. Zudem wäre er möglicherweise schneller und kostengünstiger zu bauen. Mit einer Masse, die 207-mal so groß ist wie die des Elektrons, strahlt ein Myon viel weniger Energie ab, wenn es im Kreis beschleunigt wird. Dementsprechend könnte ein Myonenbeschleuniger wesentlich höhere Energien erreichen als ein e+e--Synchrotron. Zudem sind Myonen Elementarteilchen, das heißt, sie setzen sich nicht aus anderen Partikeln zusammen. Sie bringen also ihre gesamte Energie in eine Kollision ein, weshalb ein Myonenbeschleuniger mit einem Hadron-Collider mithalten könnte, der mit der zehnfachen Energie betrieben wird. Der Myonenbeschleuniger wäre also voraussichtlich viel kleiner und damit kostengünstiger. Eine 10-TeV-Maschine könnte bereits für rund 17 Milliarden Euro zu haben sein, schätzen Befürworter.
Das Konzept eines Myon-Colliders reicht bereits Jahrzehnte zurück. 2010 startete das Fermilab ein Programm zu seiner Entwicklung, das jedoch einige Jahre später wieder durch das US-amerikanische Energieministerium gestoppt wurde. Die Behörde finanziert einen Großteil der Teilchenphysikforschung in den Vereinigten Staaten und benötigte die finanziellen Mittel für ein anderes Experiment: ein 3,3 Milliarden Dollar teures Projekt, das Myon-Neutrinos vom Fermilab in Illinois zu einem gigantischen unterirdischen Detektor in South Dakota schießen soll. Das abgebrochene Projekt sei bei Beschleunigerexperten beliebter gewesen als bei Teilchenphysikern, sagt Diktys Stratakis vom Fermilab. »Wir hatten ein sehr schönes Produkt, aber wir fanden keine Kunden«, resümiert er. Das habe sich jedoch geändert, so Stratakis. »Nun kommen viele zu uns und fragen: ›Könnt ihr einen Beschleuniger mit diesen Eigenschaften bauen?‹«
Ein Grund dafür sei die Erkenntnis, dass der Bau des FCC-hh technologisch »viel schwieriger sein wird, als man dachte«, erläutert der theoretische Physiker Hitoshi Murayama von der University of California in Berkeley. Murayama hatte den Vorsitz des jüngsten P5-Teams inne. So würde die Maschine beispielsweise Lenkmagnete mit Feldern von 16 Tesla benötigen – 33 Prozent mehr, als es der aktuelle Stand der Technik hergebe, und wahrscheinlich für weitere 20 Jahre nicht zu erreichen, sagt Murayama.
Gleichzeitig möchten Physikerinnen und Physiker höhere Energien erreichen. Das liegt an dem, was der LHC – zumindest bisher – nicht gefunden hat: keine Dunkle Materie, keine winzigen Schwarzen Löcher, keine von der Supersymmetrie vorhergesagten Teilchen (diesem Konzept zufolge gibt es für jedes Teilchen im Standardmodell einen massereicheren »Superpartner«). »Wären am LHC viele neue Dinge entdeckt worden, würden wir diese natürlich im Detail untersuchen und uns vielleicht nicht allzu viele Gedanken über höhere Energien machen«, sagt die Experimentalphysikerin Rachel Yohay von der Florida State University, die an einem LHC-Experiment arbeitet. Da dies jedoch nicht der Fall ist, besteht großes Interesse daran, höhere Energien zu erreichen.
Der wichtigste Grund für einen Myon-Collider ist aber vielleicht noch ein anderer. Ein solcher Beschleuniger könnte das optimale Werkzeug sein, um die drängenden Fragen zu beantworten, welche die Entdeckung des Higgs-Bosons aufgeworfen hat. Das Teilchen ist Teil des so genannten Higgs-Mechanismus, der in den 1970er Jahren dem Standardmodell hinzugefügt wurde, um ein wichtiges Rätsel zu lösen. Mathematische Symmetrien innerhalb des Standardmodells deuten darauf hin, dass die schwache Kernkraft und der Elektromagnetismus verschiedene Aspekte einer einzigen »elektroschwachen« Kraft sind. Der Elektromagnetismus kann jedoch im Prinzip das gesamte Universum durchdringen, während es die schwache Kraft nicht einmal durch einen Atomkern schafft.
Fachleute haben eine Erklärung dafür: Der Elektromagnetismus hat eine große Reichweite, weil das Photon masselos ist. Im Gegensatz dazu haben die Teilchen, welche die schwache Kernkraft vermitteln – das W-Boson und das Z-Boson –, eine Masse. Aber es gibt einen Haken. Fügt man dem Standardmodell die W- und Z-Massen hinzu, zerstört das die mathematische Symmetrie, welche die schwache Kraft überhaupt erst erzeugt. Die Massen müssen also irgendwie entstehen, statt von Grund auf da zu sein. Hier kommt nun der Higgs-Mechanismus ins Spiel. Demnach enthält das Vakuum ein Higgs-Feld, ähnlich wie ein permanentes elektrisches Feld. Die sonst masselosen W- und Z-Bosonen wechselwirken mit dem Feld und gewinnen dabei Energie und damit Masse.
Aber warum bleibt das Higgs-Feld bestehen? Im Standardmodell geht man davon aus, dass es auf gewisse Weise mit sich selbst wechselwirkt. So wird sichergestellt, dass seine Energie dann am niedrigsten ist, wenn die Feldstärke nicht null ist. Aber niemand weiß, ob diese Annahme richtig ist, sagt der theoretische Physiker Nathaniel Craig von der University of California in Santa Barbara. »Wir wissen, dass das Higgs-Feld überall im Raum diesen Hintergrundwert hat, aber wir wissen nicht wirklich, warum.«
Um zu untersuchen, wie das Higgs-Feld mit sich selbst wechselwirkt, braucht man Kollisionen, aus denen mehrere Higgs-Bosonen hervorgehen. Am LHC beobachten Forschende gelegentlich ein einzelnes Higgs-Paar. Nach seiner technischen Aufrüstung in den Jahren 2026 bis 2029, mit der die Kollisionsrate verfünffacht wird, sollten sich mehr von diesen Ereignissen beobachten lassen. Der geplante FCC-ee des CERN würde noch deutlich mehr davon aufweisen. Gleichwohl müssten die Forschenden Ereignisse mit mindestens drei oder vier Higgs-Teilchen beobachten. Dazu wäre eine Maschine mit höherer Energie notwendig. Hier könnte ein 10-TeV-Myonenbeschleuniger einen Vorteil gegenüber einem 100-TeV-Proton-Collider bringen.
Das liegt daran, dass sich Protonen beim Zusammenprall wegen der starken Kernkraft fast immer gegenseitig zerfetzen, wodurch nur selten ein Higgs entsteht. Myonen wechselwirken hingegen durch die elektromagnetische und die schwache Kraft, weshalb sie mit höherer Wahrscheinlichkeit die begehrten Teilchen erzeugen. Die Fähigkeit eines Myonenbeschleunigers, die Higgs-Physik genauer zu untersuchen, hebe ihn von anderen Beschleunigerarten ab, sagt die Experimentalphysikerin Donatella Lucchesi von der Universität Padua. »Das ist eine Gelegenheit, die wir nicht verpassen sollten, sie ist extrem wichtig«, meint sie.
Die Empfindlichkeit eines Myonenbeschleunigers gegenüber der schwachen Kernkraft könnte auch dabei helfen, nach Dunkler Materie zu suchen. Theoretische Physiker vermuten, dass sie aus schweren Teilchen bestehen könnte, die nur durch die schwache Kernkraft wechselwirken. Solche »WIMPs« wurden jedoch noch nicht nachgewiesen. Ein Myonenbeschleuniger könnte WIMPs erzeugen, die zu schwach wechselwirken, um bei den aktuellen Experimenten am LHC oder in empfindlichen Detektoren unter der Erde entdeckt zu werden, hofft Craig.
Ein Myonenbeschleuniger könnte sogar die Supersymmetrie auf Herz und Nieren prüfen. Das jahrzehntealte Konzept würde viele Dinge erklären, beispielsweise woher WIMPs kommen. Hauptsächlich soll Supersymmetrie jedoch ein noch größeres Rätsel lösen. Die Quantenmechanik sagt voraus, dass bekannte Teilchenarten flüchtig aus dem Vakuum um das Higgs-Boson herum auftauchen und mit ihm wechselwirken, wodurch es eine große Masse erhält. Das passiert jedoch nicht – und es ist unklar, warum. Die Supersymmetrie liefert hierfür eine Antwort: Demnach hat das Higgs-Teilchen schwach wechselwirkende Superpartner mit geringer Masse, die diesem Effekt entgegenwirken, sagt Craig. Ein Myonenbeschleuniger wäre ideal geeignet, um diese Partner aufzuspüren.
Lässt sich ein Myonenbeschleuniger überhaupt bauen?
Ein Myonenbeschleuniger würde aus bekannten Bauteilen bestehen. In so genannten RF-Hohlraumresonatoren bilden sich stehende Radiowellen, durch die die Teilchen beschleunigt werden. Magneten lenken und fokussieren die Strahlen. Allerdings müsste eine solche Maschine unglaublich schnell arbeiten, da das Myon extrem kurzlebig ist; es zerfällt im Mittel nach 2,2 Mikrosekunden zu einem Elektron, einem Neutrino und einem Antineutrino. Sehr energiereiche Myonen, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen, leben wegen der von Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagten Zeitdilatation ein klein wenig länger, nämlich Millisekunden.
Die Uhr fängt an zu ticken, sobald die Myonen entstehen. Die Fachleute schießen dazu zunächst einen Protonenstrahl auf ein spezielles so genanntes Target, um geladene so genannte Pionen zu erzeugen. In einem Magnetfeld zerfallen sie in Myonen. Mit derselben Technik werden bereits Neutrinos für andere Experimente erzeugt. Ein Myonenbeschleuniger würde jedoch ein Targetmaterial erfordern, das einem Protonenstrahl mit einer Leistung von mehreren Megawatt standhalten kann.
Die Myonen treten dann in einer zentimeterbreiten Wolke aus. Um sie in einem Strahl mit einem Durchmesser von wenigen Mikrometern zu bündeln, muss man sie durch ein Material mit geringer Dichte wie Lithiumhydrid oder flüssigen Wasserstoff leiten. Während sie noch in einem Magnetfeld herumwirbeln, ionisieren sie Atome im Material. Dadurch verlieren die Myonen an Energie und schwirren nicht mehr herum. Ein RF-Hohlraumresonator würde die Teilchen dann in die nächste Kühlzelle beschleunigen. Dieser Schritt könnte jedoch knifflig werden, da RF-Hohlraumresonatoren in Magnetfeldern normalerweise nicht gut funktionieren.
Als Nächstes bringen zwei oder mehr Kreisbeschleuniger, so genannte Synchrotrone, die Strahlen von Myonen und Antimyonen auf ihre Endenergie. Dafür müssten die von den Lenkmagneten erzeugten Felder gleichzeitig hochfahren, um die Teilchen auf einer Kreisbahn mit festem Radius zu halten. Beim LHC dauert dieser Prozess 20 Minuten. Um die Strahlen kontinuierlich aufzufüllen, würde ein Myonenbeschleuniger dagegen Synchrotrone benötigen, die unglaubliche 400 Zyklen pro Sekunde durchlaufen können.
»Diese Maschine ist der Traum – oder der Albtraum – eines jeden Magnetherstellers«Stephen Gourlay, Beschleunigerexperte
Schließlich gelangen die Strahlen in einen kleineren Beschleuniger, einen »Speicherring«. Zehn Kilometer Strecke reichen aus – deutlich weniger als beim LHC. Darin zirkulieren Myonen und Antimyonen mit fester Energie in entgegengesetzte Richtungen und prallen in der Mitte zwischen zwei Detektoren auf den gegenüberliegenden Seiten des Rings zusammen. Ein kleinerer Ring bietet einen offensichtlichen Vorteil, sagt Stephen Gourlay, Beschleunigerexperte am Fermilab. »Man bekommt mehr Umläufe, bevor die Myonen verschwinden.«
Die verschiedenen Komponenten der Maschine würden die Grenzen der Magnettechnologie erweitern, sagt Gourlay. »Diese Maschine ist der Traum – oder der Albtraum – eines jeden Magnetherstellers.« Beispielsweise müssten die Magnete in den schnell getakteten Ringbeschleunigern ihre Felder fast augenblicklich um mehrere Tesla ändern. Dieser Prozess würde nicht nur enorme mechanische Belastungen auf die Magnete ausüben, sondern laut Gourlay auch erfordern, dass dutzende Gigawatt Leistung mit höchster Effizienz sicher in die Bauteile hinein- und aus ihnen herausgeleitet werden.
Physiker müssen die Beschleunigerkomponenten außerdem vor den Elektronen und Positronen abschirmen, die beim Zerfall der Myonen entstehen. Das ist in den Detektoren besonders kompliziert. Denn die Fachleute müssten beachten, dass sie die Teilchen nicht blockieren, die aus den Myon-Kollisionen stammen und die sie beobachten möchten. Um mit den überflüssigen Zerfallsteilchen fertig zu werden, umgibt in jedem Detektor ein Kegel aus Wolfram das Strahlrohr auf beiden Seiten des Kollisionspunktes. Elektronen und Positronen, die auf den Kegel treffen, wandeln sich dann größtenteils in wenig energiereiche Photonen und Neutronen um, die sich leichter von den gewünschten Signalen unterscheiden lassen.
Hinzu kommt, dass zerfallende Myonen energiereiche Neutrinos abstrahlen – eine neue Herausforderung für den Strahlenschutz. Die kaum fassbaren Teilchen schießen horizontal aus dem Beschleunigerring und flitzen durch das Erdreich. Einige treffen auf Atomkerne im Boden und verwandeln sich wieder in Myonen, die als gefährliche Strahlung aus dem Boden austreten könnten. Neutrinos lassen sich nicht abschirmen, aber je tiefer der Tunnel liegt, desto geringer wäre die Intensität der Myonenstrahlung an der Erdoberfläche. Es würde ebenfalls helfen, den Beschleuniger auf beweglichen Fundamenten zu errichten, so dass sich die Ausrichtung seiner Abschnitte schrittweise ändern ließe, so Stratakis. Auf diese Weise könnte man die Strahlendosis an jedem Ort begrenzen.
Die größte Herausforderung für die Entwickler könnte darin bestehen, eine neuartige »Ionisationskühlung« zum Laufen zu bringen. »Dinge, die noch nie zuvor gemacht wurden, haben höchste Priorität, weil es hier die größte Wahrscheinlichkeit für Überraschungen gibt«, sagt der Teilchenphysiker Mark Palmer vom Brookhaven National Laboratory im US-Bundesstaat New York. Palmer hat die früheren Myonbeschleuniger-Bemühungen des Fermilabs geleitet. 2020 wirbelten am International Muon Ionization Cooling Experiment im britischen Rutherford Appleton Laboratory einzelne Myonen wie vorhergesagt durch eine Kühlzelle. Aber es wurde nicht gezeigt, dass der Prozess tatsächlich einen Myonenstrahl kühlen könnte, sagt Palmer.
Angesichts so vieler Unsicherheiten drängen die US-Physiker nicht unbedingt darauf, sofort mit der Planung eines solchen Projekts zu beginnen, wie in der Presse angedeutet wurde. Stattdessen forderten sie Unterstützung für die Grundlagenforschung und -entwicklung, sagt der theoretische Physiker Patrick Meade von der Stony Brook University. »In den USA geht es in erster Linie darum, die Erlaubnis zu erhalten, in dieser Richtung überhaupt forschen zu dürfen«, erklärt Meade.
»In Europa ist der Myon-Collider so etwas wie ein Plan B«Daniel Schulte, Teilchenphysiker
Die Physikerinnen und Physiker stellen sich sieben Jahre Forschung mit jährlichen Kosten von einigen Millionen Euro vor. Damit könnten sie ermitteln, welche Art von Demonstrationsprojekt – vielleicht ein Prototyp eines Kühlkanals – am besten die Umsetzbarkeit eines Myonenbeschleunigers nachweisen könnte, sagt Stratakis. Sie würden dann ein Jahrzehnt und 100 Millionen Dollar oder mehr für den Bau und Betrieb eines Demonstrators aufwenden. Das Ziel sei, bis 2040 zu entscheiden, ob sie mit der Konstruktion eines Beschleunigers fortfahren wollen.
Auch woanders denkt man über Myonenbeschleuniger nach. 2021 startete das CERN die International Muon Collider Collaboration (IMCC), der sich US-Forschende anschließen wollen. Die Entscheidung, wo ein solcher Beschleuniger stehen könnte, werde erst dann getroffen, »wenn die Geldgeber die Mittel bereitstellen«, sagt der Teilchenphysiker Daniel Schulte vom CERN, der die 200-köpfige IMCC-Gruppe leitet.
Werden die Befürworter des Vorhabens überhaupt so weit kommen? »In Europa ist der Myonenbeschleuniger so etwas wie ein Plan B«, sagt Schulte. Und das CERN könnte sich bald für den ersten Schritt in Richtung Plan A entscheiden, den FCC-ee. In einer virtuellen Pressekonferenz im Februar 2024 sagte die damalige CERN-Generaldirektorin Fabiola Gianotti, das Labor wolle bis 2028 festlegen, ob diese Maschine gebaut werden soll. Sie merkte außerdem an, dass ein Myon-Collider »nicht im selben Zeitrahmen« liege.
Dennoch fasziniert die Idee eines Myonenbeschleunigers weiterhin etliche Physikerinnen und Physiker, insbesondere jüngere. Lucchesi sagt, sie finde mehr Masterstudenten, die an diesem Konzept arbeiten wollen, als sich den laufenden Experimenten am LHC anschließen. »Es ist nicht verlockend, etwas zum vierten oder fünften Mal zu tun, nur um Messgenauigkeiten zu verbessern«, sagt sie. »Was attraktiv ist, ist etwas Neues zu schaffen.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.