Mikroelektronik: Ein Chip mit eingebauter Wasserkühlung
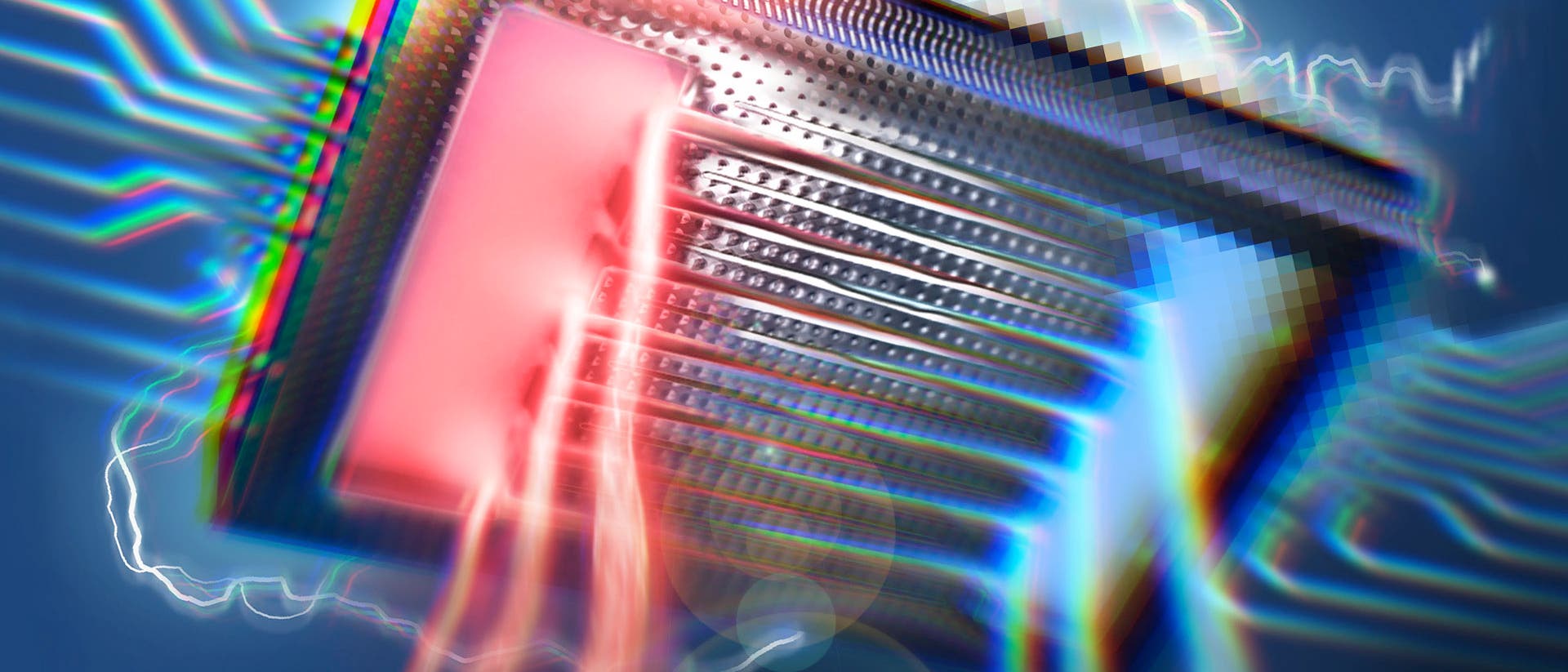
Schon seit Jahren tüfteln die Hersteller von Mikroelektronik an neuen Verfahren der Chipkühlung. Denn das herkömmliche Verfahren – aus Kühlrippen und einem Gebläse sowie voll klimatisierten Rechenzentren – ist nicht nur Platz raubend und laut, sondern auch so wenig effizient, dass viel Energie verschwendet wird. Rechenzentren in den USA verbrauchen laut einer Rechnung rund 24 Terawattstunden Energie und 100 Milliarden Liter Wasser pro Jahr allein für die Kühlung. Das entspricht in etwa dem Verbrauch einer Stadt mit 300 000 Einwohnern.
Die Wärme wird im herkömmlichen Fall auf ein externes Kühlaggregat geleitet, das beispielsweise dem Chip aufsitzt. Wesentlich eleganter wäre es, das Kühlmittel direkt an die heißen Stellen zu bringen. Das ist nun womöglich einem Forscherteam um Elison Matioli von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne gelungen. Ihrem Verfahren bescheinigt Tiwei Wei von der Stanford University in einem begleitenden Kommentar, ein »Durchbruch« zu sein.
Wie Matioli und Kollegen in ihrem Fachbeitrag in »Nature« schreiben, entsteht der Kühleffekt durch Wasser, das durch Kanäle gepumpt wird, die durch das Silizium des Chips parallel zu dessen Oberfläche verlaufen. Von diesen Kanälen wiederum zweigen zahlreiche winzige Schlitze nach oben ab, an deren Ende sich ein Pfropfen aus gut wärmeleitendem Kupfer befindet. Er transportiert die im Bauteil entstehende Hitze ins Wasser.
Die Vorrichtung kommt mit sehr wenig Pumpenergie aus, bietet aber trotzdem eine äußerst effiziente Kühlung. Das ergab zumindest ein Test, für den sie den Prototyp eines elektronischen Gleichrichters mit Hilfe ihrer Technik kühlten. Dessen Wärmefluss von 1,7 Kilowatt pro Quadratzentimeter ließ sich mit einem Energieeinsatz für das Pumpen von 0,57 Watt pro Quadratzentimeter unter Kontrolle bringen. Dadurch verbesserte sich die Leistung des Bauteils gegenüber einer ungekühlten Variante deutlich.
Forscher errechnen ein gigantisches Einsparpotenzial
Matioli und Kollegen haben das Verfahren, das sie »monolithically integrated manifold microchannel (mMMC)« nennen, so angelegt, dass es sich mit konventionellen Herstellungsverfahren realisieren lässt. Das schlage sich günstig in den Kosten nieder, wie auch Wei in seinem Kommentar bestätigt. Es könne sich aber lohnen, mit anderen Kühlmitteln als Wasser zu experimentieren, und wie es um die Haltbarkeit der Vorrichtung bestellt ist, müsse sich ebenfalls noch zeigen, schreibt der Stanford-Forscher.
Das Team um Matioli rechnet derweil schon mit einem geradezu unglaublichen Einsparpotenzial: Würde ein Rechenzentrum ausschließlich mit ihrer Technologie kühlen, sollte der für Kühlung nötige, zusätzliche Energieverbrauch von 30 Prozent »potenziell auf unter 0,01 Prozent sinken.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.