Vielteilchenphysik: Ein Maß für die Nützlichkeit eines Quantencomputers
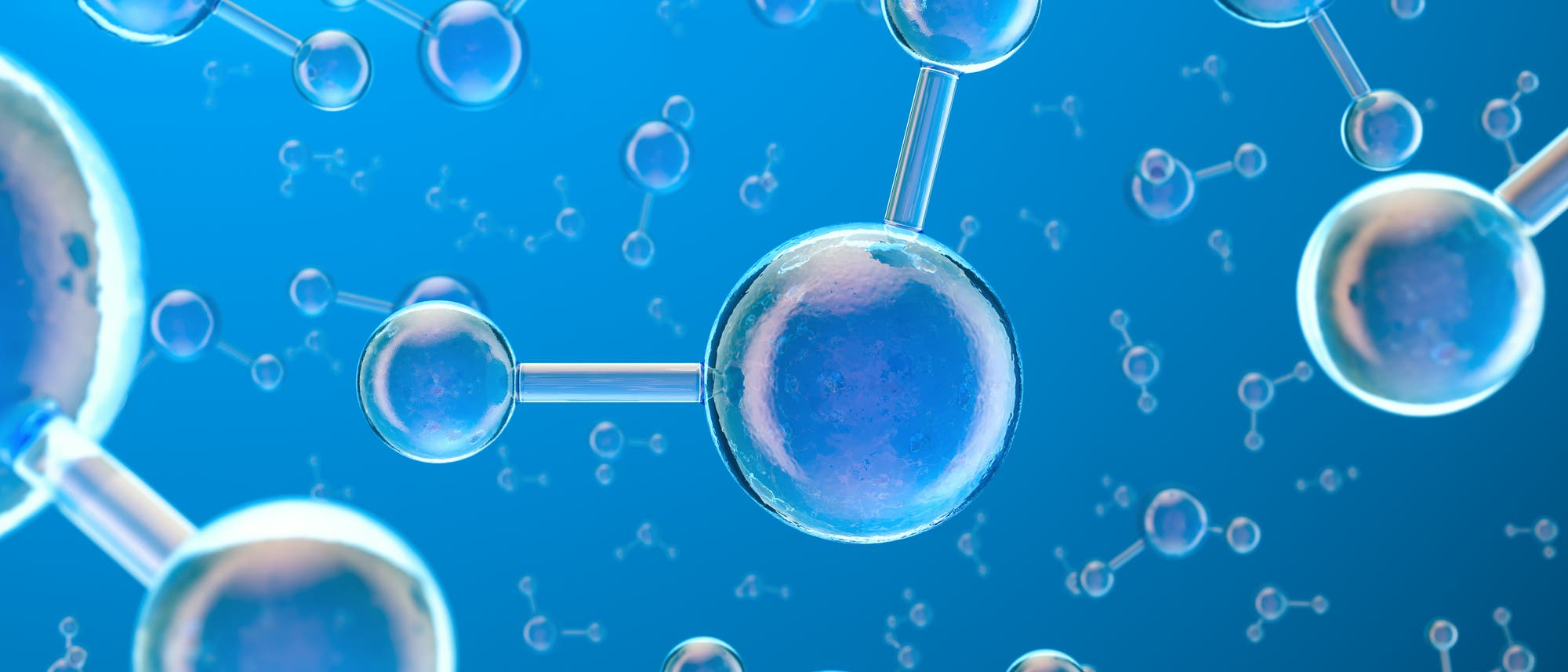
Wann werden Quantencomputer einen klaren und praktischen Vorteil gegenüber klassischen Computern haben? Immer wieder versuchen Forschungsgruppen Aufgaben zu finden, die sich mit einem quantenmechanischen System deutlich schneller lösen lassen als mit einem auf Bits und Bytes basierenden Rechner. Erst Anfang Oktober 2024 behauptete ein Team von Google Research wieder einmal, eine solche »Quantenüberlegenheit« gezeigt zu haben. Allerdings ging es dabei – so wie bereits im Jahr 2019 – um ein sehr spezielles Rechenrätsel, das keinen wirklichen Nutzen hat.
Eine internationale Forschungsgruppe hat nun eine Kennzahl entwickelt, die bemisst, wie komplex ein relevantes, physikalisches Problem tatsächlich ist – und ob es sich womöglich mit einem Quantencomputer lösen lässt. Das Team unter der Leitung von Giuseppe Carleo, Physiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, hat die Methode nun im Fachmagazin »Science« vorgestellt.
Die Studie konzentriert sich auf das so genannte Vielkörperproblem, das zu den größten Herausforderungen in der Physik zählt. Darunter werden Systeme zusammengefasst, die aus vielen miteinander wechselwirkenden Einzelteilen bestehen, etwa das berühmte Dreikörperproblem in der Gravitation, an das sich sowohl ein Sciencefiction-Roman als auch eine Netflix-Serie anlehnt. Noch komplizierter gestaltet sich die Sache, wenn man zudem Quanteneffekte berücksichtigt.
Mehr als die Summe der Teile
In der Theorie geben die Gesetze der Quantenmechanik alles her, was man braucht, um das Verhalten einzelner Teilchen wie Elektronen oder Quarks genau vorherzusagen. Wenn jedoch mehrere Teilchen miteinander wechselwirken, wie es in komplexen Molekülen oder Kristallen der Fall ist, wird diese Berechnung praktisch unmöglich. Das grundlegende Problem besteht dabei nicht in der Anzahl der beteiligten Teilchen, sondern darin, ihren Einfluss aufeinander korrekt zu erfassen.
Um beispielsweise zu ermitteln, ob ein bestimmtes Material existieren kann, muss man sein niedrigstes Energieniveau, den Grundzustand, berechnen. Ein klassischer Rechner geht dazu nacheinander alle möglichen Konfigurationen des Materials durch – eine zeitintensive Aufgabe. Bereits die exakte Berechnung des Grundzustands eines Wassermoleküls (H2O) ist für einen klassischen Supercomputer quasi unmöglich, da der Rechenaufwand exponentiell mit der Anzahl der Elektronen (in diesem Fall zehn) wächst. Fachleute müssen sich daher bislang mit mathematischen Näherungen begnügen.
Hier kommt die Quanteninformatik ins Spiel. Der Gedanke hierbei ist, dass ein Quantensystem – wie die Qubits, aus denen ein Quantencomputer besteht – der beste Weg ist, um sich einem anderen Quantensystem anzunähern. Es wurden bereits mehrere Quantenalgorithmen entwickelt, die Grundzustände effizient auf Quantencomputern berechnen können. Um zu beurteilen, ob diese Programme wirklich einen Vorteil gegenüber klassischen Algorithmen bieten, haben Carleo und seine Kollegen zunächst eine Datenbank zusammengestellt, die Grundzustandssimulationen von verschiedenen physikalischen Systemen und unter Verwendung unterschiedlicher Techniken enthält.
»Das bedeutet nicht, dass es sich um einfache Probleme handelt, sondern dass es gute klassische Methoden gibt, um sie zu lösen«Giuseppe Carleo, Physiker
Für einige dieser Simulationen kennt man die Lösung – entweder aus sehr aufwändigen Berechnungen oder aus Experimenten – und kann sie mit den Ergebnissen verschiedener Algorithmen vergleichen, um deren Fehler abzuschätzen. Auf dieser Grundlage entwickelte das Forschungsteam eine Maßzahl, die es V-Score (oder »Variationsgenauigkeit«) nennt. Der V-Score setzt sich aus der vom Algorithmus berechneten Grundzustandsenergie und der Energieschwankung zusammen.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich eindimensionale Materialien wie beispielsweise Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit klassischen Computern recht gut simulieren lassen – sie haben einen niedrigen V-Score. Das bedeute allerdings nicht, dass es sich um einfache Probleme handelt, betont Giuseppe Carleo, sondern dass es gute klassische Methoden gibt, um solche Probleme zu lösen. Bei dreidimensionalen Kristallen ist der V-Score dagegen groß: Bei der theoretischen Untersuchung solcher Systeme könnten Quantenalgorithmen künftig wirklich einen Unterschied machen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.