Langlands-Programm: Ungeahnte Verbindung zwischen Physik und Zahlentheorie
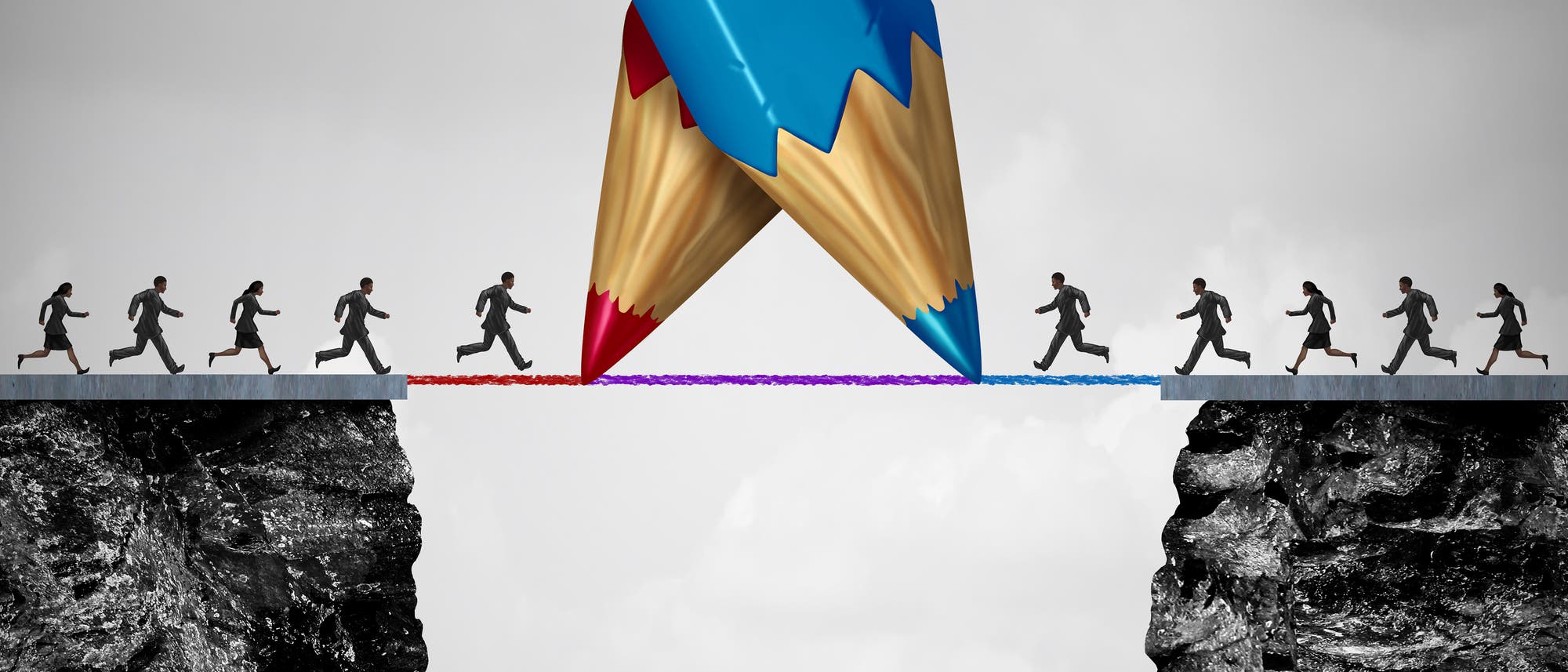
Als der australische Mathematiker Akshay Venkatesh im Jahr 2018 eine der höchsten Auszeichnungen der Mathematik erhielt, trug er einen Zettel bei sich. Darauf hatte er eine Tabelle mit abstrakten Ausdrücken notiert, die seit Jahrhunderten eine Schlüsselrolle in der Zahlentheorie spielen. Diese Symbole waren ein entscheidender Teil seiner bisherigen Forschung gewesen – und doch führte er sie nicht als Erinnerung an seine Leistungen mit sich herum, sondern als Mahnung an etwas, das er noch immer nicht verstanden hatte.
Die Spalten der Tabelle waren mit kryptisch anmutenden Zeichen gefüllt: Links befanden sich so genannte Perioden und auf der rechten Seite »L-Funktionen«, die einige der wichtigsten Fragen der modernen Mathematik beantworten könnten. Die Liste schien eine Art Beziehung zwischen beiden Strukturen nahezulegen. 2012 hatte Venkatesh zusammen mit Yiannis Sakellaridis von der Johns Hopkins University tatsächlich eine Übereinstimmung in eine Richtung herausgearbeitet: Ausgehend von manchen Perioden lassen sich zugehörige L-Funktionen konstruieren.
Die umgekehrte Beziehung blieb jedoch unklar. Es war unmöglich vorherzusagen, ob eine bestimmte L-Funktion eine passende Periode besitzt. Deshalb behielt Venkatesh den Zettel in seiner Tasche. Wenn er lange genug auf die Tabelle starrte, so hoffte er, würden ihm irgendwann die Gemeinsamkeiten dieser scheinbar zufälligen Sammlung von L-Funktionen klar werden. Doch selbst ein Jahr, nachdem er die Liste ständig mit sich herumgetragen hatte, war das nicht der Fall. »Ich konnte nicht verstehen, was das Prinzip hinter dieser Tabelle war«, sagt er.
2018 war für Venkatesh in mehr als einer Hinsicht ein großes Jahr. Er erhielt nicht nur die renommierte Fields-Medaille, eine der wichtigsten Preise des Fachs, sondern wechselte auch von der Stanford University an das Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton, New Jersey. Sakellaridis und er kamen dort mit David Ben-Zvi ins Gespräch, einem Mathematiker von der University of Texas in Austin, der ein Semester am gleichen Institut verbrachte. Ben-Zvi hatte seine Karriere in einem ähnlichen Bereich wie seine beiden Kollegen aufgebaut. Er untersuchte dieselben Fragen, für die sich Sakellaridis und Venkatesh interessierten, allerdings von einem geometrischen Standpunkt aus. Als er einen Vortrag von Venkatesh über die geheimnisvolle Tabelle hörte, erkannte Ben-Zvi eine neue Möglichkeit, um Perioden und L-Funktionen miteinander zu verbinden.
Dieser Moment gab den Anstoß zu einer mehrjährigen Zusammenarbeit, die im Juli 2023 mit der Veröffentlichung eines 451-seitigen Manuskripts ihren Höhepunkt fand. Darin entwickelten die Forscher eine Art Wörterbuch, das zwischen Perioden und L-Funktionen übersetzt. Als gemeinsamer Nenner dienten dabei geometrische Räume, in die man Perioden und L-Funktionen in einem Zwischenschritt umwandeln musste, um von der einen Struktur auf die andere zu kommen.
Auf diese Weise haben die Wissenschaftler einen lang gehegten Traum verwirklicht, der in den Bereich des Langlands-Programms fällt. Bei diesem geht es darum, Brücken zwischen unterschiedlichen mathematischen Gebieten zu schlagen. Zum Beispiel möchten Fachleute verstehen, wie fortgeschrittene Formen der Analysis (aus denen die Perioden stammen) offene Fragen in der Zahlentheorie (die Heimat der L-Funktionen) beantworten können – oder wie die Geometrie grundlegende Probleme der Arithmetik lösen kann. Wenn diese Verbindungen stehen, so hofft man, lassen sich Techniken von einem Bereich der Mathematik auf einen anderen übertragen.
Die neue Arbeit ist eine der ersten, welche die geometrische und die arithmetische Seite des Programms miteinander verbindet – zwei Gebiete, die jahrzehntelang weitgehend isoliert voneinander voranschritten. Durch diese Verknüpfung bietet das Manuskript einen neuen Rahmen für weitere Brücken. »Die Arbeit vereinigt zuvor disparat erscheinende Phänomene. Das ist für Mathematiker immer erfreulich«, sagt Minhyong Kim, Direktor des International Centre for Mathematical Sciences in Edinburgh.
Eine ehrgeizige Vision
Robert Langlands, heute emeritierter Professor am Institute for Advanced Study, initiierte das nach ihm benannte Programm im Jahr 1967. Er war damals ein junger Dozent an der Princeton University und schickte einen 17-seitigen, handgeschriebenen Brief an Andre Weil, einen der renommiertesten Mathematiker. Langlands schlug vor, Objekte der Infinitesimalrechnung, die so genannten automorphen Formen, mit Teilen der Algebra, den »Galoisgruppen«, zu verbinden. Erstere stellen eine Verallgemeinerung von periodischen Funktionen wie der Sinusfunktion dar. Galoisgruppen beschreiben hingegen, wie sich algebraische »Körper« (wie die reellen oder die rationalen Zahlen) verändern, wenn man sie um neue Elemente erweitert (etwa die rationalen Zahlen um √2).
Das Langlands-Programm
1967 äußerte der damals frischgebackene Professor Robert Langlands eine Reihe von Vermutungen, wie verschiedene Bereiche der Mathematik zusammenhängen könnten. Insbesondere sollte es eine Brücke geben, die »automorphe Formen« aus dem Bereich der Zahlentheorie mit so genannten Galoisgruppen verbindet.
Man kann sich automorphe Formen als verallgemeinerte periodische Funktionen vorstellen. Während gewöhnliche trigonometrische Funktionen wie eine Sinusfunktion Zahlen anderen Zahlen zuordnen, weisen automorphe Formen auch komplizierteren mathematischen Strukturen Zahlenwerte zu. Mit ihrer Hilfe lassen sich Strukturen in Zahlenräumen untersuchen, etwa die Verteilung der Primzahlen. Das Bild zeigt die Dedekindsche Eta-Funktion, ein Spezialfall einer automorphen Form.
Galoisgruppen stammen hingegen aus dem Reich der Algebra. Mit ihnen lässt sich die Struktur eines Körpers untersuchen – etwa, um herauszufinden, was passiert, wenn man die rationalen Zahlen um den Wert √2 erweitert. Mit Hilfe von Galoisgruppen lässt sich unter anderem beweisen, dass es keine »p-q-Formel« für Polynomgleichungen fünften Grades gibt.
Solche Brücken, wie die zwischen automorphen Formen und Galoisgruppen, werden als Dualitäten bezeichnet. Sie deuten darauf hin, dass verschiedene Objekte in Wirklichkeit zwei Seiten derselben Medaille sind. Das erlaubt es, das eine in Bezug auf das andere zu untersuchen.
Generationen von Fachleuten haben daran gearbeitet, die von Langlands vermuteten Dualitäten zu beweisen. Obwohl es ihnen nur bei wenigen gelungen ist, haben selbst diese seltenen Fälle oft zu spektakulären Resultaten geführt. Als Andrew Wiles zum Beispiel 1994 eine bestimmte Verbindung bewies, konnte er damit den großen Satz von Fermat belegen, einem der berühmtesten Ergebnisse des Fachs.
Der große Satz von Fermat
Auf den ersten Blick sieht das Problem recht einfach aus: Es dreht sich um die Frage, ob die Gleichung xn + yn = zn ganzzahlige, positive Lösungen x, y und z besitzt.
Für n = 1 ist sie immer erfüllt: Egal, wie man die Werte für x und y wählt, z wird stets ein positives, ganzzahliges Ergebnis sein, zum Beispiel: 3 + 6 = 9. Bei n = 2 wird es schon etwas kniffliger, denn die Gleichung ist dann quadratisch: x2 + y2 = z2. Wenn x und y ganzzahlige Werte haben, muss das nicht notwendigerweise für z gelten, etwa ergibt für x = 1 und y = 2 die Formel 12 + 22 = 5 – und 5 ist keine Quadratzahl. Das heißt, es gibt zwar eine Lösung für z (die Wurzel aus 5), die ist aber nicht ganzzahlig. Dennoch findet man Ausnahmen, für welche die quadratische Gleichung doch ein passendes Ergebnis hat, zum Beispiel: 42 + 32 = 25 = 52.
Das lässt sich geometrisch interpretieren, ganz im Sinn von Pythagoras, dessen berühmte Formel Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe begegnet: Wenn x2 + y2 = z2 ganzzahlige Lösungen x, y und z besitzen, dann gibt es rechtwinklige Dreiecke, deren Seitenlängen x, y und z ebenfalls ganzzahlige Werte haben. Und wie sich herausstellt, gibt es davon unendlich viele.
Sobald man die Gleichung aber für n = 3 betrachtet, kann man für x3 + y3 = z3 erstaunlicherweise keine einzige ganzzahlige Lösung mehr finden. Das bedeutet, ein Würfel mit ganzzahligen Seitenlängen z lässt sich nicht in zwei weitere Würfel aufteilen, die ebenfalls ganzzahlige Seitenlängen (x und y) besitzen. Gleiches gilt für alle weiteren Werte von n.
Der französische Gelehrte Pierre de Fermat (1607–1665) erkannte das schon früh – und behauptete in einer Randnotiz, das belegen zu können. In einem Buch des antiken Wissenschaftlers Diophantos von Alexandria notierte er auf Latein: »Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis entdeckt, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen.« Es war nicht das erste Mal, dass Fermat das tat. Tatsächlich hinterließ er zahlreiche ähnliche Hinweise an anderen Stellen. Alle übrigen konnte die Fachwelt nachträglich beweisen.
Davon überzeugt, dass auch dieser Beweis einfach zu realisieren sei, versuchten sich etliche Mathematikerinnen und Mathematiker, darunter namhafte Größen wie Leonhard Euler oder Ernst Eduard Kummer, daran – und scheiterten. Denn wie in dem abstrakten Fach üblich, lässt sich ein Problem nicht notwendigerweise leicht lösen, nur weil es einfach zu formulieren ist.
Tatsächlich dauerte es mehr als 350 Jahre, bis das Rätsel geknackt wurde. Der Geniestreich gelang Andrew Wiles 1994. Seine eindrucksvolle Arbeit schlug hohe Wellen: Wiles entwickelte neuartige Methoden, die zu weiteren bahnbrechenden Entdeckungen in dem Bereich führten. Dafür wurde er unter anderem 2016 mit dem Abelpreis geehrt.
Für den Beweis muss man die Algebra, die man aus der Schule kennt, verlassen und in verzweigtere mathematische Gebiete eindringen. Gerhard Frey stellte 1984 die Vermutung auf, dass man aus den Lösungen x, y und z der Gleichung xn + yn = zn für n > 2 eine seltsame Art von Kurve konstruieren könnte: eine elliptische Kurve, für die es allerdings keine Darstellung als Modulform gebe – so nennt man eine höchst symmetrische Funktion, die im Reich der komplexen Zahlen (mit Wurzeln aus negativen Werten) existiert.
Eine andere Vermutung besagt jedoch, dass sich jede elliptische Kurve als Modulform darstellen lässt. Wenn man also beide Hypothesen beweisen würde, hätte man gleichzeitig gezeigt, dass xn + yn = zn für n > 2 keine ganzzahligen Lösungen besitzt – und damit Fermats großen Satz bestätigt.
1986 konnte der Mathematiker Ken Ribet den Verdacht von Frey verifizieren. Also blieb nur noch der zweite Teil offen: Man musste zeigen, dass jede elliptische Kurve eine dazugehörige Modulform hat. Wiles gelang es Mitte der 1990er Jahre, auch diese Lücke zu schließen.
Eine Frage bleibt dabei aber offen: Fermat konnte vor mehr als drei Jahrhunderten nichts von den mathematischen Zusammenhängen gewusst haben, die Wiles und Ribet in ihrer Veröffentlichung genutzt haben. Elliptische Kurven und Modulformen waren damals unbekannt. Hatte sich der Gelehrte mit der Randnotiz einen Scherz erlaubt? Oder hatte er nur geglaubt, einen Beweis gefunden zu haben, und sich verrechnet? Es gibt eine dritte Möglichkeit: Eventuell existiert eine wesentlich einfachere Beweismethode, die bisher noch niemand anderem eingefallen ist.
Inzwischen wurde das Langlands-Programm in viele Richtungen erweitert. Ein Beispiel dafür sind Dualitäten zwischen arithmetischen Objekten. Auch wenn sie sich von dem unterscheiden, wofür sich Langlands interessierte, ähneln sie den von ihm anvisierten Verbindungen. In ihrem 2012 erschienenen Buch haben Sakellaridis und Venkatesh einen Zusammenhang zwischen Perioden und L-Funktionen (die mit Galoisgruppen verbunden sind) entdeckt. Das war erstaunlich, denn Perioden und L-Funktionen sind völlig unterschiedliche Strukturen ohne offensichtliche Gemeinsamkeiten.
Perioden wurden durch die Arbeiten des deutschen Mathematikers Erich Hecke in den 1930er Jahren zu Objekten von mathematischem Interesse. Sie ähneln automorphen Formen aus dem üblichen Langlands-Programm: Sie bestehen aus komplizierten Integralen, die sich häufig nicht direkt berechnen lassen.
L-Funktionen hat Leonhard Euler bereits Mitte des 18. Jahrhunderts eingeführt. Dabei handelt es sich um unendliche Summen, die bei der Untersuchung grundlegender Fragen über Zahlen genutzt werden. Die berühmteste L-Funktion, die Zeta-Funktion, ist das Herzstück der riemannschen Vermutung, die vorhersagt, wie die Primzahlen auf dem Zahlenstrahl verteilt sind. Sie ist eines der wichtigsten ungelösten Probleme der Mathematik.
Die riemannsche Vermutung
Seit mehr als 160 Jahren zählt die riemannsche Vermutung zu einem der härtesten Probleme der Mathematik. Weltweit versuchen sich immer wieder etliche Personen an einem Beweis, doch bisher sind alle gescheitert.
Bernhard Riemann war einer der wichtigsten Mathematiker der vergangenen Jahrhunderte, der die Gebiete der Analysis, der Differentialgeometrie und der Zahlentheorie vollkommen veränderte. In seiner 1859 erschienenen Arbeit »Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe« formulierte er seine berühmte Vermutung. Dies war seine einzige Veröffentlichung im Bereich der Zahlentheorie – und dennoch zählt sie bis heute zu einem der bedeutendsten Werke dieser Disziplin.
Da Riemann hauptsächlich auf dem Fachgebiet der Analysis tätig war, die sich häufig mit stetigen oder differenzierbaren Funktionen beschäftigt, wählte er auch einen solchen Ansatz, um die Verteilung der Primzahlen zu studieren. Durch Riemanns Arbeit fanden Mathematiker später heraus, dass Primzahlen in kleinen Bereichen des Zahlenstrahls zwar willkürlich verstreut sind, aber asymptotisch (also für Intervallgrößen, die gegen unendlich gehen) regelmäßig erscheinen.
Diese Ordnung spiegelt sich in der von Riemann gefundenen Primzahlfunktion π(x) wider, welche die Anzahl aller Primzahlen bestimmt, die kleiner als eine gegebene Anzahl x sind. Die Funktion hängt von der so genannten Zetafunktion ζ ab, die Leonhard Euler bereits 1737 eingeführt hatte. Die Primzahlfunktion ist nicht exakt – die Verteilung der Primzahlen schwankt um einen Wert, der durch die Nullstellen der Zetafunktion bestimmt ist. Anders ausgedrückt: Kennt man all die Werte z, für die ζ(z) gleich null ist, kann man daraus sehr genau auf die Verteilung der Primzahlen schließen.
Riemann fiel bereits in diesem Aufsatz auf, dass die Nullstellen der Zetafunktion einem bestimmten Muster zu folgen scheinen. Das Muster entdeckte er aber erst, nachdem er die von Leonhard Euler definierte Funktion erweitert hatte: Anstatt sie nur mit den gewöhnlichen reellen Zahlen zu speisen, setzte er auch komplexe Zahlen ein, die Wurzeln aus negativen Zahlen enthalten. Schnell stieß Riemann auf »triviale« Nullstellen: Er zeigte, dass die Zetafunktion für sämtliche negativen geraden Zahlen verschwindet. Allerdings besitzt sie weitere Nullstellen, die alle auf einer Geraden zu liegen scheinen, überall dort, wo der reelle Anteil einer Nullstelle der Zetafunktion den Wert 1⁄2 hat. Diese Beobachtung ging als »riemannsche Vermutung« in die Mathematikgeschichte ein.
Als der Mathematiker David Hilbert von der Universität Göttingen im Jahr 1900 am internationalen Mathematikerkongress in Paris seine berühmte Rede zu den zehn wichtigsten offenen Problemen der Mathematik hielt, gehörte dazu die riemannsche Vermutung. Von ursprünglich zehn Problemen seiner Liste sind inzwischen acht zumindest teilweise gelöst – doch bei der riemannschen Vermutung gab es bisher kaum Fortschritte.
Anlässlich des 100. Jahrestags von Hilberts prägender Rede formulierte das Clay Mathematics Institute zur Jahrtausendwende sieben »Millennium-Probleme«, deren Lösung mit jeweils einer Million US-Dollar belohnt wird. Darunter ist die riemannsche Vermutung. Das Preisgeld erhält man aber nur für einen Beweis. Liefert man ein Gegenbeispiel, das heißt eine Nullstelle, die nicht auf der erwarteten Geraden liegt, geht man leer aus. Neben den gescheiterten Versuchen eines Beweises haben Mathematiker mit enormer Rechenleistung bisher mehrere Milliarden dieser Nullstellen berechnet, und keine wich von der vorhergesagten Geraden ab.
Langlands war sich möglicher Zusammenhänge zwischen L-Funktionen und Perioden bewusst, aber er betrachtete sie als zweitrangig in seinem Plan, verschiedene Bereiche der Mathematik zu verbinden. »In einer seiner Arbeiten nannte Langlands die Untersuchung von Perioden und L-Funktionen als etwas, das keines näheren Blickes lohne«, sagt Sakellaridis.
Obwohl Langlands der Verbindung wenig Beachtung schenkte, sehen Sakellaridis und Venkatesh sie als zentral an, um die Brücken zwischen scheinbar weit entfernten Bereichen der Mathematik zu verbreitern und zu verstärken. In ihrem 2012 erschienenen Buch entwickelten sie eine Art Maschine, in die man eine Periode eingibt, woraufhin sie nach einer langen Berechnung eine L-Funktion ausgibt. Nicht alle Perioden erzeugen jedoch entsprechende L-Funktionen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ihrer Arbeit bestand darin, zu erklären, für welche Perioden dieser Vorgang möglich ist.
Ihr Ansatz hat jedoch zwei Einschränkungen. Erstens erklärt er nicht, warum eine bestimmte Periode eine L-Funktion ergibt. Die Maschine, die das eine in das andere umwandelt, ist eine Blackbox. Es war, als hätten sie einen Automaten konstruiert, der jedes Mal, wenn man Geld einwirft, zuverlässig etwas zu essen liefert – allerdings kann man nicht voraussagen, was man bekommen wird oder ob die Maschine das Geld einbehält, ohne etwas auszugeben.
Die zweite Einschränkung ist, dass die Mathematiker nicht verstanden, welche L-Funktionen mit Perioden verbunden sind. Einige besitzen eine solche Übereinstimmung, andere nicht. Die zwei Forscher konnten nicht herausfinden warum.
»So wie diese Periode und die L-Funktion definiert sind, gibt es keine offensichtliche Beziehung zwischen ihnen«Wee Teck Gan, Mathematiker
Nach Erscheinen ihres Buchs arbeiteten sie weiter an dem Problem. Sie wollten verstehen, warum die Verbindung funktioniert und wie man die Maschine in beide Richtungen laufen lassen kann. Ihr Ziel war es, auch aus einer L-Funktion eine Periode zu konstruieren.
Die Macht von Dualitäten
Weil sie Objekte miteinander verbinden, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, sind Dualitäten sehr mächtig. Man könnte ewig auf die Strukturen starren, ohne zu erkennen, wie L-Funktionen und Perioden zusammenpassen. »So wie diese Periode und die L-Funktion definiert sind, gibt es keine offensichtliche Beziehung zwischen ihnen«, sagt Wee Teck Gan von der National University of Singapore.
Um unvereinbare Dinge miteinander zu verbinden, muss man eine gemeinsame Basis finden. Eine Möglichkeit, das für Objekte wie L-Funktionen und Perioden zu tun, besteht darin, sie mit geometrischen Figuren zu paaren.
Das lässt sich über ein vereinfachtes Beispiel mit einem Dreieck veranschaulichen. Indem man die Längen jeder Seite misst, erhält man eine Reihe von Zahlen, die bestimmen könnten, wie eine gewisse L-Funktion definiert ist. Wenn man nun ein anderes Dreieck betrachtet und dessen Winkel ermittelt, könnte sich mit diesen eine Periode definieren lassen. Anstatt also L-Funktionen und Perioden direkt zu vergleichen, kann man die zugehörigen Dreiecke anschauen. Wenn eine Periode einem Dreieck mit gewissen Winkeln entspricht, dann stimmen die Längen dieses Dreiecks mit einer dazugehörigen L-Funktion überein.
In ihrem 2012 erschienenen Buch haben Sakellaridis und Venkatesh einen Teil dieser Übersetzung erreicht. Sie fanden einen Weg, um Perioden mit einer bestimmten Art von geometrischen Objekten zu identifizieren. Aber sie wussten nicht, womit sie die L-Funktionen paaren sollten.
Als Ben-Zvi davon hörte, glaubte er, eine Lösung zu kennen. Während die Arbeit von Sakellaridis und Venkatesh abseits von Langlands’ Vision lag, arbeitete Ben-Zvi in einem Bereich der Mathematik, der in einem ganz anderen Universum angesiedelt war: einer geometrischen Version des Langlands-Programms.
Eine Frage der Geometrie
Das geometrische Langlands-Programm begann in den frühen 1980er Jahren, als Vladimir Drinfeld und Alexander Beilinson eine »Dualität zweiter Ordnung« vorschlugen. Die Forscher vermuteten, dass sich die Verknüpfung zwischen Galoisgruppen und automorphen Formen als Übereinstimmung zwischen zwei Arten von geometrischen Objekten interpretieren ließe. Doch als Ben-Zvi in den 1990er Jahren als Doktorand an der Harvard University mit der Arbeit am geometrischen Langlands-Programm begann, war die Verbindung zwischen dem geometrischen und dem ursprünglichen Langlands-Programm eher ein Wunschtraum.
2018, als Ben-Zvi ein Sabbatjahr am Institute for Advanced Study verbrachte, hatten sich beide Seiten angenähert – unter anderem durch eine im selben Jahr veröffentlichten Arbeit von Vincent Lafforgue, einem Forscher am Fourier-Institut in Grenoble. Ben-Zvi plante, seinen Sabbatical-Aufenthalt zu nutzen, um sich auf die geometrische Seite des Langlands-Programms zu konzentrieren. Doch sein Plan wurde durchkreuzt, als er die Präsentation von Venkatesh hörte.
»Die Kinder von Akshay und mir sind Spielkameraden und wir sind privat befreundet. Deshalb dachte ich, ich sollte zu einigen der Vorträge gehen, die Akshay zu Beginn des Semesters hielt«, sagt Ben-Zvi. In einem erklärte Venkatesh seine Suche nach einem geometrischen Objekt, das sowohl Perioden als auch L-Funktionen entspricht, und er beschrieb seine jüngsten Fortschritte in dieser Richtung. Dabei versuchte er, geometrische Räume aus einem Bereich der Mathematik zu verwenden, der als symplektische Geometrie bezeichnet wird. Mit diesen Objekten war Ben-Zvi durch seine Arbeit im geometrischen Langlands-Programm vertraut.
Der nächste Schritt kam aus der Physik. Seit Jahrzehnten nutzen Fachleute Dualitäten, um die Grundkräfte der Natur zu beschreiben und miteinander zu verbinden. Das erste und berühmteste Beispiel dafür sind die Maxwell-Gleichungen aus dem 19. Jahrhundert, die elektrische und magnetische Felder unter einen Hut bringen. Die Formeln erklären, wie ein veränderliches elektrisches Feld ein magnetisches erzeugt und umgekehrt. Sie lassen sich gemeinsam als elektromagnetisches Feld auffassen. Mathematisch gesehen können Elektrizität und Magnetismus die Plätze tauschen, ohne dass sich das Verhalten des gemeinsamen Felds ändert.
Oft nutzen Fachleute aus der Physik mathematische Ergebnisse, um voranzukommen. Doch manchmal ist es umgekehrt. So zeigten die Physiker Davide Gaiotto und Edward Witten 2008, wie geometrische Räume, die mit Quantenfeldtheorien des Elektromagnetismus zusammenhängen, in das geometrische Langlands-Programm passen. Denn die geometrischen Räume tauchen paarweise auf, einer für jede Seite der elektromagnetischen Dualität: hamiltonsche G-Räume und ihr Dual, hamiltonsche Ğ-Räume.
Ben-Zvi hatte die Gaiotto-Witten-Arbeit verschlungen, als sie herauskam. Er hatte den physikalischen Rahmen genutzt, um über Fragen der geometrischen Langlands-Vermutung nachzudenken. Aber die Veröffentlichung wies keinerlei Verbindung zum ursprünglichen Langlands-Programm auf.
Zumindest bis Ben-Zvi sich im Publikum des IAS wiederfand und Venkatesh zuhörte. Dieser erklärte, dass er und Sakellaridis zu der Überzeugung gelangt waren, Perioden mit hamiltonschen G-Räumen zu assoziieren. Aber Venkatesh sagte auch, dass sie nicht genau wüssten, welches geometrische Objekt sie mit L-Funktionen verbinden sollten.
Bei Ben-Zvi schrillten die Alarmglocken. Nachdem Sakellaridis und Venkatesh Perioden mit hamiltonschen G-Räumen verknüpft hatten, wurde ihm sofort klar, was die dualen geometrischen Objekte für L-Funktionen sein mussten: die Ğ-Räume, die Gaiotto und Witten in ihrer Dualität betrachtet hatten. Für Ben-Zvi passten all diese Zusammenhänge zwischen Arithmetik, Geometrie und Physik zusammen. Auch wenn er die genauen Details der zahlentheoretischen Seite nicht verstand, war er davon überzeugt, dass alles Teil »eines großen, schönen Bildes« ist.
»Man könnte sagen, dass das ursprüngliche Langlands-Programm jetzt ein Spezialfall dieses neuen Rahmens ist«Wee Teck Gan, Mathematiker
Im Frühjahr 2018 trafen sich Ben-Zvi, Sakellaridis und Venkatesh regelmäßig in einem Restaurant auf dem Campus des IAS. Im Lauf einiger Monate fanden sie heraus, wie man aus L-Funktionen hamiltonsche Ğ-Räume konstruieren kann. Die Dualität zwischen Perioden und L-Funktionen übersetzt sich dadurch in eine geometrische Verbindung, die in den Rahmen des geometrischen Langlands-Programms passt – und ihren Ursprung in der Dualität von Elektrizität und Magnetismus hat. »Man könnte sagen, dass das ursprüngliche Langlands-Programm jetzt ein Spezialfall dieses neuen Rahmens ist«, so Gan.
Durch die Vereinheitlichung unterschiedlicher Phänomene haben die drei Mathematiker etwas von der Ordnung, die dem Elektromagnetismus innewohnt, auf die Beziehung zwischen Perioden und L-Funktionen übertragen. »Die physikalische Interpretation der geometrischen Langlands-Korrespondenz macht sie viel natürlicher; sie passt in das allgemeine Bild der Dualitäten«, sagt Kim. »In gewisser Weise bietet die neue Arbeit einen Weg, um die arithmetische Korrespondenz mit der gleichen Sprache zu interpretieren.«
Aber die Ergebnisse haben ihre Grenzen. Die drei Mathematiker haben die Dualität zwischen Perioden und L-Funktionen über Zahlensysteme bewiesen, die als »Funktionskörper« bezeichnet werden – und nicht über »Zahlenkörper« (zu denen etwa die rationalen Zahlen gehören), die das Kernstück des Langlands-Programms ausmachen. »Das Ergebnis sollte für Zahlenkörper erweitert werden. Ich denke, dass das irgendwann realisiert wird«, sagt Venkatesh.
Trotzdem ist die Arbeit ein enormer Fortschritt. Während der Monate, in denen Venkatesh seinen Zettel mit sich herumtrug, hatten er und Sakellaridis keine Ahnung, warum L-Funktionen mit Perioden verbunden sein sollten. Jetzt ergibt die Beziehung in beide Richtungen Sinn. Sie können sie durch eine gemeinsame Sprache frei ineinander übersetzen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.