Teilchenphysik: Das Rätsel der Antimaterie
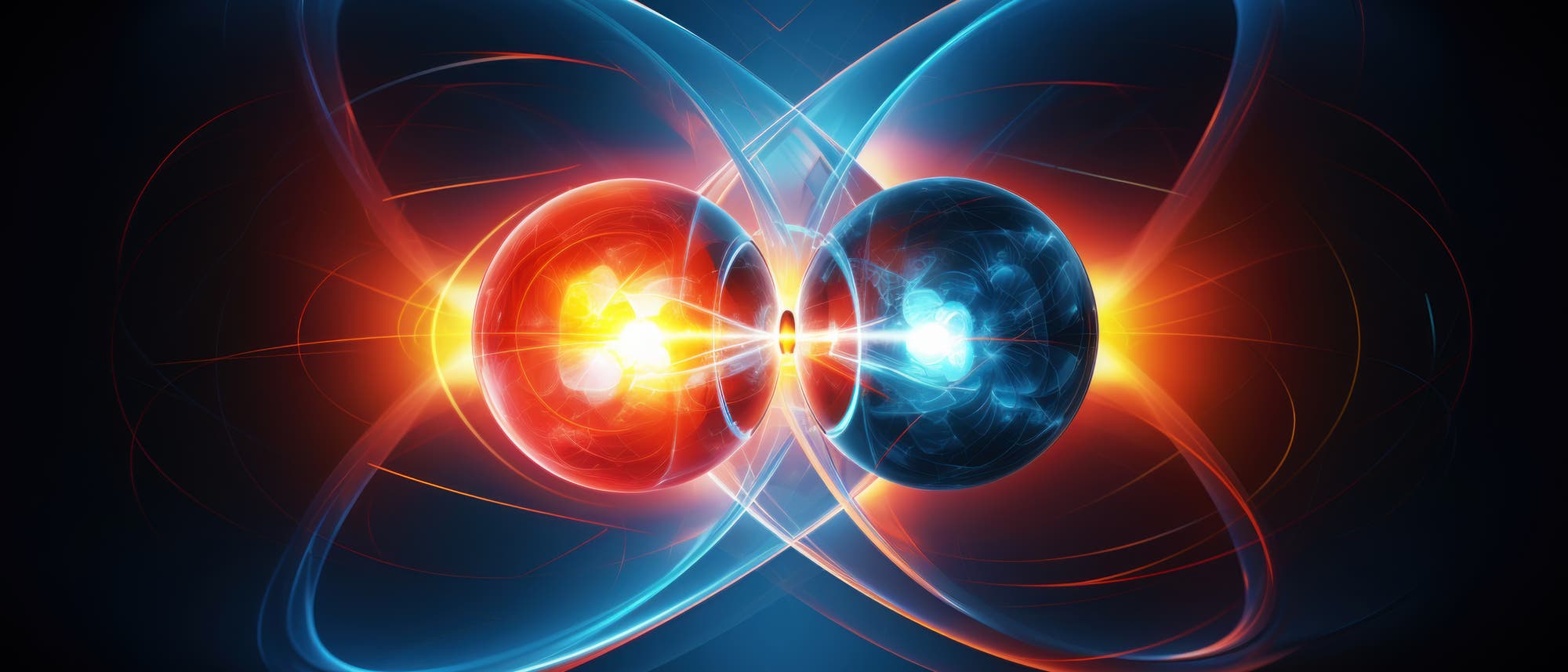
Eigentlich sollte es das Universum gar nicht geben. Laut allem, was wir über Teilchen und ihre Wechselwirkungen wissen – zusammengefasst in einer Theorie namens Standardmodell –, hätten beim Urknall gleiche Mengen an Materie und Antimaterie entstehen sollen. Bei Antimaterie handelt es sich um spiegelbildliche Versionen der uns bekannten normalen Teilchen. Sie sind in jeder Hinsicht gleich, tragen aber eine entgegengesetzte Ladung. Wenn Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, zerstören sie sich gegenseitig. Seit der Entstehung des Universums sollte sich daher jedwede Masse vollständig wieder ausgelöscht haben. Das Ergebnis wäre ein leerer Kosmos, der bloß Strahlung enthält. Dennoch ist offensichtlich genug Materie übrig geblieben, um daraus Galaxien, Sterne und Planeten zu bilden. Hingegen beobachten wir fast keine Antimaterie. Dieses Ungleichgewicht ist also eine für uns existenzielle Anomalie – und die mögliche Ursache dafür stellt eines der größten Rätsel der modernen Physik dar.
Es gibt viele Hypothesen, mit denen sich das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie erklären lassen soll. Wir wissen nicht, ob eine davon zutrifft und welche das sein könnte. Einige Modelle verschaffen der Materie die Oberhand, indem sie neue Teilchen postulieren. Wenn diese zerfallen, könnten sie mehr Materie als Antimaterie erzeugen; oder die Teilchen wechselwirken mit Materie auf andere Weise. Laut manchen derartigen Ideen müssten zusätzliche Effekte auftreten, die sich vielleicht nachweisen lassen. Das würde Belege für eine der Theorien liefern.
Ein Beispiel für solche potenziell beobachtbaren Auswirkungen ist eine hypothetische Eigenschaft von Elektronen, das so genannte elektrische Dipolmoment. Dabei handelt es sich um die Folge einer kleinen Differenz zwischen dem Punkt, auf den sich die Masse eines Elektrons konzentriert, und seinem Ladungsschwerpunkt. Eine solche Verschiebung wurde noch nie nachgewiesen, und wenn es sie gibt, dürfte sie wesentlich geringer sein, als sich mit den derzeitigen Experimenten messen lässt. Allerdings sagen viele vorgeschlagene Erweiterungen des Standardmodells, die das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie zu erklären versuchen, erheblich größere Werte für das elektrische Dipolmoment voraus.
Gemeinsam mit meinem Team spüre ich im Labor jenem Effekt nach. In einem JILA genannten Institut der University of Colorado Boulder in den USA haben wir dazu einen anderen Weg eingeschlagen als bei vergleichbaren Experimenten üblich. Diese Pionierarbeit ermöglichte es uns, das elektrische Dipolmoment so präzise zu messen wie nie zuvor.
Um zu verstehen, wonach wir gesucht haben, stellen Sie sich zunächst irgendein einfaches physikalisches Experiment vor. Nun wiederholen Sie den Versuch, aber mit zwei Änderungen: Sie ersetzen alle positiven Ladungen durch negative (und umgekehrt), außerdem ordnen Sie die gesamte Apparatur spiegelverkehrt an. Wenn Sie jetzt das gleiche Ergebnis erhalten, dann bewahrt Ihr Experiment die so genannte CP-Symmetrie. Das heißt, dass es unempfindlich ist gegenüber einer gleichzeitigen Vertauschung von Ladung (C steht für den englischen Begriff charge) und Parität (der Fachbegriff für das Verhalten unter einer Raumspiegelung). Das ist in der Physik fast immer der Fall.
Im Jahr 1967 wies der Physiker Andrei Sacharow nach, dass diese Symmetrie eng mit dem Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie zusammenhängt: Wenn sich unser heutiges Universum aus einem solchen entwickelt hat, das ursprünglich zu gleichen Teilen aus Materie und Antimaterie bestanden hat, muss durch irgendeinen Vorgang im Verlauf der Zeit die CP-Symmetrie »gebrochen« worden sein.
Die bekannt gewordenen Fälle von Symmetrieverletzungen reichen nicht aus, um das Ausmaß des Ungleichgewichts zwischen Materie und Antimaterie zu erklären
Solche Symmetrieverletzungen wurden etwa zur gleichen Zeit tatsächlich experimentell bei subatomaren Prozessen entdeckt. So verstößt beispielsweise die schwache Kraft, die für die radioaktiven Zerfälle von Atomkernen verantwortlich ist, ein wenig gegen die CP-Symmetrie. Die im Rahmen des Standardmodells bekannt gewordenen Fälle reichen jedoch nicht aus, um das gesamte heutige Ausmaß des Ungleichgewichts zwischen Materie und Antimaterie zu erklären. Für eine Lösung des Rätsels müssen wir daher weitere physikalische Phänomene finden, bei denen die CP-Symmetrie nicht erhalten ist.
An dieser Stelle kommt unser Experiment ins Spiel. Es soll Hinweise auf neuartige Vorgänge liefern, indem es bei bekannten Teilchen subtile Effekte nachweist. Dass es solche Auswirkungen gibt, liegt an der Natur des Standardmodells. Es ist eine so genannte Quantenfeldtheorie. Hier sind Felder die eigentlichen Grundbausteine des Universums. Für jedes Teilchen in der Natur gibt es ein Feld – von den allgemein bekannten Elektronen und Photonen bis zu ihren exotischeren Verwandten wie Myonen und Gluonen. Als zweidimensionale Veranschaulichung eines Felds kann man sich eine riesige, biegsame Membran vorstellen. Sie erstreckt sich durch den gesamten Raum und trägt Wellen wie die Oberfläche eines Sees. In einem Quantenfeld können Wellen nur in bestimmten diskreten Größen auftreten. Die kleinstmögliche Auslenkung ist das, was wir Teilchen nennen; positive Wellen entsprechen Materie und negative sind Antimaterie. Die Energiemenge, die für diese minimale Anregung erforderlich ist – die Ruhemasse des zugehörigen Teilchens –, hängt davon ab, wie steif die Membran ist.
Die verschiedenen Felder sind miteinander verbunden oder »gekoppelt«. Das heißt, eine Welle in einem Feld kann andere beeinflussen. So erzeugt zum Beispiel eine Oszillation im Elektronenfeld eine Auslenkung im elektromagnetischen Feld – die wiederum einem Photon entspricht. Das Phänomen nutzen wir in alltäglichen Geräten wie Funkantennen und Mobiltelefonen.
Die aktuell erfolgreichsten Werkzeuge zur Entdeckung neuer Felder und damit verbundener Teilchen sind moderne Teilchenbeschleuniger. Diese Maschinen lassen zwei subatomare Objekte – zum Beispiel Protonen – mit enormer Geschwindigkeit aufeinander zufliegen und zusammenprallen. Während der heftigen Wechselwirkung der sich aufschaukelnden Wellen kann sich ein Teil ihrer Energie auf andere Felder übertragen. Falls die Energie bei der Kollision genau derjenigen entspricht, die nötig ist, um in einem der anderen gekoppelten Felder eine Welle zu erzeugen, kommt es zu einer Resonanz. Dann ist die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass ein neues Teilchen entsteht. Auf die Weise wurden viele Felder gefunden, einschließlich des letzten gesuchten Bausteins des Standardmodells im Jahr 2012: das Higgs-Feld und das damit verbundene Higgs-Boson.
Der leistungsstärkste Beschleuniger der Welt ist der Large Hadron Collider (LHC). Er befindet sich in einem 27 Kilometer langen ringförmigen Tunnel bei Genf. Doch selbst bei den im Rahmen dieser Konstruktion höchstmöglichen Kollisionsenergien hat der LHC keine grundlegend neuen Felder erschlossen. Wenn es sie gibt, ist entweder die Masse der Teilchen höher, als der LHC erreichen kann, oder ihre Kopplung mit den Feldern des Standardmodells ist zu schwach. Ein neuer Beschleuniger, der sehr viel höhere Energien erreichen könnte, wäre mit mehreren zehn Milliarden Euro so kostspielig, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis man sich darüber einig ist, ob und wie er finanziert werden soll.
Glücklicherweise gibt es eine weitere Möglichkeit, neue Teilchen und Felder aufzuspüren, und zwar durch Präzisionsmessungen. Das liegt an der Kopplung der Felder des Standardmodells untereinander: Eine Welle in einem Feld, die einem Teilchen entspricht, verursacht immer Störungen in anderen Feldern. Zum Beispiel verzerrt ein Elektron, also eine Welle im Elektronenfeld, das umliegende elektromagnetische Feld. Diese Auslenkung im elektromagnetischen Feld stört wiederum die anderen Felder, die daran gekoppelt sind, und so weiter, bis hin zu allen bekannten Feldern des Standardmodells. Was wir als Elektron kennen, ist in Wirklichkeit die Gesamtheit all solcher Anregungen. Der Effekt wird manchmal als eine Wolke »virtueller Teilchen« beschrieben, die das Elektron umgibt.
Die begleitenden Störungen der übrigen Felder wirken sich auf viele Eigenschaften des Elektrons aus. Daher können wir durch deren sorgfältige Messung auf das Vorhandensein unentdeckter Felder schließen, die an das Elektron gekoppelt sind. Wenn solche Felder mit massereicheren Teilchen verbunden sind, sind sie besonders starr. Dann werden sie nicht so leicht vom Elektronenfeld beeinflusst, weshalb sie sich wiederum weniger auf die Eigenschaften des Elektrons auswirken. Möchte man daher etwaige Auswirkungen von Feldern mit immer schwereren Teilchen feststellen, erfordert das zunehmend genaue Messungen.
Eine Schwierigkeit bei diesem Ansatz besteht darin, dass die Art der Abweichung, nach der wir suchen, oft von Einflüssen durch die Felder des Standardmodells überlagert wird. Zum Beispiel hat ein Elektron ein Magnetfeld, ähnlich wie ein winziger Stabmagnet. Die Stärke des Felds ist das magnetische Dipolmoment des Elektrons, das extrem präzise gemessen wurde. Sein Wert wird größtenteils durch das Elektronenfeld an sich bestimmt. Die wichtigsten Korrekturen ergeben sich aus dem elektromagnetischen Feld, und sie können erstaunlich genau berechnet werden. Bei der Präzision, die sich mit den derzeitigen Experimenten erreichen lässt, ist der exakte Wert der Kopplung zwischen Elektron und elektromagnetischem Feld jedoch nicht bekannt – die Ergebnisse verschiedener Versuche weichen voneinander ab. Selbst wenn das Problem gelöst wird, sind außerdem die winzigen Auswirkungen der Wechselwirkungen mit Quarkfeldern und der starken Kraft von Bedeutung. Die Effekte können unglaublich komplex sein und sind schwer zu berechnen. Das macht die Suche nach exotischen physikalischen Phänomenen, die sich auf ähnlich kleinen Skalen abspielen, zu einer besonderen Herausforderung.
Es gibt eine gute Strategie, dieses Problem zu umschiffen. Sie besteht darin, einen Wert zu finden, der im Standardmodell null ist (oder sehr, sehr klein). So ist es beim elektrischen Dipolmoment des Elektrons (kurz eEDM), dem elektrischen Gegenstück zum magnetischen Dipolmoment. Theoretisch sollten der Massen- und der Ladungsschwerpunkt im Elektron nur minimal auseinanderliegen. Ein eEDM kann im Großen und Ganzen nur durch Wechselwirkungen verursacht werden, die gegen die CP-Symmetrie verstoßen. Die bereits im Standardmodell einberechneten, bekannten CP-Verletzungen sind äußerst gering und würden experimentell eine derzeit unerreichbare Präzision erfordern. Allerdings sagen viele vorgeschlagene Erweiterungen des Standardmodells, die das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie erklären sollen, ein eEDM voraus, das um viele Größenordnungen darüberliegen könnte – potenziell in der Reichweite von Laborversuchen.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie aufgeregt ich war, als ich als Physikstudent zum ersten Mal von solchen Ideen gelesen habe. Im Gegensatz zum enormen technischen Aufwand und den Heerscharen von Fachleuten, die mit dem Betrieb von Teilchenbeschleunigern wie dem LHC einhergehen, passen Experimente mit alltäglichen Teilchen wie dem Elektron oft auf einen (zugegebenermaßen großen) Tisch in einem herkömmlichen Universitätslabor. Mich faszinierte, dass solche Tests in bestimmten Fällen grundlegende physikalische Fragen beantworten können, die außerhalb der Reichweite der komplexesten Experimente der Welt liegen. Zudem passte solch ein Projekt zu meinen persönlichen Neigungen. Während die Aufgaben sonst in der Regel hochspezialisiert verteilt sind, erfordert die Versuchsdurchführung auf einem Labortisch von allen Beteiligten einen ganzheitlichen Blick auf die Apparatur und über viele verschiedene Disziplinen hinweg, von Elektronik über Programmierung bis hin zu Laseroptik und Vakuumtechnik – das gefiel mir.
Solche Tests können grundlegende physikalische Fragen beantworten, die außerhalb der Reichweite der komplexesten Experimente der Welt liegen
Die Aussage, dass ein Elektron ein von null verschiedenes elektrisches Dipolmoment besitzt, ist gleichbedeutend damit, dass es in einem elektrischen Feld eine Vorzugsrichtung hat – so wie sich die magnetische Nadel eines Kompasses im Magnetfeld der Erde orientiert. Wenn man eine Kompassnadel anstößt, schwingt sie um ihre Nordlage. Die Frequenz dieses Hin-und-her-Wackelns ist proportional zur Stärke des Magnetfelds und zur Größe des magnetischen Dipolmoments der Nadel.
Misst man also in einem bekannten Magnetfeld die Wackelfrequenz, ergibt sich daraus die Größe des magnetischen Dipolmoments der Nadel. Wenn die Nadel außerdem ein elektrisches Dipolmoment hat, etwa weil eine ihrer Enden irgendwie aufgeladen wurde, lässt sich obendrein dessen Größe bestimmen. Dazu muss man gleichzeitig ein elektrisches Feld anlegen. Weist dieses parallel zum Magnetfeld, schwingt die Nadel mit einer leicht erhöhten Frequenz; zeigt es in die entgegengesetzte Richtung, nimmt die Frequenz ab. Die Differenz gibt Aufschluss über die Größe des elektrischen Dipolmoments der Nadel. Das funktioniert beim eEDM des Elektrons auf dieselbe Weise: Wir bringen das Teilchen in ein Magnetfeld und ermitteln dann die Frequenzänderung in einem zusätzlichen elektrischen Feld, das wir zunächst parallel und dann antiparallel dazu anlegen.
Wir wissen, dass das eEDM extrem gering sein muss, falls es überhaupt existiert. Daher suchen wir nach einer entsprechend winzigen Verschiebung der Frequenz. Ein etwaiges Signal würde umso deutlicher hervortreten, je stärker das angelegte elektrische Feld ist. Besonders vielversprechend ist es, hierfür Elektronen heranzuziehen, die sich in schweren Atomen befinden. Denn in der Nähe des stark positiv geladenen Kerns wirken auf die Elektronen enorme elektrische Felder ein. Sie sind etwa eine Million Mal größer als die intensivsten, die sich in einem Labor extern erzeugen lassen.
Um dieses fantastisch starke Feld für unsere Messungen zu nutzen, müssen wir im Labor lediglich ein kleines weiteres elektrisches Feld anlegen, das ausreicht, um das Atom oder Molekül auszurichten. Das ist bei Molekülen viel einfacher, weshalb im Lauf des vergangenen Jahrzehnts die führenden Experimente dieser Art auf die Elektronen in schweren, zweiatomigen Molekülen gesetzt haben. Bei unserem Experiment verwenden wir Hafniummonofluorid, weil Hafnium mit 72 Protonen im Kern eines der massereichsten Metalle im Periodensystem ist, das nicht radioaktiv ist.
Selbst bei dem enormen elektrischen Feld im Atom ist die Änderung der Wackelfrequenz des Elektrons, die wir von einem elektrischen Dipolmoment realistischerweise erwarten könnten, immer noch sehr gering. Sie entspricht grob einem zusätzlichen Ausschlag alle sieben Stunden. Um eine solch winzige Abweichung zu erkennen, müssen wir die beiden Frequenzen – mit dem elektrischen Feld parallel sowie entgegengesetzt zur Richtung des Magnetfelds – extrem genau bestimmen. Je länger wir den Vorgang verfolgen, desto mehr Schwingungen können wir beobachten und desto präziser können wir die Frequenz messen.
Der Zeitplan wird unter anderem durch die Haltbarkeit der Moleküle begrenzt. Für diese Art von Experimenten müssen wir Moleküle verwenden, die freie, ungepaarte Elektronen besitzen, was sie sehr reaktionsfreudig macht: Sie verbinden sich begierig mit anderen Atomen, denen sie begegnen. Deswegen halten wir die Moleküle in Vakuumkammern, wo sie mit nichts in Berührung kommen. Frühere Versuche verwendeten Strahlen von Molekülen, die mit Hunderten von Metern pro Sekunde durch eine lange Vakuumröhre flogen. Dabei wurden die Moleküle im freien Flug beobachtet. Doch bei solch einem Aufbau wird die Messzeit zusätzlich dadurch eingeschränkt, wie schnell sich die Moleküle im Strahl ausdünnen – je weiter sie sich fortbewegen, desto mehr entfernen sie sich voneinander. Irgendwann geht das Signal verloren. In der Regel geschieht dies innerhalb von etwa einem Meter, das heißt nach rund einer Millisekunde.
Für unser Experiment wollten wir die Elektronen länger beobachten. Wir entschieden uns dafür, molekulare Ionen einzufangen, das heißt geladene Moleküle mit elektrischen Feldern festzuhalten. Die grundsätzliche Technik ist nicht neu, aber bis dahin hatte niemand erwogen, solche Fallen für die Messung des elektrischen Dipolmoments von Elektronen heranzuziehen. Denn dafür muss man die Molekülionen elektrischen Feldern aussetzen, und wegen ihrer Ladung sollten sie dadurch aus der Falle herausbeschleunigt werden, was das Experiment unmöglich macht. Der Leiter unseres Labors, Nobelpreisträger Eric Cornell, hatte hier aber eine spannende Idee: Er schlug vor, das elektrische Feld so schnell zu drehen, dass die Ionen nicht wegfliegen, sondern nur kleine Kreise innerhalb der Falle ziehen. Mit dieser Methode konnten wir unsere Moleküle schließlich drei Sekunden lang untersuchen – deutlich mehr als bei früheren Experimenten. Nun war die Messdauer vor allem durch die Zeitspanne begrenzt, innerhalb derer die Moleküle in energieärmere Zustände zerfielen.
Unsere Technik hat allerdings einen Nachteil. Da wir nur eine kleine Menge Ionen auf einmal festhalten konnten, maßen wir bei jedem Durchgang viel weniger Elektronen als bei typischen Strahlexperimenten. Pro Einschuss in die Falle konnten wir nur einige hundert Elektronen beobachten. Wir brauchten zwei Monate, um auf insgesamt mehr als 100 Millionen Elektronen zu kommen. Dabei war das Sammeln des Datensatzes noch der schnelle Teil. Die eigentliche Herausforderung bei einem Präzisionsexperiment ist die Suche nach systematischen Fehlern. Wir mussten alle Wege identifizieren, auf denen wir fälschlich hätten annehmen können, ein eEDM gemessen zu haben, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall war. Sämtliche Fachleute, die sich mit hochgenauen Nachweisen befassen, nehmen die Fehlersuche sehr ernst. Niemand möchte verkünden, ein neues Teilchen entdeckt zu haben, nur um später festzustellen, dass er bloß einen winzigen Aspekt seiner Apparatur oder Methode übersehen und nicht einberechnet hat. Wir haben etwa zwei Jahre damit verbracht, nach solchen Einflüssen zu suchen und sie zu verstehen.
Eine wichtige Fehlerquelle bei Messungen zum elektrischen Dipolmoment ist der Grad der Kontrolle über das Magnetfeld. Wir suchen einen Frequenzunterschied in einem Magnetfeld, wenn ein elektrisches Feld parallel und dann entgegengesetzt zu dessen Richtung angelegt wird. Das Problem ist, dass die Frequenz von der Stärke des Magnetfelds abhängt. Wenn es zwischen den beiden Messungen leicht variiert, kann das Ergebnis wie das Signal eines elektrischen Dipolmoments wirken. Deswegen haben wir eine Strategie entwickelt, um das auszuschließen und beide Messungen des elektrischen Felds gleichzeitig durchzuführen. Ausgehend von einer Molekülwolke präparieren wir eine Hälfte so, dass ihr internes elektrisches Feld in Richtung des externen Magnetfelds weist, während das interne Feld der anderen Hälfte entgegengesetzt orientiert ist. Dann messen wir die Schwingungen der Elektronen in beiden Gruppen gleichzeitig. Da sich alle in derselben Falle befinden, erfahren sie mit sehr hoher Sicherheit dieselben Magnetfelder.
Eine weitere Quelle für systematische Fehler ist unsere eigene Voreingenommenheit. Wissenschaftler sind auch nur Menschen und können als solche trotz aller Bemühungen um Objektivität unwillkürlich parteiisch denken und entscheiden. Diese Fehlbarkeit kann die Ergebnisse von Experimenten verzerren – indem Forscher etwa dazu tendieren, ihre Erwartungen bestätigt zu sehen.
Menschliche Fehlbarkeit kann die Ergebnisse von Experimenten verzerren
Zur Vermeidung solcher Probleme werden bei vielen modernen Präzisionsexperimenten die Daten »blind« erhoben. In unserem Fall haben wir unseren Computer so programmiert, dass er nach jedem Durchlauf des Experiments eine zufällig generierte Zahl zum Messwert hinzufügte und diese in einer verschlüsselten Datei speicherte. Erst nachdem wir alle Daten gesammelt, die statistische Analyse abgeschlossen und sogar die Publikation größtenteils vorbereitet hatten, ließen wir den Computer den künstlich erzeugten Wert abziehen und unser wahres Ergebnis ermitteln.
Dieser Tag der Enthüllung, an dem sich unser Team nach Jahren harter Arbeit versammelte, war nervenaufreibend. Ich hatte ein Computerprogramm geschrieben, das eine bingoähnliche Karte mit 64 plausiblen Zahlen anzeigte, von denen aber nur eine das wahre Ergebnis für das elektrische Dipolmoment war. Die möglichen Resultate reichten von »entspricht null« bis »sehr signifikante Entdeckung«. Nach und nach verschwanden die falschen Antworten vom Bildschirm. Es fühlte sich seltsam an, Jahre seines Berufslebens zu einer einzigen Zahl kondensieren zu sehen, und ich fragte mich in dem Moment, ob es eine gute Idee war, die generelle Anspannung durch die Bingokarte zu verstärken. Doch so wurde allen vor Augen geführt, wie wichtig die Verblindung war. Man wusste nicht, ob man erleichtert oder enttäuscht sein sollte, wenn ein besonders herausragender Wert verschwand, der auf unbekannte Teilchen und Felder hingedeutet, aber auch den Ergebnissen früherer Experimente widersprochen hätte.
Schließlich blieb ein einziges Resultat auf dem Monitor übrig: Es war innerhalb der berechneten Messunsicherheit mit null konsistent. Das Ergebnis passte zu früheren Messungen, wodurch das Gesamtbild stimmiger wurde, und es verdoppelte die bis dahin erreichte Genauigkeit. Wir haben also weiter keinen Beweis dafür, dass das Elektron ein elektrisches Dipolmoment besitzt.
Unsere neue Obergrenze für die mögliche Größe des eEDM mag nicht so aufregend sein wie ein Wert ungleich null. Dennoch hat sie erhebliche Konsequenzen. Wenn wir davon ausgehen, dass jedes hypothetische CP-verletzende Feld ähnlich stark an Elektronen koppelt wie das elektromagnetische Feld (im Standardmodell hat es eine mittlere Kopplungsstärke, die zwischen der schwachen und der starken Kraft liegt), bedeutet unsere Messung: Die Masse des zugehörigen Teilchens müsste mehr als etwa 40 Teraelektronvolt entsprechen. Damit wäre es weitaus schwerer als alles, was am LHC direkt nachgewiesen werden kann – der LHC erreicht maximal rund 14 Teraelektronvolt.
Die Erkenntnis, die durch Ergebnisse weiterer seither durchgeführter eEDM-Messungen gestützt wird, überrascht viele, die neue Felder unterhalb dieser Energieskala erwartet hatten. Ein denkbares Schlupfloch wäre, dass die unbekannten Felder an diejenigen des Standardmodells auf eine andere Weise koppeln, auf der sie nur indirekt zum eEDM beitragen. Das heißt, für eine gegebene Masse würden sie sich nicht so stark auswirken, wie die obige Schätzung annimmt. Das ließe sich bestätigen, indem man die elektrischen Dipolmomente bei anderen Teilchen vermisst – solchen, die aus Quarks aufgebaut sind und bei denen die Kopplung vermutlich anders funktioniert. Solche Messungen laufen bereits mit Neutronen und Atomkernen von Quecksilber, und weitere sind geplant.
Die Erkenntnis überrascht viele, die neue Felder unterhalb dieser Energieskala erwartet hatten
Als eine andere Möglichkeit könnten sich die neuen Felder lediglich bei etwas höheren Energien oder geringeren Kopplungen zeigen. Sie wären mit unserem Experiment nicht erreichbar, aber für die nächste Generation von eEDM-Messungen zugänglich. Ich rechne damit, dass sich die Präzision in den nächsten zehn Jahren noch erheblich verbessern wird. Am JILA wollen wir ein anderes Molekül einsetzen, Thoriumfluorid, das ein stärkeres internes elektrisches Feld hat. Das dürfte die Beobachtungszeit weiter erhöhen, vielleicht auf 20 Sekunden. Wir planen außerdem, die Einschränkungen bei der Anzahl der einfangbaren Moleküle teilweise auszugleichen, indem wir viele Versionen des Experiments parallel durchführen, mit Dutzenden von separaten Fallen in einer langen Vakuumkammer.
Darüber hinaus erwarten wir große Fortschritte von der neuesten Version des weltbesten Experiments mit Molekularstrahlen, dem Projekt ACME III an der US-amerikanischen Northwestern University in Evanston. Dort soll ein besser fokussierter Strahl die Messzeit verlängern. Ebenso arbeiten weitere Gruppen an Strategien, um neutrale Moleküle mit Hilfe von Laserkühlung einzufangen. So eine Methode könnte möglicherweise die Vorteile langer Messzeiten und einer großen Anzahl von Elektronen vereinen. Ein besonders ehrgeiziger Plan eines kanadischen Teams zielt darauf ab, Moleküle zu untersuchen, die in einem festen Kristall aus gefrorenem Edelgas eingeschlossen sind. Damit könnte bei jedem einzelnen Versuchsdurchlauf eine gewaltige Anzahl von Elektronen zugänglich sein; es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Felder der benachbarten Atome im Festkörper die Messung beeinflussen.
Letztendlich hoffen wir, beim Elektron entweder ein elektrisches Dipolmoment nachzuweisen oder dessen mögliche Größe weiter einzugrenzen und so viele Hypothesen zur Erklärung des Rätsels der Antimaterie ausschließen zu können. Wir wissen, dass es einen Grund dafür geben muss, warum das Universum so ist, wie es ist – die Frage ist nur, wie lange wir brauchen werden, um ihn zu finden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.