Humanevolution: Kleine Fortsetzung der Menschheitsgeschichte
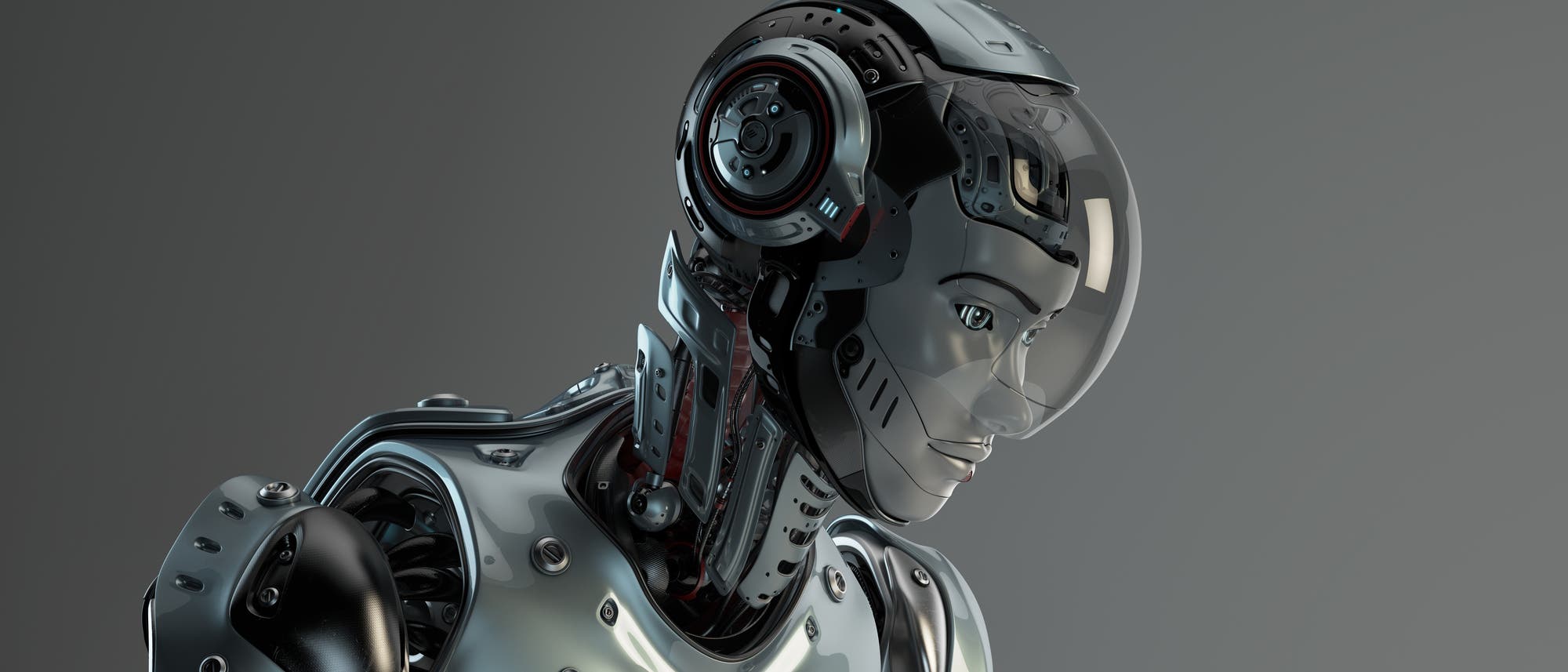
Seine Ergebnisse gelten nur für einen kleinen Kreis von Menschen, beschwichtigt Jonathan Beauchamp. Und sie können nicht über eine längere Zeitspanne als die einer Generation projiziert werden. Im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" hatte der Wirtschaftswissenschaftler verschiedene Eigenschaften von Probanden mit deren genetischen Profilen abgeglichen und die Daten ins Verhältnis zum "reproduktiven Erfolg", also zur Anzahl der Kinder gesetzt. "Meine Ergebnisse zeigen, dass die menschliche Evolution voranschreitet", so fasst er die Resultate zusammen, "langsam, aber stetig". Was er nicht geschrieben hat, möchte er auch nicht zwischen den Zeilen herausgelesen haben: Dass der Mensch langsam und stetig immer dümmer wird.
Beauchamp beschäftigt sich mit zwei wissenschaftlich heiklen Fragen: jener danach, ob die Spezies Homo sapiens sich unter dem Druck von Selektionsmechanismen weiterentwickelt wie jeder andere biologische Organismus - und der Frage, ob dies sogar ein Hauptmerkmal des Menschen betrifft, die Intelligenz.
Was ist schon Intelligenz?
Wann ein Mensch als "intelligent" gilt, ist dabei gar nicht endgültig beantwortet. Beauchamp setzt in seiner Studie auf das Educational Attainment (EA), grob gesagt, die Anzahl von Jahren, die sich ein Mensch in der Ausbildung befindet. Sein Datensatz umfasst rund 6000 US-Amerikaner europäischer Abstammung, die zwischen 1931 und 1953 geboren wurden. Und seine Auswertung legt nahe, dass jene mit niedrigerem EA-Wert im Durchschnitt mehr Kinder bekommen. Kann man schlussfolgern, dass immer mehr eher weniger Pfiffige geboren werden?
Anfang der 1990er Jahre hätten Intelligenzforscher widersprochen: Die Menschheit würde im Gegenteil mit der Zeit eher klüger werden. Hinweise darauf hatte damals der neuseeländische Intelligenzforscher James Flynn geliefert, als er IQ-Tests auf der ganzen Welt und ihre Ergebnisse miteinander verglich. "Die derzeitige Generation hat in allen Arten von IQ-Tests massiv dazugewonnen", schrieb er damals. Auch er warnte aber gleich davor, seine Ergebnisse falsch zu interpretieren, schon wegen der geringen Aussagekraft von IQ-Tests über tatsächliche Intelligenz. Die Tendenz, dass die gemessene Intelligenz von Generation zu Generation steigt, wird heute als Flynn-Effekt bezeichnet. Die Ursache des Effekts blieb ungeklärt, und seit den 1990er Jahren scheint er nicht einmal mehr aufzutreten: Danach sanken die gemessenen IQ-Werte wieder.
Beauchamps Studie war auch nicht die erste, aus der sich ein schleichender Rückgang an geistiger Leistungsfähigkeit des Menschen konstruieren ließ. Im Jahr 2012 hat der Entwicklungsbiologe Gerald Crabtree nach der Auswertung anderer Untersuchungen geschlussfolgert, dass Gene, die Menschen klug machen, stärker dem Selektionsdruck unterliegen und mit der Zeit im menschlichen Genom schwinden. Er könnte wetten, so schreibt er, dass ein normaler Bürger aus einer Hochkultur um 1000 v. Chr. heute unter uns zu den klügsten und intelligentesten Zeitgenossen gehören würde, mit einem guten Gedächtnis, einer Vielzahl von Ideen und einer klaren Sicht auf die wichtigen Fragen der Zeit.
Es bleibt nur schwierig, einen Zusammenhang zwischen der genetischen Konstitution und einer komplexen Eigenschaft wie Intelligenz zu beweisen. Auch deshalb flankierten die Herausgeber von "Proceedings of the National Academy of Sciences" die aktuelle Studie von Beauchamp mit einem zur Einordnung gedachten Kommentar. "Wer sagt, dass wir uns als Menschen in eine bestimmte Richtung entwickeln, liegt damit generell falsch", sagt Alexandre Courtiol, einer der Autoren jenes Kommentars. "Umweltfaktoren beeinflussen und verändern sowohl die kulturelle als auch die natürliche Evolution immer in einem Ausmaß, das sich schwer vorhersagen lässt", so der Evolutionsbiologe am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung.
Das genetische Profil, aus dem sich bei Beauchamp der EA-Wert ergibt, basiert auf immerhin mehr als 500 000 Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs). Der Forscher korreliert sie mit der Ausbildungsdauer - und diese, mitsamt dem damit verknüpften Genprofil, scheint sich eben tatsächlich langsam zu verändern, also zu evolvieren: Jede Generation, so der Forscher, verbringt durchschnittlich 1,5 Monate weniger in Ausbildung als die vorherige. Kompensiert wird dieser Verlust aber durch kulturelle, wirtschaftliche und soziale Faktoren, die Einfluss auf die Ausbildungsdauer haben und damit den natürlichen Selektionsdruck überschreiben. "In Wirklichkeit werden die Menschen gebildeter", trotz des geringen dagegen arbeitenden Einflusses der natürlichen Selektion, erklärt Beauchamp.
Courtiol ist in dieser Hinsicht nicht so optimistisch: "Generell haben uns als Menschheit die vergangenen 200 Jahre gutgetan, dank besserer medizinischer Versorgung und besseren Ausbildungsmöglichkeiten, aber ich würde nicht all mein Geld darauf setzen, dass dieser Trend in den kommenden 200 Jahren andauert." In einer Studie von 2015 zeigen US-amerikanische Forscher beispielsweise ebenfalls, dass sich eine längere Ausbildungszeit negativ auf die Anzahl der Nachkommen auswirkt - kein Wunder, verschiebt sich doch somit oft das Alter der Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, deutlich nach oben. In den Genen spiegelt sich dieser Effekt aber nicht wider.
Unter dem Druck der Selektion
Dagegen stellen die Wissenschaftler fest, dass es eine andere Eigenschaft gibt, die auf molekularer Ebene tatsächlich mit der Fruchtbarkeit korreliert: die Körpergröße. Diesen Effekt hatten bereits australische Genetiker 2005 präsentiert - je mehr Genvariationen für einen größeren Körper vorliegen, desto mehr Nachkommen sind wahrscheinlich. Offenbar wirken demnach heute natürliche Selektionsmechanismen auf die Körpergröße. Das war offenbar immer schon so, nicht immer aber mit demselben Effekt, wie ein weiteres Team 2015 anhand der Analyse von alter DNA aus längst Verstorbenen verschiedener Kulturen herausfand. Während sich bei steinzeitlichen Steppenbewohnern größere Menschen durchsetzten, waren unter den ersten Bauern in Mittel- und Südeuropa eher kleinere Personen häufig.
Unbestritten ist, dass Umweltfaktoren in bestimmten Regionen der Erde und verschiedenen Epochen immer wieder Menschen mit besonderen Eigenschaften bevorzugt haben. Ein Beispiel ist das Auftreten des Parasiten Plasmodium vivax, dem Erreger der Malaria tertiana. Der Parasit muss an einer bestimmten Oberflächenstruktur der roten Blutkörperchen des Menschen andocken, dem Duffy-Rezeptor. Südlich der Sahara tragen jedoch 95 Prozent der Bevölkerung einen veränderten Rezeptor an dieser Stelle in sich, mit dem der Malariaerreger nichts anfangen kann - ein natürlicher Schutz gegen den Parasiten und ein entscheidender Vorteil überall dort, wo die Krankheit grassiert.
In Tibet ist wieder eine andere genetische Ausstattung verbreitet, wie ein Team von chinesischen Forschern 2010 zeigte: Die Bewohner des Hochlands sind genetisch besser an das Leben in höheren Lagen angepasst, ihre Körper tolerieren häufig eine geringere Sauerstoffversorgung und sie leiden seltener an der Höhenkrankheit. Verantwortlich sind Mutationen in 18 Genen, die mit der Sauerstoffversorgung des Körpers assoziiert sind und die sich über Generationen unter dem Selektionsdruck einer größeren Höhenlage angepasst haben.
Auch eine veränderte Ernährung kann dafür sorgen, dass sich unterschiedliche Eigenschaften bei menschlichen Populationen manifestieren. Bekannt ist die Laktase-Persistenz, also die andauernde Fähigkeit des Körpers, Milchzucker zu verwerten. Alle Kinder weltweit bilden das dafür nötige Enzym Laktase - rund 65 Prozent der Weltbevölkerung aber fehlt es im Erwachsenenalter. In Regionen, die eine lange Tradition in der Haltung von Milchvieh haben - Nordwesteuropa, Nordwestindien oder verschiedenen Stellen Afrikas - produzieren jedoch heute die Bewohner bis ins Alter das dort besonders nützliche Enzym zur Verwertung des Milchzuckers. Das Aufkommen von Getreidenahrung seit der Jungsteinzeit hat dagegen die Verbreitung von Genen für das Enzym Amylase im Körper gefördert, das zur Aufspaltung von Stärke benötigt wird. Heutzutage tragen die meisten Menschen als Nachkommen der Ackerbauern mehrere Kopien des Amylase-Gens AMY1 in sich. Nur moderne Jäger-Sammler-Gemeinschaften, etwa die Datoga in Tansania, verfügen über wenige dieser Genkopien.
Bei den grönländischen Inuit dagegen sind Genregionen verändert, die Enzyme zum Abbau von ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren kodieren - beide besonders reichhaltig in der typischen Inuit-Ernährung aus Fisch und Fleisch. Unbestreitbar ist demnach, dass sich auch bei der Spezies Mensch vorteilhafte Gene in bestimmten Situationen unter speziellem Selektionsdruck durchsetzen - und demnach die Evolution auf menschliche Populationen wirkt. Aber ist das gleichbedeutend mit der Evolution der Menschheit in eine neue Art? Ein Post-Homo-sapiens dürfte so kaum entstehen, meint Alexandre Courtiol: "Wenn es mit uns so weitergeht wie bisher, wird das nicht zu neuen Arten führen. Populationen können durchaus definiert werden - dies aber nur beim willkürlichen Blick auf ausgewählte Erbgutfaktoren statt auf alle Gene." Ein menschlicher Artbildungsprozess, bei dem sich zwei Spezies auseinanderentwickeln, ist heute undenkbar. Obwohl, scherzt Courtiol: "Wenn wir eines Tages keinen Sprit mehr haben sollten und aufhören würden, uns in der Welt zu bewegen, könnten einige Populationen sehr isoliert werden - und das wäre dann eine andere Geschichte."

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.