Kulturen statt Kaninchen: Können Stammzellen Tierversuche ersetzen?
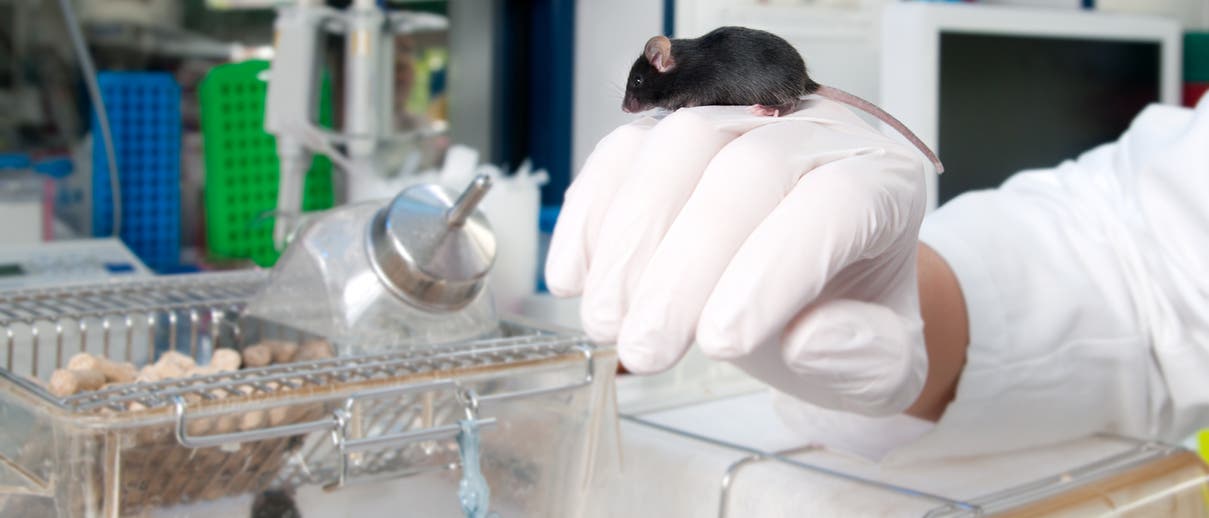
Rund 1,9 Millionen Versuchstiere wurden 2021 nach Angaben des Bundesinstituts für Risikoforschung in Deutschland eingesetzt. Es sind Mäuse, aber auch Fische, Ratten, Kaninchen, Vögel und andere. In die Zahl noch gar nicht eingerechnet sind Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke wie die Organentnahme gezüchtet oder nicht verwendet wurden – weil sie zum Beispiel das falsche Geschlecht hatten –, und wirbellose Tiere wie Fadenwürmer oder Taufliegen. Eingesetzt werden die Tiere hauptsächlich im Bereich der Grundlagenforschung, also um beispielsweise biologische Vorgänge im Körper besser zu verstehen, jedoch ebenso, um an ihnen etwa Arzneimittel, Chemikalien für Haushaltsmittel oder Impfstoffe zu testen und Krankheiten zu erforschen.
Die Versuche sind umstritten. Kritiker halten die Züchtung und Nutzung von Versuchstieren für »unethisch«. Mehr noch: Sie sagen, Ergebnisse aus Tierversuchen seien nicht auf Menschen übertragbar, und fordern deshalb den Einsatz tierversuchsfreier Alternativen. Tatsächlich gibt es die bereits. Der Bioingenieur und Professor Peter Loskill von der Universität Tübingen erforscht solche Verfahren, bei denen statt Tieren gezüchtete Gewebe verwendet werden. »Wir versuchen praktisch den Zellen das Gefühl zu geben, dass sie immer noch im Körper wären«, erklärt er. Mit seinem Team nutzt er dazu mehrere Modelle.
Eines davon: Organoide. Das sind dreidimensionale Zellstrukturen, die Funktionsweisen einzelner Organe wie zum Beispiel Leber oder Harnblase abbilden. Die Forscherinnen und Forscher züchten sie im Labor aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen). Diese gewinnen sie aus Körperzellen, etwa aus der Haut, und wandeln sie technisch in die gewünschten Zelltypen und Gewebe um.
Schon heute geht es ohne Tierversuche – manchmal
Einige Organoidmodelle basieren direkt auf Zellen von Patienten und Patientinnen und können darum für personalisierte Untersuchungen genutzt werden. Allerdings geben sie immer nur Rückschlüsse auf einen Teil des menschlichen Körpers. Loskill und sein Team arbeiten deshalb auch an so genannten Organ-on-a-Chip-Modellen. Bei diesen befinden sich mehrere Organoide auf einer etwa streichholzschachtelgroßen Plattform und sind über winzige Kanäle, durch die eine blutähnliche Nährstofflösung fließt, miteinander verbunden.
Mit Hilfe der unterschiedlichen Modelle wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Vorhersagen treffen, ganz ähnlich wie heute mit Tierversuchen: zu körperlichen Reaktionen auf ein neues Medikament oder zur Giftigkeit einer neuen Chemikalie beispielsweise. Sie arbeiten dafür auch mit Partnern zusammen, die auf »In-silico-Modelle« – Computersimulationen – spezialisiert sind. Neben der Entwicklung der Alternativen bringen die Forscher und Forscherinnen diese bei Partnern etwa aus der Pharmaindustrie zur Anwendung und testen deren Modelle.
In manchen Bereichen leisten die Alternativen dabei laut Loskill bereits gute Arbeit. Etabliert sei mittlerweile zum Beispiel künstliche Haut. Zum Einsatz kommen zudem die von ihm und seinem Team entwickelten Retina-on-a-Chip-Systeme, die die Netzhaut des Auges nachbilden.
»IPS-Zellen lassen sich ebenfalls sehr effizient nutzen«, sagt Julia Skokowa. Sie ist Professorin für Translationale Onkologie am Universitätsklinikum Tübingen und forscht zum Thema Leukämieentstehung und an Gentherapie-Ansätzen für Menschen mit seltenen Krankheiten.
»Wir generieren zum Beispiel iPS-Zellen aus dem Blut von Patientinnen und Patienten mit diesen Erkrankungen oder Leukämie«, erklärt sie. Dadurch konnten unter anderem schon neue Medikamente identifiziert werden, die sich potenziell für die Behandlung von Blutkrebs eignen. Doch die Methoden haben auch Grenzen: So können nicht alle Genmutationen mit iPS-Zellen und daraus gezüchteten Zellen untersucht werden. Außerdem unterscheiden sich die Blut bildenden Stammzellen, die aus iPS-Zellen hergestellt sind, stark von den primären Blut bildenden Stammzellen bei Menschen. Nicht alle Ergebnisse aus der iPS-Forschung sind deshalb übertragbar.
Wo die Alternativmodelle an Grenzen stoßen
Darüber hinaus müssen neue Medikamente erst in vivo, also im lebenden Organismus, getestet werden, bevor sie in klinischen Studien an Menschen eingesetzt werden dürfen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Universitätsklinikums nutzen dazu gentechnisch veränderte Mäuse, die sie je nach Studie entweder von speziell akkreditierten Versuchstierzüchtern beziehen oder in Tierhaltungen der Universität züchten.
»Wir versuchen schon, die Anzahl der Tierversuche zu minimieren«Julia Skokowa, Universitätsklinikum Tübingen
An diesen Tieren testen die Forschenden etwa speziell für Menschen mit Leukämie oder seltenen Erkrankungen entwickelte Gentherapien. In manchen Versuchen bestrahlen sie die Mäuse, so dass transplantierte menschliche Zellen besser wachsen und vom Immunsystem der Tiere nicht angegriffen werden. »Dann untersuchen wir, ob Medikamente, die in vitro gegen Leukämie-Zellen wirken, das auch im lebenden Organismus tun. Und ob sich genmodifizierte Zellen im Körper wie im Reagenzglas verhalten«, erklärt Skokowa. Die Bestrahlung allein sei dabei in der Regel nicht schmerzhaft für die Tiere. Sie könne aber, je nach Dosis, später zu Belastungen führen. Darum werden die Mäuse überwacht.
»Wir versuchen schon, die Anzahl der Tierversuche zu minimieren und so viel wie möglich in vitro nachzuahmen«, sagt Skokowa. Doch manches, wie zum Beispiel die Verstoffwechslung von Medikamenten, die Langzeitbeobachtung von genmodifizierten Zellen und die Bildung von Metastasen, lassen sich bislang nur am lebenden Organismus erforschen.
Auch bei komplexen neurologischen Vorgängen, der Verhaltensforschung und generell bei Prozessen, an denen viele unterschiedliche Organe oder Bereiche des Immunsystems beteiligt sind, stoßen die Alternativmethoden laut Loskill noch an ihre Grenzen. »Das Immunsystem ist wegen seiner Komplexität sehr schwer im Reagenzglas nachbildbar. Allerdings besteht hier großer Bedarf, da es sich stark zwischen Tieren und Menschen unterscheidet«, erklärt er.
Die Kritik von Tierversuchsgegnern hält er dennoch für zu absolut formuliert. Kein Modell sei perfekt. Sowohl In-vitro- wie In-vivo-Methoden hätten Vor- und Nachteile. »Klar ist: Man hat ein Übertragbarkeitsproblem. Das löst man aber nicht dadurch, dass man keine Versuche mehr macht, weil man dann keine Daten mehr gewinnt«, sagt er. Ebendiese Daten aus den verschiedenen Quellen brauche es jedoch, um die Forschung voranzutreiben und die bisherigen Modelle weiter zu verbessern.
Strenge Regeln für Tierversuche
Hinzu kommt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tierversuche in Deutschland nicht ohne Weiteres durchführen können. Sie müssen sich an das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Versuchstierverordnung halten. Letztere setzt eine EU-Richtlinie über die rechtlichen Standards von für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tieren um, der das »3R«-Prinzip zu Grunde liegt.
»3R« steht für »replacement«, »reduction« und »refinement«, zu Deutsch etwa Vermeidung, Verminderung und Verbesserung. Forscher und Forscherinnen, die einen Tierversuch planen, müssen vorab in einem Genehmigungsantrag erklären, wie sie die 3 Rs umsetzen wollen. Vor jedem Eingriff müssen sie nachvollziehbar erläutern, weshalb ein Versuch mit einer bestimmten Tierart für die Forschung unbedingt notwendig und ethisch vertretbar ist und nicht durch eine schonendere Methode ersetzt werden kann. Ist für einen Tierversuch ein geeignetes Alternativmodell verfügbar, müssen sie mit diesem an Stelle eines Versuchstiers arbeiten.
»Wenn Modelle vorliegen, die besser als Tierversuche sind, wird ein Großteil der Forschungslandschaft automatisch auf sie wechseln«Peter Loskill, Universität Tübingen
Zudem müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeben, wie viele Tiere sie benötigen werden, um neue und aussagekräftige wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen, wobei die Behörden nur die unbedingt notwendige Anzahl an Tieren genehmigen. Die Belastungen für die Versuchstiere müssen über den gesamten Versuchszeitraum so niedrig wie möglich bleiben. Ein Tiermediziner begleitet jeden Antrag und überprüft ihn.
Nur bestimmte Berufsgruppen, die im Umgang mit Versuchstieren geschult sind und sich regelmäßig über den aktuellen Stand des Tierschutzrechts und neue, schonende Alternativmethoden fortbilden, dürfen Tierversuche durchführen. Die Einhaltung sämtlicher Regeln und Vorschriften wird dabei streng kontrolliert. Tierschutzbeauftragte überwachen jeden Eingriff im Rahmen eines Versuchs. Jährlich kontrollieren außerdem die Genehmigungsbehörden, ob die Versuchstiere etwa entsprechend den Anforderungen des Tierschutzes gehalten werden.
Wie die Zukunft der Tierversuche aussehen könnte
»Die hohen bürokratischen Hürden führen bereits dazu, dass die Zulassungsprozesse extrem langsam sind oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler notwendige Tierversuche gar nicht erst durchführen«, sagt Skokowa. Wenn sich das nicht ändere, werden künftig mehr Tierversuche ins Ausland verlagert werden, wo die Bedingungen zum Teil wesentlich schlechter als in Deutschland seien. Hinzu komme, dass Deutschland als Standort für ausländische wie auch deutsche Forschende nicht mehr attraktiv genug sei. Skokowa fände es hilfreicher, die Entwicklung von Alternativmethoden stärker voranzutreiben, anstatt bürokratische Hürden zu errichten. »Kein Wissenschaftler möchte Tierversuche durchführen«, betont sie. Doch in vielen Fällen sei das derzeit der einzige zuverlässige Weg, Hypothesen zu überprüfen, an denen am Ende Menschenleben hängen.
Peter Loskill ist der Auffassung, dass sich aktuelle Diskussionen zu oft um etwaige Verbote von Tierversuchen drehen. »Wenn Modelle vorliegen, die besser als Tierversuche sind, wird ein Großteil der Forschungslandschaft automatisch auf sie wechseln«, sagt er. Dazu brauche es aber breit angelegte Programme. Zudem fehlen Infrastrukturen und Weiterbildungsmöglichkeiten, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zugang zu den Alternativmethoden zu ermöglichen. Diese stünden bislang nur für Tierversuche zur Verfügung. Im akademischen System würden manchmal noch »aus Gewohnheit« Tierversuche verlangt, ohne an die Alternativen zu denken oder die Relevanz des jeweiligen Versuchs zu hinterfragen.
Wenn all diese Hürden genommen werden: Wäre es dann möglich, eines Tages Tierversuche abzuschaffen? Da sind die beiden Fachleute eher zurückhaltend. »In den nächsten Jahren werden die Vielfalt und die Komplexität der Alternativmethoden sich immer mehr erweitern und so nach und nach im kommenden Jahrzehnt die Anzahl der notwendigen Tierversuche stark verringern«, erklärt zwar Peter Loskill. Ob irgendwann in Zukunft ein kompletter Verzicht möglich sein wird, ist für ihn jedoch kaum vorhersehbar, da einige Versuche nur sehr schwer zu ersetzen sind. In der Medikamentenentwicklung etwa hält Julia Skokowa es für schwierig, in absehbarer Zeit von Tierversuchen komplett wegzukommen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.