Malediktologie: Fluchen im Dienst der Wissenschaft
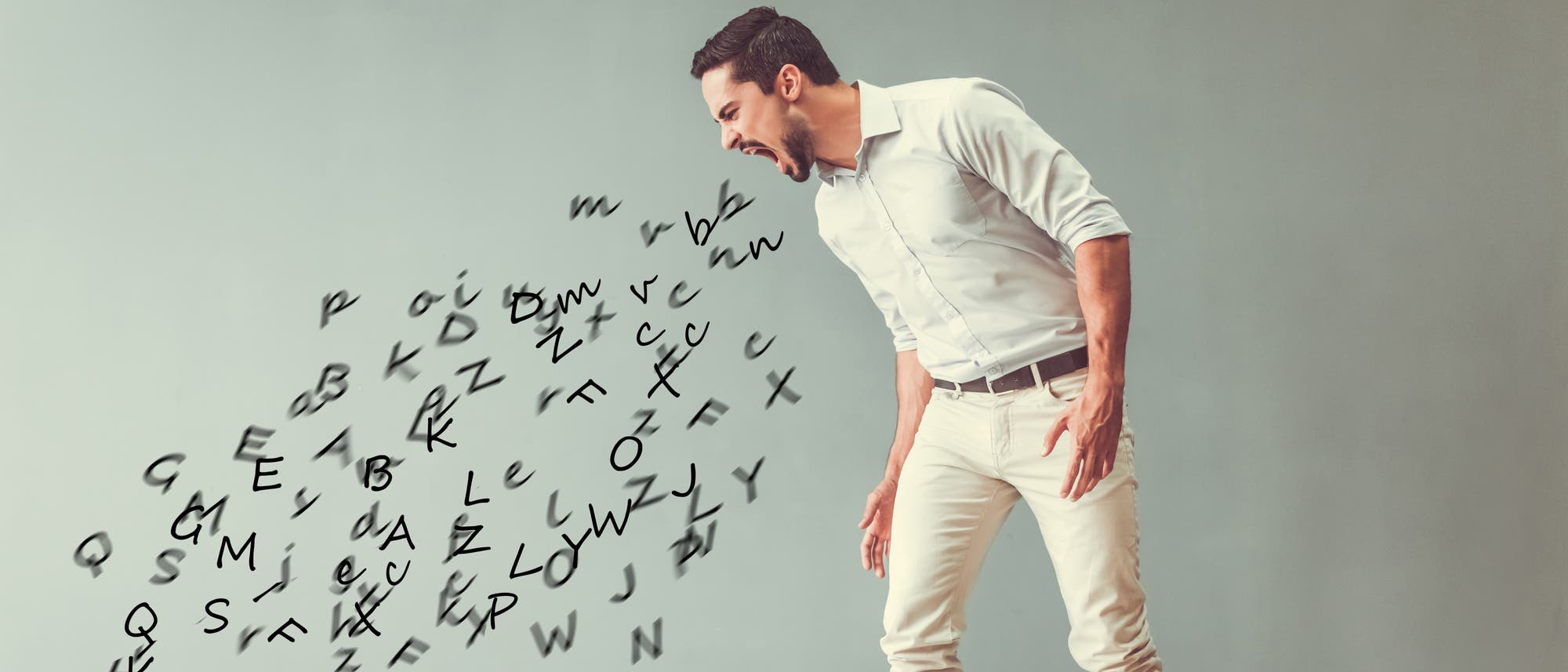
Wir alle tun es – und zwar von Kindesbeinen an bis ins Greisenalter, ob wir allein sind oder in Gesellschaft: Wir fluchen und schimpfen, was das Zeug hält. Dabei entfleucht unseren Mündern allerhand Fäkales, Sexuelles, Tierisches und Gottloses. Wolfgang Amadeus Mozart unterzeichnete Briefe angeblich gern mit »Herzlichst Ihr Süssmaier Scheißdreck«. Sittenwächter des 15. Jahrhunderts bestraften solche Obszönitäten mit dem Abschneiden der Zunge oder gar mit dem Tod. Heute wachen staatliche Anstalten darüber, welche Filme und Songs – unter anderem wegen ihrer Wortwahl – auf dem Index für jugendgefährdende Medien landen.
Denn Vulgärsprache hat eine ungeheure Macht. Mit ihr lassen sich extreme Emotionen transportieren (meist Wut und Frustration). Sie kann beleidigen, unterdrücken und ausgrenzen. Und dennoch sollte man einen differenzierten Blick auf sie werfen. Lange war sich die Forschung zu fein, sich des schmutzigen Teils unserer Kommunikation anzunehmen. Erst 1973 gründete der deutschstämmige Chemieingenieur Reinhold Aman in den USA die wissenschaftliche Disziplin der Malediktologie (vom lateinischen »maledicere« für schimpfen). Malediktologen untersuchen die psychologischen, soziologischen, linguistischen und neurobiologischen Aspekte des Fluchens.
Und sie haben einiges zu Tage gefördert, was den ein oder anderen überraschen mag: Fluchen tut gut! Es dient dem Sprecher als Ventil für Aggressionen, lindert Stress und Schmerzen – etwa wenn wir uns mit dem Hammer versehentlich auf den Daumen schlagen. In anderen Situationen setzen wir Kraftausdrücke bewusst ein, um Personen gezielt zu beleidigen. Ein Beispiel hierfür ist die verbale Entgleisung von Joschka Fischer 1984 dem damaligen Bundestagsvizepräsidenten gegenüber: »Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.« Ebenso fluchen wir, wenn wir Humor, Sarkasmus oder Überraschung zum Ausdruck bringen wollen.
Der amerikanische Psychologe Timothy Jay vom Massachusetts College of Liberal Arts gehört zu den produktivsten Forschern auf dem Gebiet. Laut seinen Erhebungen bestanden die Top Ten der englischsprachigen Kraftausdrücke in den Jahren 1989 bis 2009 aus den Wörtern »fuck«, »shit«, »hell«, »damn«, »goddamn«, »Jesus Christ«, »ass«, »oh my god«, »bitch«, »sucks«. 2014 werteten Wenbo Wang und sein Team von der Wright State University in Ohio 51 Millionen zufällig ausgewählte Twitter-Einträge aus – fast acht Prozent der Tweets enthielten obszöne Sprache. 90 Prozent davon nutzten mindestens einen von sieben entsprechenden Begriffen. Die Deutschen fluchen am liebsten anal-fäkal (Arsch, Mist, Scheiß, Kack). Niederländer beziehen sich gern aufs Pathologische. Zu ihren stärksten Kraftausdrücken gehören Umschreibungen für Krebs, Typhus und Tuberkulose.
Geflucht wird über alle sozioökonomischen Schichten hinweg. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass Menschen mit gesellschaftlich niedriger Stellung mehr fluchen als jene mit höherem Status – vermutlich, weil sie weniger zu verlieren haben. Auch die Persönlichkeit spielt eine Rolle. So fluchen extravertierte und dominante Personen häufiger. Weniger verbreitet ist der Gebrauch von Schimpfwörtern unter religiösen Menschen und jenen mit sexueller Ängstlichkeit. Mormonen verzichten gänzlich darauf und verwenden (zumindest im Kontakt mit anderen) lediglich Euphemismen. Dass Fluchen und Schimpfen einen mangelnden Wortschatz attestiert, ist ein häufig anzutreffender Mythos. Vielmehr deutet ein großer Schimpfwortschatz auf gute sprachliche Fähigkeiten hin, wie Timothy und Kristin Jay 2015 herausfanden.
Tabubruch als Kennzeichen
Alle Fluchbegriffe eint, dass Tabus eine entscheidende Rolle spielen. Ob etwas allerdings als Affront oder Tabubruch wahrgenommen wird, ist stark situationsabhängig. Es ist etwa ausschlaggebend, in welcher Beziehung die Gesprächspartner zueinander stehen, welche Intention der Fluchende verfolgt und welche Intonation er dabei an den Tag legt. Tabuwörter sind außerdem dem Zeitgeist unterworfen. So haben blasphemische Äußerungen wie »oh Gott« in vielen westlichen Kulturen an Schärfe verloren. Oder das rassistische N-Wort: Noch vor mehreren Jahrzehnten galt es als ziemlich unproblematisch, heute ist es in den meisten Gesellschaften geächtet. Doch auch hier gibt es Ausnahmen: Anhänger der afroamerikanischen Hip-Hop-Jugendkultur verwenden den Ausdruck als ironische Begrüßungsfloskel.
Ob ein Begriff als Tabu aufgefasst wird, kann man unter anderem daran erkennen, ob der Sprecher ihn in einen Euphemismus verpackt – etwa, wenn er »Scheibenkleister« statt »Scheiße« sagt. Dabei bezieht sich das Tabu immer auf das Wort an sich: Es ist egal, ob man »Scheiße« im Zusammenhang mit Schmerzen äußert oder wirklich Fäkalien meint. Hingegen ist das kindliche »AA« oder der medizinische Begriff »Stuhlgang« weniger problematisch. Die ersten Schimpfwörter nehmen Kinder mit ungefähr zwei Jahren in den Mund. Zuerst sind sie neutral, doch in Kombination mit den entsetzten Reaktionen der Eltern und mit Bestrafung erhalten sie eine negative Konnotation. All das nützt letztlich nichts: »Die Menschen erinnern sich zwar daran, wie ihnen mit Seife der Mund ausgewaschen wurde, der ultimative Effekt bleibt jedoch aus«, so der Psychologe Timothy Jay.
Denn der Drang zum Fluchen und Schimpfen ist tief in uns verwurzelt. Was genau macht die Kraft solcher Tiraden aus? Vieles deutet darauf hin, dass sich Kraftausdrücke kategorisch vom Rest der Sprache unterscheiden. Auf linguistischer Ebene fällt auf: Schimpfen ist ein reduzierter Sprechakt. Ähnlich wie Warnungen (»Feuer!«) sind Flüche wenig komplex. André Meinunger vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin ist der Ansicht, dass sie in ihrer Einfachheit und Expressivität eine Urform des heutigen Sprechens darstellen. Außerdem erzeugen Schimpfwörter im Gegensatz zu anderen Begriffen beim Empfänger und Sender starke physiologische Erregung (das so genannte Arousal), die sich experimentell messen lässt.
J. J. Tomash und Phil Reed von der Swansea University in Wales wiesen den Effekt 2013 bei 26 Studenten nach. Diese reagierten beim Aussprechen von Tabuwörtern (wie »shit«) im Vergleich zu emotional negativen (wie »cancer«) und neutralen Bezeichnungen mit einem erhöhten Hautleitwert. Das traf vor allem auf jene Personen zu, die in der Vergangenheit häufiger fürs Fluchen bestraft worden waren.
Den stärksten Eindruck hinterlassen Schimpfwörter, wenn wir sie in unserer Muttersprache hören. Entsprechend abgeschwächt fällt die physiologische Reaktion auf sie in der Zweitsprache aus, wie die Psychologin Catherine Caldwell-Harris von der Boston University 2004 bei spanisch-englischen Bilingualen nachwies. Dies galt jedoch nur für jene lateinamerikanischen Eingewanderten, die erst im Jugendalter Englisch gelernt hatten. Waren sie in den USA aufgewachsen, reagierten sie gleich stark auf Tabuwörter in ihrer Mutter- wie in ihrer Zweitsprache.
An Schimpfwörter können wir uns zudem besser erinnern als an neutrale Begriffe, wie Kevin LaBar von der Duke University in Durham und Elizabeth Phelps von der Harvard University in Cambridge bereits 1998 demonstrierten. Vermutlich liegt dies an dem Arousal, das sie erzeugen. Hierdurch kommt es zur Aktivierung der Amygdala, die als Teil des limbischen Systems emotionale Bewertungen vornimmt und die Gedächtnisbildung im Hippocampus beeinflusst. Bei Probanden, denen im Zuge einer Lobektomie Hirngewebe im Bereich der Amygdala entfernt worden war, entfiel der Erinnerungsvorteil. Elizabeth Kensinger und Suzanne Corkin, damals am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, bestätigten 2004 die Ergebnisse von LaBar und Phelps. Die Versuchsteilnehmer erinnerten sich an Wörter, die ein hohes Arousal erzeugten, selbst dann besser, wenn sie beim Lernen abgelenkt waren. Das Gehirn verarbeite Tabuwörter automatisch, das heißt unabhängig davon, ob sie unsere Aufmerksamkeit erlangen, schlussfolgerten die Forscherinnen.
Derbe Sprache hat auch Vorteile
Außerdem erschweren die Ausdrücke den Zugriff auf das innere Lexikon, wie Christopher Madan 2016 herausfand. Der Psychologe, der aktuell an der University of Nottingham forscht, und sein Team führten hierzu folgendes Experiment durch: 39 Freiwillige sollten per Tastendruck so schnell wie möglich jeweils entscheiden, ob es sich bei einer Buchstabenfolge um ein echtes Wort handelte oder nicht. Die Studenten waren bei Tabuwörtern signifikant langsamer als bei neutralen oder anderen emotionalen Begriffen – möglicherweise eine Art innerer Abwehrmechanismus. Eine eingehendere Analyse zeigte, dass der Effekt nicht durch die starken Emotionen, die die Wörter auslösten, zu erklären war, als vielmehr durch den Grad der Tabuisierung.
Vulgäre Sprache kann Feindseligkeit und Angst in anderen schüren und den sozialen Status gefährden. Doch sie hat durchaus auch positive Effekte. Etwa auf die eigene Glaubwürdigkeit, wie die Rechtspsychologen Eric Rassin und Simone van der Heijden, damals beide an der Erasmus-Universität in Rotterdam, 2005 herausfanden. 70 Freiwillige sollten fiktive Aussagen von Menschen lesen, die einer Straftat verdächtig waren, und deren Glaubwürdigkeit einschätzen. Tatsächlich trauten die Probanden jenen Aussagen mehr, die Kraftausdrücke enthielten, wie: »No, God damn it. As I have stated ten times, I have nothing to do with that. […] I have been here in this shitty room for almost two hours now […] What a fucking mess.«
Nicoletta Cavazza und Margherita Guidetti von der Universität Modena in Italien kamen 2014 zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Forscherinnenduo hatte sich gefragt, warum die Partei von Beppe Grillo bei den italienischen Parlamentswahlen 2013 so viele Stimmen bekommen hatte. Schließlich war der ehemalige Komiker immer wieder durch seine derbe, unkonventionelle Sprache aufgefallen. Die Wissenschaftlerinnen legten 110 Italienern zwischen 20 und 68 Jahren (darunter 60 Prozent Frauen) fiktive Blog-Einträge vor. Die Teilnehmer sollten sich vorstellen, dass sie für eine anstehende Wahl recherchierten. Und wieder zeigte sich: Enthielten die Texte Schimpfwörter, empfanden die Probanden sie als überzeugender; es beeinflusste jedoch nicht ihre Wahlentscheidung. Eine direkte Beleidigung des politischen Gegners wäre wohl weniger gut angekommen, geben die Autorinnen zu bedenken. Verwenden Politiker Slang und derbe Sprache aber ganz nebenbei, könnten sie dadurch nahbarer wirken.
Die Linguistin Nicola Daly, heute an der University of Waikato in Neuseeland, untersuchte 2004 die Rolle vulgärer Sprache für die Gruppendynamik. Sie zeigte am Beispiel von Arbeitern einer Seifenfabrik, dass Außenstehende nur Mitglied einer Gruppe werden können, wenn sie deren Slang übernehmen und ihre Solidarität mit Hilfe bestimmter Kraftausdrücke transportieren. Um die Arbeitsatmosphäre zu verbessern, empfehlen manche Forscher Managern sogar, unkonventionelle oder unzivilisierte Sprache unter Mitarbeitern zuzulassen (sofern diese damit niemanden diskriminieren).
Ein wichtiger Zweck des Schimpfens ist das kathartische »Dampfablassen«. Es wirkt wie ein Ventil und kann psychische Anspannung lösen. Befragt man Menschen direkt nach den Gründen für ihr Fluchen, geben sie häufig den Abbau von Stress und negativen Emotionen an. Außerdem lindert es Schmerzen. Die erste Untersuchung hierzu stammt von Richard Stephens von der Keele University in Staffordshire. In einem Experiment sollten insgesamt 67 Studenten ihre Hand in Eiswasser halten – eine schmerzhafte Prozedur. Wer währenddessen vulgäre statt neutrale Begriffe von sich gab, hielt im Schnitt ganze 40 Sekunden länger durch. Zugleich zeigten diese Probanden eine verminderte Schmerzwahrnehmung und einen erhöhten Herzschlag.
Schimpfen steigert die körperliche Leistungsfähigkeit
Schimpfen steigert das Aggressionslevel und versetzt den Körper in Alarmbereitschaft, vermuten die Forscher. Die Kampf-oder-Flucht-Reaktion des autonomen Nervensystems führe letztendlich zu einer Schmerzdämpfung. Für die These spricht beispielsweise, dass Stress ebenfalls eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion im Körper bewirkt und bekanntermaßen einen schmerzlindernden Effekt hat. Stephens untermauerte seine Aggressionstheorie 2012 mit einer Folgestudie. Gemeinsam mit seiner Kollegin Claire Allsop machte er seine Probanden aggressiv, indem er sie Egoshooter spielen ließ. Daraufhin hatten diese eine erhöhte Kälteschmerztoleranz im Vergleich zu jenen, die virtuelles Golf gespielt hatten. 2018 entdeckte der Psychologe dann einen weiteren Effekt: Schimpfen steigert die körperliche Leistungsfähigkeit. Zu dem Ergebnis kam er, nachdem er Personen auf einem Hometrainer strampeln ließ – und diese fluchend gegen einen größeren Widerstand antreten konnten.
Widerstandsfähig gegen Schmerzen
Interessanterweise scheinen Schimpfwörter nicht nur körperlichen, sondern auch sozialen Schmerz zu lindern, wie er etwa durch Ausgrenzung hervorgerufen wird. Zumindest legen das die Ergebnisse von Michael Philipp von der Massey University in Neuseeland und Laura Lombardo von der australischen University of Queensland aus dem Jahr 2017 nahe. 62 Probanden sollten eine Episode aus ihrem Leben niederschreiben, in der sie sich entweder ausgegrenzt oder integriert gefühlt hatten. Anschließend hielten sie ihre Hände in Eiswasser und riefen dabei selbst gewählte Kraftausdrücke oder neutrale Begriffe. Wer über ein seelisch schmerzhaftes Ereignis berichtet hatte, reagierte empfindlicher auf den Kälteschmerz. Das Fluchen zeigte hier gleich auf zwei Ebenen Wirkung: Es linderte den emotionalen Schmerz und erhöhte die Kältetoleranz.
Das Äußern von Obszönitäten kann aber auch pathologisch sein: Bestimmte neurologische Schäden gehen mit dem exzessiven Gebrauch von Schimpfwörtern einher. Andere sind dagegen plötzlich unfähig zu fluchen. Derartige Fälle lehren uns etwas darüber, wo genau die vulgäre Sprache im Gehirn verortet ist. Anders als bei der »normalen« Sprache spielt für sie die rechte Hirnhälfte offenbar eine entscheidende Rolle. Ende des 19. Jahrhunderts beschrieb der französische Chirurg Paul Broca die nach ihm benannte Broca-Aphasie seines berühmten Patienten Leborgne. Dieser konnte auf Grund einer Läsion im linken Stirnlappen nur noch »tan tan« sagen. Was bei den Berichten meistens unterschlagen wird: Erstaunlicherweise war er weiterhin im Stande zu fluchen (»Sacre nom de dieu!«). Da seine rechte Hirnhälfte intakt war, folgerten Neuroanatomen, dass der unkontrollierte, automatischere Teil unserer Sprache inklusive des Fluchens stärker von dieser Hemisphäre gesteuert wird.
Der präfrontale Kortex, der vordere Teil des Stirnlappens, dient als Kontrollinstanz und ist unter anderem für die Fluch-Etikette zuständig. Er bewertet soziale Situationen und unterdrückt unangemessenes Verhalten. Was passiert, wenn dieser Kontrollmechanismus ausfällt, sieht man zum Beispiel am Tourette-Syndrom. Symptome sind unwillkürliche, plötzliche Bewegungen und Lautäußerungen, so genannte motorische und vokale Tics wie Augenrollen oder Räuspern. 20 Prozent der Betroffenen leiden auch unter Coprolalie – dem zwanghaften Äußern von vulgären Wörtern. Bildgebende Studien zeigen unter anderem, dass im unteren Stirnlappen die weiße Substanz (die Fortsätze von Nervenzellen im Zentralnervensystem) reduziert ist. Ähnliche Schäden hatte der berühmte Patient Phineas Gage: Eine Eisenstange hatte sich 1848 durch seine beiden Frontallappen gebohrt. Er veränderte sich daraufhin grundlegend. Zwar behielt er seine flüssige Sprache, jedoch war er seitdem enthemmt, verhielt sich anzüglich und war außer Stande, seine derbe Ausdrucksweise dem sozialen Kontext anzupassen. Ebenso scheint das Fluchen und Schimpfen bei Menschen mit Alzheimerdemenz mit Schäden in dieser Region zusammenzuhängen.
Psychologen der Universität Gent ließen gesunde Teilnehmer im Hirnscanner Wortpaare in einer Reihenfolge aufsagen, die leicht zu verschiedenen Arten von Versprechern führt. Manche Fehler resultierten in Tabuwörtern. Ohne dass es Teil der Aufgabe war, versuchten die Probanden, die vulgären Begriffe zu unterdrücken. Das spiegelte sich im Gegensatz zu neutralen Versprechern in einer verstärkten Aktivierung des rechten unteren Stirnlappens wider. Womöglich sorgt schon das bloße Denken an ein Tabuwort bereits für seine Hemmung – gesteuert durch den Frontallappen.
Wenn die Kontrollinstanz versagt
Fällt diese Kontrolle aus, können bestimmte Hirnbereiche nicht mehr in Schach gehalten werden. Shlomit Finkelstein von der Emory University in Atlanta berichtete 2018 von zwei seltenen Fällen des Tourette-Syndroms mit Coprolalie. Einer der Patienten zeigte weniger die typischen motorischen Tics, seine Zwänge bestanden zu 90 Prozent aus verbalen Ausfällen. Der andere war ein 15-jähriger Junge, der alle zwei Sekunden »fuck« sagte. Bei beiden fand sich eine übersteigerte Aktivierung in Teilen des limbischen Systems (im anterioren cingulären Kortex und in der Inselrinde) sowie in den Basalganglien. Dies deckt sich mit den Befunden von Kirsten Müller-Vahl von der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie und ihre Kollegen wiesen 2009 mit bildgebenden Verfahren bei Tourette-Patienten Anomalien in den Verbindungen der Nervenzellen innerhalb des Stirnlappens nach. Den Forschern zufolge sorgt das für eine Enthemmung des limbischen Systems und der Basalganglien.
Flüche sind auf das Wesentliche reduziert – und könnten eine Vorform der heutigen Sprache darstellen
Es mag kein Zufall sein, dass Schimpfen viel gemein hat mit nichtsprachlichen Äußerungen wie Weinen und Schreien. Auch diese laufen meist unwillentlich ab und drücken starke negative Emotionen aus. Neurobiologisch stehen sie ebenfalls unter der Kontrolle der rechten Hemisphäre. Dass sich Fluchen und Schreien auf funktioneller Ebene ähneln, verdeutlichten Neurowissenschaftler der University of Singapore 2015. Versuchsteilnehmer sollten ihre Hände in Eiswasser halten und währenddessen entweder Schmerzensrufe ausstoßen, Tonaufnahmen von solchen Rufen lauschen, einen Knopf drücken oder nichts tun. Sie hielten den Kälteschmerz nur dann länger aus, wenn sie dabei selbst rufen konnten. Die Schreie hatten einen ähnlichen schmerzlindernden Effekt wie das Fluchen in den Experimenten von Richard Stephens.
Einige Forscher sehen in Kraftausdrücken auch deutliche Parallelen zu Tierlauten. Sie glauben, dass sich das Fluchen und Schimpfen im Lauf der Evolution aus ihnen entwickelt haben könnte und den Übergang zwischen dem bloßen Vokalisieren und der menschlichen Sprache gebildet hat. Diese Sicht teilt der Sprachwissenschaftler André Meinunger: »Es verwundert sehr, dass Schimpfen und Fluchen im weitesten Sinne noch nicht als Ursprache vorgeschlagen wurde. Es scheint doch auf der Hand zu liegen, dass Unmutsäußerungen sicher zu den ersten Sprechakten gehörten. Auch im heutigen Schimpfen steckt viel Archaisches.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.