Materialwissenschaften: Poren mit Potenzial
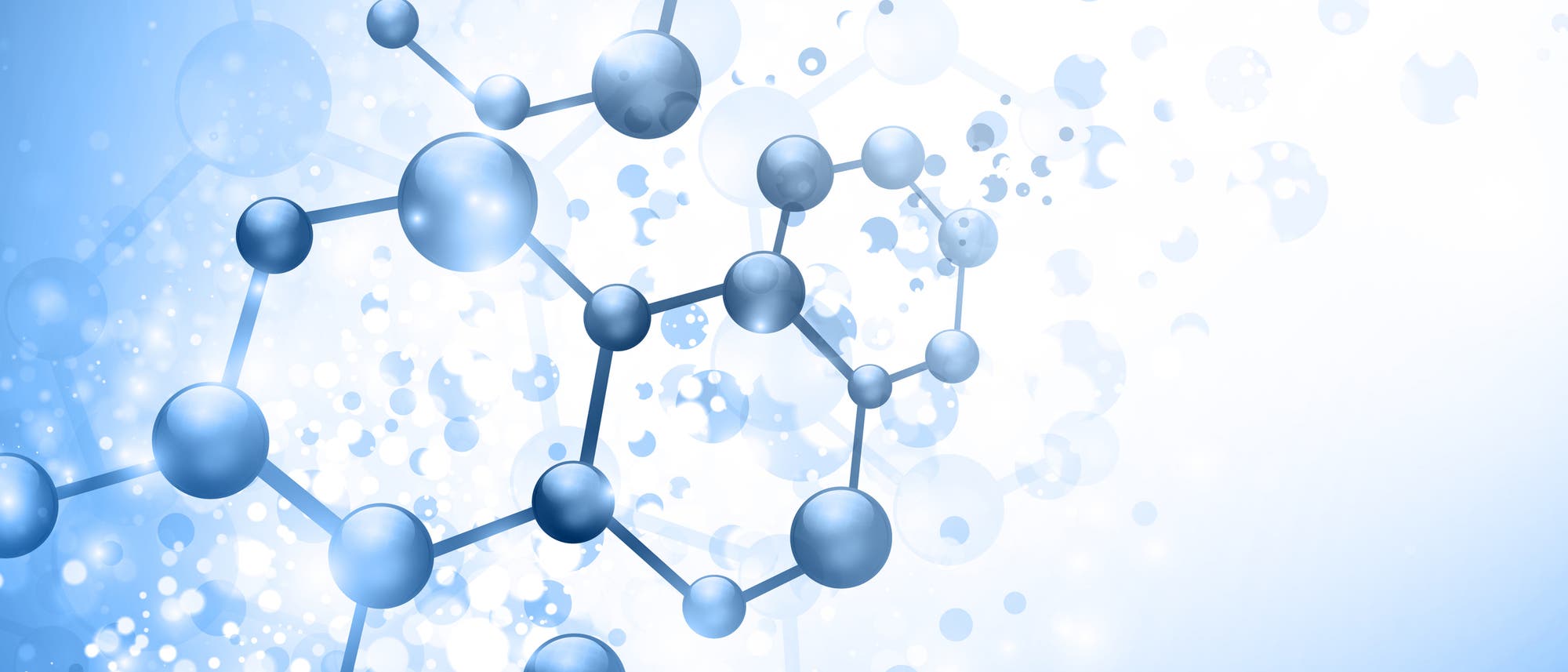
Der Firmensitz des Chemiekonzerns BASF gleicht einer kleinen Stadt, die sich nahe Ludwigshafen längs des Rheins erstreckt – erbaut aus glitzerndem Stahl. Tagsüber bevölkern etwa 50 000 Mitarbeiter das weitläufige Areal, durch das sich Gassen mit Namen wie Methanolstraße, Ammoniakstraße, Gasstraße ziehen und damit auf die Produktpalette des Konzerns anspielen.
In den vergangenen zwei Jahren legte eine kleine Flotte von Lieferwagen und Autos insgesamt Tausende von Kilometern auf diesen Straßen zurück. Eigentlich nichts Besonderes, wenn ihre Treibstofftanks nicht mit einem außergewöhnlichen kristallinen Material, durchlöchert mit etwa ein Nanometer großen Poren, gefüllt wären. Im Inneren dieser Poren befinden sich Methanmoleküle – die, aufgestapelt in Reih und Glied, die Verbrennungsmotoren der Fahrzeuge antreiben.
Bei den Kristallen handelt es sich um metallorganische Gerüste (englisch: metal-organic frameworks, kurz MOFs). Diese molekularen Gerüste bestehen aus metallhaltigen Knotenpunkten, die durch organische Verbindungselemente verknüpft werden (siehe "Eine offene Box"). Die in dieser Struktur entstehenden Poren eignen sich hervorragend, um Gasmoleküle zu speichern, und teils sogar dazu, diese Moleküle in chemische Reaktionen zu verwickeln. Zudem lassen sich MOFs exakt maßschneidern: Mehr als 20 000 Varianten haben Wissenschaftler bereits entwickelt. Mögliche Anwendungen reichen von der CO2-Abscheidung in Rauchgasen bis hin zur Trennung von hartnäckigen industriellen Gemischen, dem Katalysieren chemischer Reaktionen oder dem Aufdecken molekularer Strukturen. "MOFs sind gegenwärtig die am schnellsten wachsende Materialklasse in der Chemie", berichtet Omar Yaghi von der University of California in Berkeley. Der Chemiker gilt als einer der Pioniere auf diesem Gebiet.
Lange Zeit galten MOFs als zu fragil für einen Einsatz außerhalb des Labors, denn sie fielen häufig in sich zusammen, sobald man die Gasmoleküle entfernte. Viele Forscher bezweifelten deshalb, dass diese Strukturen jemals mit den Zeolithen mithalten könnten. Die Poren dieser stabilen anorganischen Kristalle werden bereits in einer Vielzahl von industriellen Prozessen eingesetzt, wie etwa zur Filtration und Katalyse.
Doch nach mehr als zehn Jahren intensiver Forschung in Laboren auf der ganzen Welt stehen MOFs nun kurz davor, sich erstmals auch in kommerziellen Anwendungen zu bewähren. Obwohl man bei BASF das fragliche MOF nicht nennen möchte, gibt das Unternehmen an, noch in diesem Jahr ein System zur Speicherung von Methan auf den Markt zu bringen, das viel mehr Kraftstoff aufnehmen kann als konventionelle Druckgasbehälter.
Dieser Meilenstein wäre ein Motivationsschub für ihre Arbeit, sagen an MOFs forschende Wissenschaftler. Und möglicherweise würde dadurch auch ein wirtschaftliches Interesse an den vielen anderen Anwendungen geweckt, die bald – oft von anderen Herstellern – folgen werden.
Speicherwettkampf
Ihren wohl größten Aufschwung erlebten MOFs im Jahr 1999, als Forscher zwei ungewöhnlich stabile Typen vorstellten: das an der Hong Kong University of Science and Technology hergestellte HKUST-1 und das von Yaghi entwickelte MOF-5. Letzteres weist pro Gramm eine innere Oberfläche von mindestens 2300 Quadratmetern auf – das entspricht mehr als acht Tennisplätzen. "Das war der Wendepunkt, denn es brach alle Oberflächenrekorde", erinnert sich Yaghi. "BASF dachte, es handle sich um einen Druckfehler, wie sie mir Jahre später berichteten."
Mehr innere Oberfläche bedeutet mehr Platz, um Gastmoleküle unterzubringen. Ulrich Müller, der bei BASF die Forschung an porösen Materialien leitet, erkannte schnell das Potenzial. "Unmittelbar nach Yaghis Publikation begannen wir, an MOFs zu forschen", sagt er. Schnell begann eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Wissenschaftlern, die bis heute fortdauert.
Der Schlüssel zu stabilen MOFs liegt darin, nicht einzelne Ionen als Knotenpunkte zu verwenden, sondern Cluster von Metallatomen. Die Geometrie der Cluster bestimmt dabei die Gesamtarchitektur des Kristalls, der sich durch eine Fülle von organischen Verbindungselementen zusammenhalten lässt. Die wachsende Anzahl von austauschbaren Komponenten macht MOFs viel wandlungsfähiger als Zeolithe – und so können Chemiker Strukturen bauen, deren Poren exakt die richtige Größe und die gewünschten chemischen Eigenschaften für spezifische Anwendungen aufweisen. Inzwischen halten MOFs auch Temperaturen von 500 Grad Celsius stand oder überstehen problemlos eine Woche in siedendem Methanol; andere Vertreter besitzen eine dreimal größere innere Oberfläche als MOF-5 oder enorm geräumige Poren, um auch üppige Proteine aufzunehmen.
BASF beherrscht derzeit den noch jungen MOF-Markt. Der Konzern hat sich die Speicherung von Methan zum Ziel gesetzt, denn Schiefergas ist kostengünstig und zunehmend verfügbar. Mit diesem Erdgas betriebene Autos würden daher geringere Betriebskosten verursachen und zudem weniger CO2 erzeugen als konventionelle Fahrzeuge. Gegenwärtig muss das Erdgas allerdings in sperrigen und teuren Hochdrucktanks gespeichert werden, was viele abschreckt. Mit MOFs ließe sich dieses Problem lösen – sie können bei geringeren Drücken mehr Methan speichern.
Damit dieses Vorhaben gelingt, müssen Größe und chemische Eigenschaften der Poren genau stimmen. Denn sie legen später fest, wie die Methanmoleküle darin eingelagert werden. "Schwebt das Methan in der Pore umher, könnte man genauso gut eine leeren Kanister verwenden", veranschaulicht Yaghi.
Um das Methan in den MOFs zu halten, setzt man Poren mit freiliegenden Metallionen ein. Die Ionen verformen die Elektronenwolke des Methans, die Gasmoleküle werden somit polarisiert und bleiben dadurch am Metall haften. Binden die Poren das Methan allerdings zu schwach, tritt das Gas wieder aus; binden sie es zu stark, lässt sich der Tank schwer entleeren. Kristalle mit Poren, deren Bindungsstärke genau in diesen engen Grenzen liegt, existieren bereits. Die besten unter ihnen weisen bei mittlerem Druck mindestens die doppelte Kapazität eines leeren Tanks auf und geben nahezu das gesamte gespeicherte Methan wieder frei, sobald der Druck abfällt. "Die Speicherung von Methan für Autos ist ein weit gehend gelöstes Problem", bestätigt Yaghi.
Gleichwohl ist ein kommerzieller Erfolg keineswegs sicher. Als der Preis für Rohöl im vergangenen Jahr zu fallen begann, schmälerte das auch den wirtschaftlichen Anreiz, Gas zu nutzen. "Es macht derzeit kaum einen Unterschied", erläutert Müller. "Alles ist ein wenig in Aufruhr deswegen."
Marktbeobachter gehen zwar davon aus, dass sich der Ölpreis früher oder später erholen wird. Doch in der Zwischenzeit, so Jeffrey Long von der University of California in Berkeley, gebe es reichlich Möglichkeiten, die auf MOFs basierenden Speichersysteme für Methan zu verbessern. In Zusammenarbeit mit Yaghi, BASF und dem Autohersteller Ford will er den Druck reduzieren, unter dem sich ein Tank befüllen lässt. "Wenn man auf 35 Bar herunterkommt, können die Leute ihre Autos möglicherweise zu Hause auftanken", sagt er. Long und seinen Kollegen zufolge habe man ein MOF entwickelt, das mehr Methan speichert als die besten aktuell verfügbaren Verbindungen bei niedrigem Druck. "Wir können sie deutlich übertreffen", betont Long. Derzeit bereiten die Forscher eine entsprechende Publikation ihrer Ergebnisse vor.
MOFs könnten allerdings einen noch größeren Beitrag zum Verkehrswesen leisten – durch die Speicherung von Wasserstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge. Denn heruntergekühltes und verdichtetes Gas in Hochdrucktanks zu speichern, ist nicht nur aufwändig, sondern auch teuer. Solche Tanks durch MOFs zu ersetzen, die hinreichende Mengen an Wasserstoff einlagern können, ist allerdings eine große Herausforderung. "Kein Absorber besitzt eine ausreichend hohe Kapazität, um kommerziell genutzt zu werden", so Long.
Longs Team entwickelte ein MOF auf Nickelbasis, das alle bisherigen Rekorde bricht: Die Struktur bindet stark genug an Wasserstoff, um in einem Speichervolumen von einem Liter bei Raumtemperatur und einem Druck von 100 Bar 12,5 Gramm des Gases unterzubringen. Diese Werte liegen dennoch deutlich unter dem vom US Department of Energy ausgerufenen Ziel von 40 Gramm gespeichertem Wasserstoff pro Liter bis zum Jahr 2020. Der Einsatz von MOFs mit Metallionen in ihren Poren, die jeweils an mehrere Wasserstoffmoleküle binden, könnte die Forscher näher an dieses Ziel bringen.
Indes konzentrieren sich andere Forscher lieber auf Nischenanwendungen in der Gasspeicherung. Omar Farha von der Northwestern University in Evanston, US-Bundesstaat Illinois, gründete beispielsweise 2012 zusammen mit Kollegen das Spin-off-Unternehmen NuMat Technologies in Skokie, ebenfalls Illinois. Die hier entwickelten MOFs sollen einige der toxischen Gase sicher speichern können, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden, wie Bortrifluorid, Phosphin und Arsenwasserstoff. "Wir machen etwas anderes als alle anderen", unterstreicht Farha. "Es ist ein kleinerer Markt, auf dem wir sehr schnell Erfolge erzielen können."
Farha zufolge wird das Unternehmen sein erstes Produkt in den kommenden zwei Jahren auf den Markt bringen – möglich wurde das nicht zuletzt durch den Einsatz von Computermodellen, mit denen sich die Eigenschaften von MOFs vorhersagen lassen. Fast 140 000 hypothetische MOFs konnten Farha und seine Kollegen so auf ihr Potenzial zur Methanspeicherung überprüfen. Indem die Forscher nur diejenigen MOFs synthetisieren, die sich in den Computersimulationen als viel versprechend erwiesen, sparen sie nun Zeit und Geld.
Trennung auf Probe
Zudem hoffen Wissenschaftler, mit Hilfe von MOFs bestimmte Moleküle buchstäblich aus der Luft greifen zu können. "Insbesondere bei der Trennung von Gasen könnten diese Materialien einen Wettbewerbsvorteil haben", sagt Long.
Besonders reizvoll dürften sie für industrielle Anlagen sein, in denen Rohöl erhitzt wird, um längere Kohlenwasserstoffketten in leichtere Kohlenwasserstoffe aufzubrechen. Diese Gase lassen sich nur extrem schwer voneinander trennen. Denn Propen und Propan unterscheiden sich lediglich durch zwei Wasserstoffatome, und ihre Siedepunkte liegen nur rund fünf Grad auseinander. Momentan kühlen Raffinerien das Gemisch ab, bis es sich verflüssigt. Anschließend wird es langsam erwärmt, so dass zunächst das eine und dann das andere Gas abdampft. Diese Temperaturwechsel machen das Trennen der beiden Gase zu einem der energieintensivsten Prozesse in der chemischen Industrie.
Ein Kristall namens Fe-MOF-74 vereinfacht den Prozess und macht ihn möglicherweise deutlich kostengünstiger, wies Longs Gruppe nach. Die freiliegenden Metallkationen des Kristalls ziehen die Elektronen eines vorbeifliegenden Propenmoleküls an und bremsen es dadurch ab. Bei Temperaturen von nur 45 Grad Celsius entweicht zunächst das Propan; durch weiteres Erwärmen des MOF wird dann zu 99 Prozent reines Propen freigesetzt. Ein Kristall mit der chemischen Formel Fe2(BDP)3 kann dagegen Hexanisomere effizient voneinander trennen, die sowohl in unverzweigter Form als auch in verschieden verzweigten Formen vorliegen. Die unverzweigten Moleküle bleiben in den Ecken der dreieckigen Kanalstrukturen des MOF hängen – eine solche Architektur ließe sich unmöglich mit Zeolithen erzielen, berichtet Long.
Ein echter Härtetest für MOFs wäre die Abspaltung von Kohlenstoffdioxid aus dem Rauchgas fossil befeuerter Kraftwerke – immerhin blasen diese jährlich rund 13,7 Gigatonnen davon in die Luft. Konventionelle Systeme zur Kohlenstoffabscheidung nutzen Lösungsmittel, die in dem 40 Grad Celsius warmen Abgasstrom mit dem CO2 reagieren. Anschließend muss das Lösungsmittel wieder aus den Emissionen entfernt und auf 120 Grad Celsius oder mehr erhitzt werden, um das CO2 wieder freizusetzen, es dann aufzufangen und schließlich zu lagern. Absenken und Anheben der Temperaturen verschlingt allerdings 20 bis 30 Prozent der in der Anlage produzierten Energie und erfordert zudem eine kostspielige Infrastruktur.
Im März 2015 zeigten Long und sein Team, dass auf Magnesium und Mangan basierende MOFs mehr als zehn Prozent ihres eigenen Gewichts an CO2 aus dem Rauchgas absorbieren könnten – und das mit einem Temperaturwechsel von nur 50 Grad. Die Poren sind hierbei mit Aminmolekülen ausgekleidet, die den momentan zur Abscheidung eingesetzten Lösungsmitteln ähneln und mit dem CO2 zu dicht gepackten Molekülketten aus Ammoniumcarbamat reagieren.
Ein ähnliches, noch nicht öffentlich vorgestelltes MOF kann das gespeicherte CO2 bereits bei unter 100 Grad Celsius wieder abgeben. Long hofft, es am US-amerikanischen National Carbon Capture Center in Wilsonville, US-Bundesstaat Alabama, testen zu können. Da die Struktur leistungsfähiger ist und zudem mit geringeren Temperaturwechseln auskommt als Systeme mit Lösungsmitteln, geht Long davon aus, dass sich die Abscheidungsanlagen kleiner gestalten und sich somit die Infrastrukturkosten senken lassen. Gemeinsam mit anderen gründete der Forscher bereits ein Start-up-Unternehmen – Mosaic Materials in Berkeley –, um solche MOFs zu fertigen.
Kristallschwämme
Ein neues Material in industriellem Maßstab herzustellen, ist ein langwieriger Prozess. Werden allerdings nur geringe Mengen benötigt, ergeben sich schnell Anwendungen. Vor gerade einmal zwei Jahren entwickelte Makoto Fujita von der Universität Tokio ein MOF, mit dem sich die Struktur von Arzneimitteln und weiteren organischen Molekülen bestimmen lässt. Inzwischen wird der Wissenschaftler mit Anfragen von Firmen überhäuft.
Denn viele organische Moleküle wollen keine Kristalle bilden – doch nur in kristalliner Form kann die räumliche Anordnung ihrer Atome exakt vermessen werden: mittels einer Röntgenstrukturanalyse. Fujita und sein Team berichteten 2013, dass ein auf Zink basierendes MOF den von einem Meeresschwamm produzierten Kohlenwasserstoff Miyakosin A aufnehmen und diese Moleküle in seinen Poren sicher einschließen kann, während die Röntgenstrahlen ihre Struktur entlarven.
"Ich dachte damals 'Wow! Auf diese Weise ließe sich die Weiterentwicklung der organischen Chemie revolutionieren", so Phil Baran vom Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien.
Andere zeigten sich dagegen weniger beeindruckt. Kristallografen konnten die beachtlichen Ergebnisse mit den MOFs nicht reproduzieren, und dann entdeckte das Team um Fujita auch noch einen Fehler in der gemessenen Struktur von Miyakosin A - dadurch zweifelten viele an der Technik. Seitdem haben Fujita und weitere Wissenschaftler jedoch detaillierte Anleitungen erstellt und konnten damit auch die Skeptiker überzeugen. Das Verfahren eignet sich zwar nicht für alle Moleküle, doch Fujita schätzt, dass sich bei 20 bis 30 Prozent der von ihnen getesteten organischen Verbindungen der atomare Aufbau bestimmen lässt – wobei es nur fünf Nanogramm des Gastmoleküls bedarf.
Im vergangenen Jahr bewilligte die japanische Wissenschafts- und Technologiebehörde insgesamt 15 Millionen US-Dollar über eine Laufzeit von fünf Jahren, damit Fujita das Verfahren auf den Markt bringen kann. Einige Pharmafirmen setzen die Technik bereits für die Arzneimittelentwicklung ein. Und ein japanisches Chemieunternehmen plant, Fujitas Kristallschwamm – und den momentan in seinem Labor entwickelten Nachfolger – innerhalb der nächsten drei Jahre serienmäßig zu produzieren.
MOFs als Chemiefabrik
Katalyse wird seit Langem als eine der vielversprechendsten Anwendungen für MOFs angepriesen. Die maßgeschneiderten Poren können Reagenzien speichern, bestimmte Bindungen aufspalten und anschließend neue erzeugen, genau wie das aktive Zentrum eines Enzyms.
Doch bis vor wenigen Jahren erzielten Wissenschaftler kaum Fortschritte bei solchen Katalysatoren, berichtet Joseph Hupp von der Northwestern University – nicht zuletzt, weil nur sehr wenige MOFs chemisch stabil genug waren, um mehrere Reaktionszyklen zu überstehen. Folglich, fährt der Chemiker fort, "gibt es derzeit nicht eine einzige Reaktion, bei der MOFs so überlegen wären, dass ein typischer Chemiker einen MOF-basierten Katalysator einem gewöhnlichen Katalysator vorziehen würde".
Inzwischen verwenden Forscher stabile MOFs und optimierten die chemischen Gruppen rings um die Poren, was Erfolg versprechende Katalysatoren hervorbrachte. Und sie gehen sogar noch weiter: Indem nach und nach komplette Verbindungselemente und Metallknoten ausgetauscht werden, lassen sich die chemischen und physikalischen Eigenschaften des MOF ändern, ohne dabei die gesamte Struktur zu zerstören. Diese Fortschritte ermöglichen es Chemikern, eine viel breitere Palette an enorm stabilen, aber dennoch chemisch aktiven MOFs zu entwickeln. "Heute gibt es eine Menge von MOFs, die wir vor fünf Jahren noch nicht herstellen konnten", berichtet Hupp.
Gleichzeitig stellt die überwältigend große Anzahl an MOFs auch eine wachsende Herausforderung dar. "Wir haben zu viele", sagt Yaghi. Hupp stimmt zu. Wissenschaftler sollten ihm zufolge keine MOFs mehr synthetisieren, deren Eigenschaften nie vollständig erforscht werden, sondern sich stattdessen auf die Weiterentwicklung derjenigen konzentrieren, die sich als stabil und aktiv herausstellten.
Zudem müssen MOFs mit etablierten Materialien wie etwa den Zeolithen konkurrieren, was eine weitere Herausforderung ist. Die Kosten niedrig zu halten, ist daher besonders wichtig. MOFs aus reichlich vorhandenen Metallen und preiswerten organischen Verbindungselementen, die sich in sicheren und kostengünstigen Verfahren produzieren lassen, bieten sich daher an. BASF stellt seine MOFs beispielsweise in Wasser statt in anderen Lösungsmitteln her – und das im Tonnenmaßstab.
Bislang bleiben MOFs durch ihre Originalität konkurrenzfähig. So entwickelt Yaghi etwa MOFs, die innerhalb desselben Kristalls verschiedene Porentypen aufweisen. Bewegen sich Moleküle von einer Region zur nächsten, würden sie infolgedessen eine vorgegebene Abfolge von Reaktionen durchlaufen. Solche MOFs könnten als mikroskopische Version einer Chemiefabrik fungieren, in der sich Moleküle – Stück für Stück – in einem fortlaufenden Prozess synthetisieren lassen.
"Das ist unser Traum", sagt Yaghi, "und der lässt sich nur mit MOFs realisieren."
Dieser Artikel erschien unter dem Titel "Materials science: The hole story" in Nature.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.