Epigenetik: Psychotherapie für die Gene?
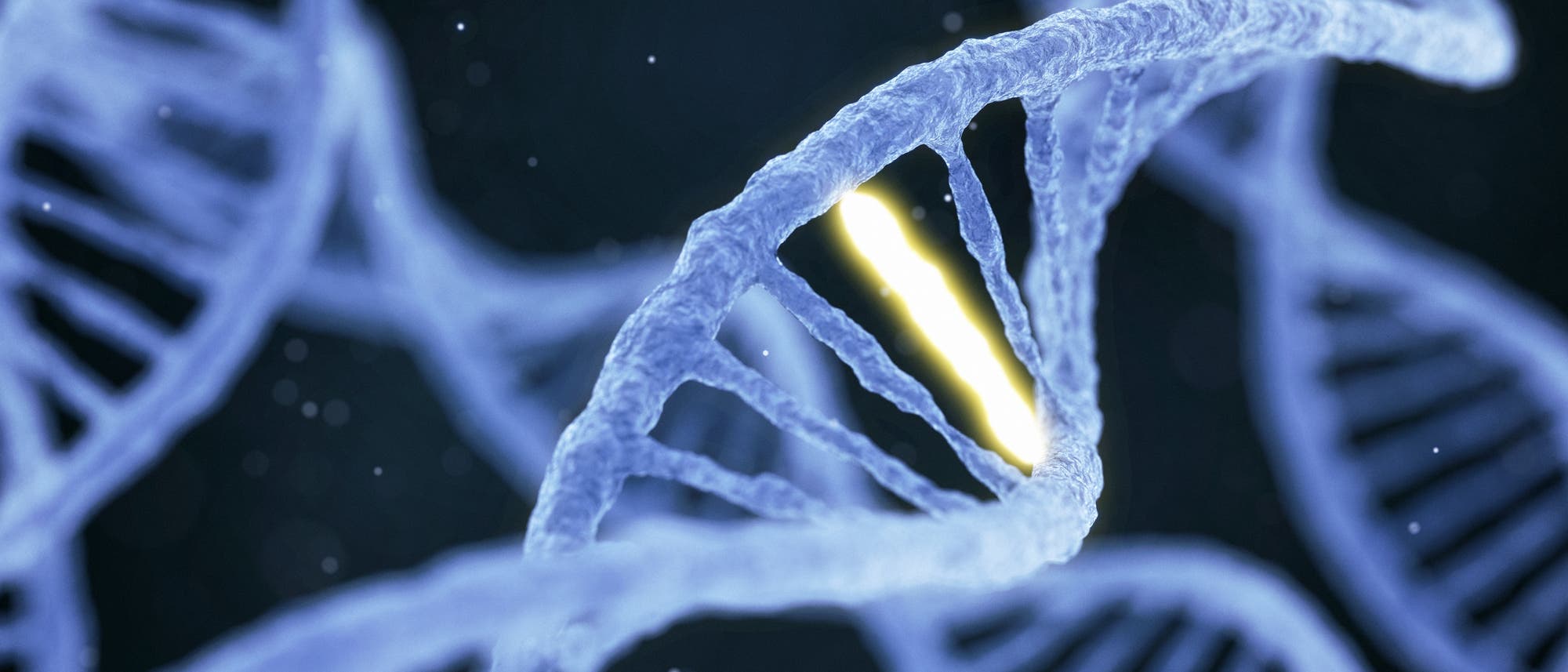
Anja Juchem* erinnert sich gut, wann die Angst sie zum ersten Mal überwältigte. Es war am Pfingstsonntag vor sieben Jahren; sie besichtigte gerade mit Freunden ein Bergwerk. »Da habe ich gespürt, wie ganz unvermittelt etwas in mir hochkroch, ein dunkles Gefühl, wie eine übermächtige Welle«, erzählt die 52-Jährige. Sie hatte sich nie für besonders furchtsam gehalten, doch jetzt hielt sie es im Stollen nicht mehr aus. Und es blieb kein einmaliges Erlebnis. Immer wieder wurde Juchem in den folgenden Wochen von den plötzlichen Attacken heimgesucht. Die Angst schien überall zu lauern und schlug dann ganz unvermutet zu: etwa als sie im Sommer für ein Wochenende ans Meer fuhr, nach De Haan, wo sie in der Kindheit häufig die Ferien verbracht hatte. Auf dem Weg zum Hotelzimmer traf sie die Panik wie ein Schlag. »Ich dachte, ich drehe durch, ich kippe um«, sagt sie. Die Fahrt nach Hause stand sie nur mit Mühe durch. Immer wieder wiederholte sie innerlich das Mantra: »Du schaffst das. Du schaffst das.«
Nach Angaben des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim entwickeln etwa zwei Prozent aller Deutschen im Lauf ihres Lebens eine Panikstörung, darunter gut doppelt so viele Frauen wie Männer. Während einer Attacke stehen die Betroffenen Todesängste aus; sie glauben, einen Herzinfarkt zu erleiden oder ihren Verstand zu verlieren. Aus Furcht vor dem nächsten Anfall trauen sich manche kaum mehr aus den eigenen vier Wänden heraus und ziehen sich vollkommen zurück.
Die Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Man weiß aber, dass Angsterkrankungen familiär gehäuft auftreten – eine Beobachtung, die einen Einfluss der Erbanlagen nahelegt. In dieselbe Richtung deuten Untersuchungen an eineiigen Zwillingspaaren: Wenn ein Zwilling unter einer Panikstörung leidet, ist das Risiko seines (genetisch identischen) Geschwisters, ebenfalls zu erkranken, stark erhöht. Wissenschaftler schätzen den Einfluss des Erbguts auf etwa 50 Prozent. Damit aber eine genetische Veranlagung tatsächlich zu einer Panikstörung führt, müssen meistens noch Umwelteinflüsse hinzukommen. Anja Juchem hatte damals eine schwere Zeit hinter sich, weil ihre Mutter am Herzen erkrankt war. Juchem musste sich um alles kümmern. Sie führte unzählige Arztgespräche, beriet und tröstete die Mutter; gleichzeitig machte sie sich selbst größte Sorgen, was bei der anstehenden Operation alles schiefgehen könnte.
Oft berichten Betroffene, kurz vor ihrer ersten Panikattacke etwas Traumatisches erlebt zu haben: eine schmerzhafte Trennung, den Verlust des Jobs, den Tod eines nahen Angehörigen. Auch wenn eine Depression, Zwangserkrankungen oder andere psychische Störungen entstehen, spielen Gene und Einflüsse von außen zusammen. Weltweit bemühen sich Wissenschaftler derzeit darum, die Basis dieser Interaktion zu entschlüsseln. Ihre Erkenntnisse könnten helfen, den Ausbruch psychischer Leiden zu verhindern und bedeutsame Fragen zu beantworten: Warum werden nur manche Menschen von traumatischen Erfahrungen aus der Bahn geworfen? Wie entfalten Psychotherapien ihre Wirkung? Und weshalb sprechen Patienten so unterschiedlich auf Behandlungen an?
Die DNA und das ganze Drumherum
In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind zunehmend Mechanismen in den Fokus der Forschung gerückt, die man als »epigenetisch« bezeichnet, was so viel wie »zusätzlich zur Genetik« bedeutet. Sie beeinflussen nicht den Inhalt unserer Erbanlagen, also die Gensequenz. Vielmehr sorgt eine Reihe chemischer Schalter dafür, dass manche Gene schwerer abgelesen werden können und andere leichter. Wäre die Gesamtheit unserer Erbinformation – das Genom – ein Klavier, dann gäbe das Epigenom vor, welche der Tasten sich spielen lassen und welche nicht. Und damit auch die Melodien, die der Pianist darauf zum Besten geben kann. Umwelteinflüsse und Erfahrungen können die Schalterstellung mehr oder weniger dauerhaft verändern. Manche hinterlassen eine so tiefe Spur in unserem Epigenom, dass sie wie eine Gravur nur schwer wieder zu entfernen ist.
Im menschlichen Körper gibt es Hunderte von Zelltypen. Jeder von ihnen hat seine individuelle epigenetische Prägung: Schließlich benötigt etwa eine Fettzelle für ihre Funktion andere Gene als eine Herzzelle. Die zelltypspezifischen Schalterstellungen sorgen dafür, dass in jeder Körperzelle die passenden Erbanlagen aktiv sind; wäre dem nicht so, würde unser Organismus nicht funktionieren. Andere Voreinstellungen scheinen flexibler und können sich dynamisch in Abhängigkeit von Umweltreizen ändern. Wer sich beispielsweise über längere Zeit kalorienreich ernährt oder im Gegenteil hungert, bei dem werden bestimmte epigenetische Schalter in den Fett- und Immunzellen umgelegt.
»Wir haben uns immer gefragt, wie die Umwelt eigentlich mit unseren Genen spricht«
Katharina Domschke, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Freiburg
Grundsätzlich sichert die epigenetische Anpassungsfähigkeit dem Organismus das Überleben. Aber sie kann auch negative Auswirkungen haben: Traumata, chronischer Stress oder bestimmte Drogen können das Epigenom so verändern, dass sich dadurch möglicherweise die Anfälligkeit für Depressionen, Zwangserkrankungen oder eben eine Panikstörung erhöht. »Wir haben uns immer gefragt, wie die Umwelt eigentlich mit unseren Genen spricht«, erklärt Katharina Domschke, die in Freiburg die Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie leitet. »Die Epigenetik scheint an dieser Stelle die Rolle des Dolmetschers zu übernehmen und kann so beeinflussen, ob jemand erkrankt oder nicht.«
Diese These begann die Wissenschaftlerin bereits vor einigen Jahren durch Studien an Patienten mit einer Panikstörung zu untermauern. Im Visier hatte ihr Team das Gen für die Monoaminoxidase A. Das Enzym (abgekürzt: MAOA) ist am Abbau bestimmter Hirnbotenstoffe beteiligt, etwa Serotonin, das unter anderem Angstzustände dämpft. Sinkt der Serotoninspiegel, kann es zu Panikattacken kommen. Domschkes Arbeitsgruppe schaute sich nun bei den Versuchspersonen ganz bestimmte Bereiche des MAOA-Gens genau an. Üblicherweise »kleben« an diesen Stellen zahlreiche so genannte Methylreste (chemische Formel: -CH3). Diese fehlten bei den Erkrankten jedoch zum Teil. Wissenschaftler sprechen von einer Hypomethylierung (»hypo« bedeutet »unter«, in diesem Fall also »unter dem Normalwert«). An diesen speziellen Genpositionen hat das Fehlen der Methylgruppen zur Folge, dass die betreffende Erbanlage leichter abgelesen werden kann. Die Betroffenen bildeten also vermutlich mehr MAOA, mit der Folge eines Serotoninmangels, was wiederum die Panikstörung befördern könnte. Dabei war die Hypomethylierung umso stärker ausgeprägt, je mehr negative Lebensereignisse die Patientinnen in den vergangenen sechs Monaten durchgemacht hatten.
In einer anderen Studie der Forscher absolvierten 28 Patientinnen zudem eine sechswöchige Verhaltenstherapie. Bei knapp der Hälfte von ihnen verringerten sich die Symptome daraufhin deutlich. Nach der Behandlung unterschied sich ihr MAOA-Gen in epigenetischer Hinsicht nicht mehr von dem gesunder Frauen. »Wir haben also erste Hinweise darauf, dass eine erfolgreiche Psychotherapie die Hypomethylierung womöglich rückgängig machen kann«, resümiert die Freiburger Professorin. Anders sah es dagegen bei den Patientinnen aus, die nicht auf die Behandlung angesprochen hatten: Bei ihnen blieb die schädliche epigenetische Schalterstellung bestehen.
Allerdings ist die Aussagekraft der Ergebnisse begrenzt, vor allem auf Grund der geringen Fallzahl. Zwar haben auch andere Forscher beobachtet, dass eine erfolgreiche Psychotherapie mit epigenetischen Änderungen bei relevanten Genen für Angst-, Borderline- und Posttraumatischer Belastungsstörung einhergeht. Aber noch lassen sich die Studien zu solchen Effekten an einer Hand abzählen.
Wenn Kortisol Stress macht
Erst in Ansätzen geklärt ist zudem die Frage, auf welchem molekularen Weg Ereignisse wie Traumata oder eine Verhaltenstherapie die Methylierung beeinflussen könnten. Elisabeth Binder, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, hat 2018 in der Zeitschrift »Biological Psychiatry« einen möglichen Mechanismus für ein Gen namens FKBP5 vorgestellt, das ebenfalls mit einer Reihe unterschiedlicher psychischer Störungen in Verbindung gebracht wird. FKBP5 beeinflusst, wie wir auf Stress reagieren. Bei aktueller Gefahr schüttet unsere Nebennierenrinde Kortisol aus. Eine eingebaute Bremse sorgt dafür, dass unser Körper nicht permanent mit dem Stresshormon geflutet wird, sondern sich schnell wieder »beruhigt«.
Aber: Je aktiver FKBP5, desto schwächer ist diese Bremse. Traumatische Ereignisse in der frühen Kindheit können die fein abgestimmte Regulation offenbar aus dem Ruder laufen lassen. Denn Studien zeigen, dass bei einem Teil der misshandelten Kinder das FKBP5-Gen an bestimmten Positionen schwächer methyliert ist, wodurch es vermutlich dauerhaft überaktiv ist. Bei den Betroffenen sorgt das für eine lang andauernde Stressantwort. Und die erhöht wiederum das Risiko, eine Angsterkrankung oder Depression zu entwickeln.
Die Macht des Epigenoms
Histonmodifikationen, DNA-Methylierung und miRNA (microRNA) stellen epigenetische Modifikationen dar, die in ihrer Gesamtheit (»Epigenom«) die Aktivität der Gene regulieren. So ist die Desoxyribonukleinsäure (DNA) perlschnurartig und mehr oder weniger eng um bestimmte Proteine gewickelt, die Histone. In sehr dicht gepackten Bereichen kann die DNA nicht abgelesen werden, die hier liegenden Erbanlagen sind inaktiv. Molekülteile an den Histonen verändern die Dichte und damit, inwieweit die Gene zugänglich sind. Zudem verhindern mit der DNA verknüpfte Methylgruppen an bestimmten Stellen, dass der Ablesevorgang startet. Aber auch bereits abgelesene Gene müssen sich nicht unbedingt auswirken – nämlich, wenn miRNA an die Boten-RNA (mRNA) bindet, die die Information für das herzustellende Protein enthält. Dadurch blockiert sie die Proteinsynthese oder bewirkt sogar einen schnellen Abbau der Boten-RNA.
Ausgelöst wird die Hypomethylierung von FKBP5 möglicherweise durch Stress in frühester Kindheit, und zwar durch Kortisol selbst. Elisabeth Binder und ihr Fachkollege Torsten Klengel haben diesen Zusammenhang vor einigen Jahren an menschlichen Hirnzell-Vorläufern untersucht: Wenn sie dem Nährmedium der Zellkulturen das Stresshormon zugaben, verlor FKBP5 in den Zellen einen Teil der Methylgruppen.
Erstaunlicherweise haben Traumata bei Erwachsenen nach derzeitigem Kenntnisstand kaum mehr Einfluss auf die Methylierung von FKBP5. »Bis ins Letzte geklärt sind diese Zusammenhänge noch nicht«, sagt Angelika Erhardt, Angstforscherin vom Münchner Max-Planck-Institut. »Es gibt offensichtlich besonders vulnerable Phasen in der frühen Kindheit oder später in der Pubertät, in denen Stress deutlich stärkere Auswirkungen auf molekularer Ebene hat.«
Hinzu kommen weitere Faktoren, die das Krankheitsrisiko beeinflussen und die Ursachenforschung noch ein Stück komplizierter machen. So spielt neben der epigenetischen Gravur natürlich die Erbinformation selbst eine Rolle. Sowohl bei FKBP5 als auch beim MAOA-Gen gibt es etwa verschiedene Varianten, die schon per se deutlich aktiver sind – ohne jeden epigenetischen Einfluss. Wenn diese »Risikogene« durch Hypomethylierung noch stärker aktiviert werden, wird es brenzlig. »Bei der Monoaminoxidase A sehen wir dieses Zusammenspiel sehr deutlich«, erklärt die Freiburger Wissenschaftlerin Katharina Domschke. »Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir das doppelt aktivierte MAOA-Gen zunächst pharmakologisch hemmen müssen, bevor die Patientinnen überhaupt auf eine Psychotherapie ansprechen können.«
Die Zahl der Befunde, die einen Zusammenhang zwischen Epigenetik und psychischen Erkrankungen nahelegen, wächst und damit auch die Hoffnung, die Erkenntnisse klinisch nutzbar zu machen. »Wenn wir etwa mit molekularen Markern testen können, ob das Stresssystem durch frühkindliche Umwelteinflüsse in seiner Funktionalität verändert wurde, dann können wir eventuell präventiv eingreifen, noch bevor es zum Ausbruch einer psychischen Erkrankung kommt«, erklärt Max-Planck-Forscherin Angelika Erhardt. Gibt es womöglich irgendwann eine Art Bluttest, der anzeigt, für wen Präventionsmaßnahmen besonders wichtig wären? »Das ist noch Zukunftsmusik«, betont Erhardt. Eher wäre es möglich, auf Basis der Forschungsergebnisse die Therapie von Patienten individueller zu gestalten. »Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass Betroffene mit einem spezifischen Methylierungsprofil nicht so gut auf bestimmte Formen der Behandlung ansprechen«, sagt sie. »In solchen Fällen könnte man also die epigenetische Information für die Wahl der erfolgversprechendsten Therapieform nutzen.«
Etwa bei der Depression: Medizinern steht heute ein ganzes Arsenal verschiedener Pharmaka zur Verfügung, um die Erkrankung zu behandeln. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in den Hirnstoffwechsel eingreifen und so die Konzentration wichtiger Botenstoffe wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Jedoch tun sie das auf verschiedenen Wegen und funktionieren dabei nicht bei allen Betroffenen gleich gut. Viele Patienten finden erst nach etlichen Fehlversuchen ein Präparat, das ihnen hilft. Ein zermürbender Prozess, zumal es ohnehin oft einige Wochen dauert, bis sich herausstellt, ob ein bestimmtes Antidepressivum anschlägt. Der Grund: Das Gehirn muss sich zunächst anpassen.
Das gilt etwa für die so genannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer SRI (das Kürzel steht für »serotonin reuptake inhibitor«). Serotonin wird von bestimmten Nervenzellen an den Synapsen ausgeschüttet, und es wirkt nicht nur angstlösend, sondern auch stimmungsaufhellend. SRI verhindern, dass der Botenstoff nach der Freisetzung zu rasch wieder in die abgebende Nervenzelle zurücktransportiert wird. Somit sollte mehr Serotonin bei den Empfängerzellen ankommen und dadurch eine stärkere Wirkung entfalten. Doch so leicht lassen sich die Nervenzellen nicht überlisten. Denn die Serotonin produzierenden Zellen tragen selbst einen Serotonin-Fühler. Erhöht sich durch die SRI im synaptischen Spalt die Menge des Glückshormons, drosseln sie die Neuproduktion des Transmitters einfach. SRI mögen also verhindern, dass Serotonin zurück in die Zelle geschafft wird. Gleichzeitig bremsen sie aber seine Ausschüttung, was den Effekt konterkariert.
»Es gibt offensichtlich besonders vulnerable Phasen in der frühen Kindheit oder später in der Pubertät, in denen Stress deutlich stärkere Auswirkungen auf molekularer Ebene hat«
Angelika Erhardt, Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München
Allerdings – und hier kommt die Epigenetik ins Spiel – verliert der Fühler normalerweise nach ein paar Tagen an Empfindlichkeit. Erst jetzt beginnt das Medikament tatsächlich zu wirken. Studien zufolge scheinen bei manchen Patienten jedoch bestimmte epigenetische Schalter zu verhindern, dass der Serotoninrezeptor abstumpft. Die Betroffenen sprechen daher auf die SRI-Behandlung nicht an. Wüsste man vorher von ihrer epigenetischen Voreinstellung, würde man gleich ein anderes Medikament wählen.
Viele dieser Ergebnisse zur Epigenetik sind noch mit Vorsicht zu genießen. Zu jung ist das Forschungsfeld, zu klein sind die Stichproben vieler Studien, zu komplex die Krankheiten, um die es geht. »Psychische Störungen haben nie eine einzige Ursache«, betont Angelika Erhardt. »Ob wir erkranken oder nicht, hängt von der Kombination aus vielen Risiko- und schützenden Genen plus ihrer Epigenetik ab. Und dieses Puzzle ist noch nicht vollständig zusammengesetzt, so interessant die Einzelbefunde auch sein mögen.«
Fragezeichen und Streitpunkte
Hinzu kommen methodische Unzulänglichkeiten. In der Regel können Forscher epigenetische Modifikationen im Gehirn etwa nach frühkindlichem Trauma nur im Tiermodell oder an verstorbenen Menschen nachweisen. Bei lebenden Personen weichen sie oft auf Blutproben aus. Es gibt zwar Grund zur Annahme, dass man aus der Methylierung in Blutzellen teilweise auf jene in Hirnzellen rückschließen kann. Und was MAOA betrifft, belegten US-amerikanische Neuroforscher um Elena Shumay mit Hirnscans sogar: Je stärker das Gen in Blutzellen methyliert ist, desto weniger zugehöriges Enzym findet sich im Gehirn von Probanden. Dennoch stellt die Messung epigenetischer Marker im Blut einen gewichtigen Vorbehalt dar, der bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden muss, betont Katharina Domschke. In vielen Fällen ist zudem noch nicht bewiesen, ob die betrachteten Methylierungen die Aktivität des betreffenden Gens wirklich beeinflussen.
So aufregend die Ergebnisse sind, es bleiben noch sehr viele Fragezeichen. Etwa: Können epigenetische Veränderungen von Mutter oder Vater auf die Kinder vererbt werden? Manche Forscher haben beobachtet, dass sich ein Trauma noch bis in die Enkelgeneration auswirken kann – und machen dafür eine Weitergabe der epigenetischen Gravur an die Nachkommen verantwortlich. Nach heutigem Kenntnisstand wird aber bei Säugetieren der größte Teil der Markierungen in den Ei- und Samenzellen erst einmal auf die »Werkseinstellung« zurückgesetzt. Ob es eine generationenübergreifende epigenetische Vererbung beim Menschen gibt, ist daher unter Experten höchst umstritten.
Epigenetik bei psychischen Störungen
Obwohl jede Zelle eines Organismus dieselbe Erbinformation (Nukleotidsequenz) enthält, werden je nach Zelltyp und Umweltsituation nur bestimmte Gene aktiv. Geregelt wird die Genaktivität zum Teil durch »epigenetische« Faktoren wie Methylgruppen an der DNA. Sitzen sie an bestimmten Stellen, verhindern die Anhängsel, dass der Ablesevorgang startet. Wird ein Risikogen derart »stumm« geschaltet, wirkt es sich nicht negativ aus. Diese epigenetische Prägung ist relativ stabil und bleibt bei der Zellteilung innerhalb des Gewebes erhalten. Umwelteinflüsse wie Ernährung oder Traumata können sie jedoch verändern und im schlimmsten Fall Erkrankungen fördern. Umgekehrt vermögen laut Studien geeignete therapeutische Interventionen das gesunde Methylierungsmuster wiederherzustellen.
Iris Kolassa, Leiterin der Abteilung Klinische und Biologische Psychologie der Universität Ulm, hat 2019 eine Studie zur Frage der Vererbbarkeit epigenetischer Prägungen vorgelegt. Das Team hatte schwangere Frauen untersucht, die als Kind misshandelt worden waren. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe war bei ihnen das FKBP5-Gen in Blutzellen hypomethyliert. Jedoch fand sich das epigenetische Muster der Mütter bei den Neugeborenen nicht wieder. »Für mich ist die Frage nach dem epigenetischen Beitrag zu psychischen Störungen insgesamt noch nicht abschließend beantwortet«, sagt Kolassa. Traumatische Belastungen wirkten auf vielen Ebenen: »Die Epigenetik ist nur eine davon.«
Anja Juchem hat ihre Panikattacken inzwischen überwunden. Bei einer Therapeutin für »Somatic Experiencing« lernte sie, ihre Gedanken von ihren körperlichen Empfindungen während des Anfalls zu trennen. »Dadurch habe ich gemerkt, dass die Angstgefühle immer zuerst da waren«, sagt sie. »Mein Kopf hat dann dazu die passende Geschichte erfunden, den Grund für meine Panik.« Diese Einsicht half ihr, sich vor Augen zu führen, wie wenig bedrohlich die Situation in Wirklichkeit war. Schon nach ein paar Sitzungen ging es ihr deutlich besser; einige Monate später verschwanden die Angstanfälle – so plötzlich, wie sie gekommen waren.
* Name von der Redaktion geändert
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.