Zukunftstechnologie: Quantensprünge
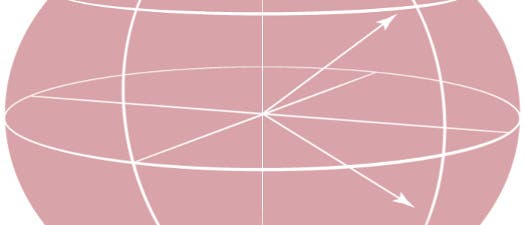
Im Juli 2012 entdeckten Physiker – womöglich – das lange gesuchte Higgs-Boson: ihr größter Fund seit Jahrzehnten und ein Grund zum Stolz für die vielen beteiligten Wissenschaftler. Genau genommen war ihnen allerdings schon jemand zuvorgekommen.
Monate zuvor hatten neun Physiker eine dünne Schwade aus Rubidium-87-Atomen nahezu auf den absoluten Temperaturnullpunkt abgekühlt und Laser benutzt, um die Atome in einem winzigen Gitter anzuordnen. Anschließend stellte das Team die Temperatur gerade so ein, dass sich die Atome einem kritischen Phasenübergang näherten – einem Punkt zwischen zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie etwa zwischen flüssigem Wasser und festem Eis. Während des Phasenwechsels beobachteten die Forscher eine ungewöhnliche Energiewelle im Gitter, die für einen kurzen Moment auftauchte und dann wieder verschwand [1]. Mathematisch betrachtet entspricht dieses Verhalten dem Entstehen und dem Zerfall eines Higgs-Teilchens in einem Teilchenbeschleuniger.
"Natürlich handelt es sich dabei keineswegs um das Higgs-Teilchen", erklärt Immanuel Bloch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, der das Experiment leitete. Nicht zuletzt wandelt dieses Teilchen nur in zwei Dimensionen umher, während sich das Higgs in drei Dimensionen bewegt. Dennoch sei der Versuch hilfreich für Teilchenphysiker, sagt Bloch. Denn er eröffne ihnen einen neuen Weg, um die komplexen Quantenfeldtheorien, die dem Higgs zu Grunde liegen, zu erforschen und zu testen.
Mit diesem Experiment sind Bloch und seine Kollegen führend auf dem Gebiet der Quantensimulation – einem Feld, das sich rasant entwickelt. Die Idee besteht grob gesagt darin, geordnete Systeme wie ein Atomgitter zu nutzen, um deutlich komplexere Dinge nachzuahmen, beispielsweise neue Teilchen oder Hochtemperatursupraleiter. Das Verhalten solcher Systeme lässt sich nicht ohne Weiteres ableiten, und selbst der weltweit schnellste Supercomputer kann es nicht modellieren.
Quantensimulatoren sind gewissermaßen die kleineren Geschwister von Quantencomputern. Letztere werden seit mehr als drei Jahrzehnten als Rechner der Zukunft angepriesen, die alles von komplexen Simulationen bis hin zum Knacken von Verschlüsselungen leisten können. Sowohl Quantensimulatoren als auch Quantencomputer funktionieren nach den Regeln der Quantenmechanik. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrer Rechenleistung: Quantencomputer sind universell einsetzbare Geräte, die jeden denkbaren Algorithmus ausführen können, während Quantensimulatoren speziell auf jedes vorliegende Problem zugeschnitten werden müssen. Heutige Simulatoren lassen sich zudem schwer kontrollieren und können unter Umständen nicht jedes Problem lösen. Allerdings gestaltet sich der Bau von Quantensimulatoren deutlich einfacher als der von Quantencomputern. Und die Geräte, so sagen Wissenschaftler, könnten bald zumindest einige der Quantenprobleme lösen, die sich nicht auf andere Weise angehen lassen.
Das A und O
Die Welt der Quantenphysik ist voller Theoreme – und eines davon ist ungeschrieben: Möchte ein Forscher beachtet werden, so muss er nur zeigen, dass seine Idee von Richard Feynman stammt. Feynman gilt als der größte theoretische Physiker in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Idee eines Quantensimulators entstand 1981, als man ihn für einen Vortrag am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge eingeladen hatte [2]. Feynman sprach darüber, wie sich die Physik mit Computern simulieren ließe, und kam direkt zum Kern des Problems: Gewöhnliche Computer funktionieren deterministisch, sind also absolut berechenbar. Doch die Natur handelt auf grundlegender Ebene mit Wahrscheinlichkeiten. Nach den Gesetzen der Quantenmechanik, wusste Feynman, befinden sich Quantenteilchen nur selten entweder in einem oder in einem anderen Zustand. Stattdessen existieren sie in einer "Superposition" der beiden Zustände, befinden sich also gleichzeitig in beiden. Beobachtet man die Teilchen, löst sich dieses Paradoxon gemäß den Gesetzen der Statistik auf. So dürfte der Spin eines Elektrons in der Hälfte der Zeit in eine Richtung zeigen und in der anderen Hälfte in die entgegengesetzte Richtung.
Einen herkömmlichen Computer derart zu programmieren, dass er das probabilistische Verhalten dieses einen Elektrons modelliert, sei nicht schwer, sagte Feynman. Nur leben solche Teilchen nicht isoliert, und in Quantensystemen sind ihre Wahrscheinlichkeiten miteinander verbunden oder "korreliert". Wegen dieser Korrelationen muss jede Kombination von Teilchenzuständen einzeln berechnet werden, und das lässt die Komplexität des Problems exponentiell ansteigen. Während ein System aus drei Elektronen acht mögliche Kombinationen von Zuständen aufweist und damit nur acht Wahrscheinlichkeiten zu berechnen sind, bieten 300 dieser Elementarteilchen bereits so viele Kombinationen, wie es Atome im bekannten Universum gibt.
In seiner Vorlesung suchte Feynman nach einem Ausweg aus dieser verfahrenen Situation. Mit gewöhnlichen Rechnern gestalte sich das schwierig, folgerte er, doch es gäbe eine andere Möglichkeit: Man müsse einen Computer entwickeln, der selbst mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Dieser Quanten-Imitator, wie er es nannte, würde jedem beliebigen System, das man damit modellieren möchte, ähneln. Auf diese Weise könnte man einfach die Palette an Wahrscheinlichkeiten nachbilden, anstatt jedes Ergebnis einzeln zu berechnen. Der Imitator gibt also nicht nur eine Lösung aus, sondern liefert viele – und die Wahrscheinlichkeit einer jeden Antwort formt schließlich ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Bild über das Verhalten des komplexen Systems. Ohne selbst Berechnungen anzustellen, kam Feynman zu dem Schluss, dass sich mit einem Gitter aus Spins und anderen Dingen nahezu alle Quantensysteme auf jede Weise simulieren lassen.
Zu jener Zeit gab es die kleinen Gitter, von denen Feynman in seinem Vortrag sprach, noch nicht. Tatsächlich dauerte es 30 Jahre, bis man die erforderliche Technologie entwickelt hatte. Denn Quantensysteme sind äußerst fragil: Nahezu jede Wechselwirkung mit der Außenwelt zerstört die empfindlichen Korrelationen. Um die Simulation störungsfrei beenden zu können, müssen die Teilchen deshalb ausreichend von ihrer Umwelt isoliert werden. Gleichzeitig muss das System interaktiv genug sein, damit die Physiker die Lösung extrahieren können. Inzwischen existieren dafür mehrere Ansätze. Blochs Gruppe nutzt neutrale Atome, andere Teams kombinieren elektrische und magnetische Felder mit Lasern, um leichtere Ionen wie Beryllium einzufangen. Bei einem dritten Verfahren werden Wirbelströme innerhalb supraleitender Mikroschaltungen kontrolliert, und ein viertes verwendet Photonen in mikroskopischen Wellenleitern (siehe "Quantenbrettspiele").
In nur kurzer Zeit machten diese Techniken große Fortschritte. Im April stellte eine Gruppe um John Bollinger vom National Institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado, ein zweidimensionales System aus Hunderten von gefangenen Ionen vor, mit dem sich eine Form von Quantenmagnetismus simulieren ließ [3]. Der Simulator scheint gut für schwache Felder zu funktionieren, wie man sie bereits auf klassischen Computern modellieren kann, sagt Bollinger. Nach einigen Modifikationen hofft er auch starke magnetische Felder simulieren zu können – selbst für die leistungsstärksten Supercomputer eine unlösbare Aufgabe.
Bloch befasst sich mittlerweile mit weiteren Einsatzfeldern für seinen Simulator, abseits des Higgs-Teilchens. Zum Beispiel könnten die neutralen Rubidiumatome im Gitter genutzt werden, um Hochtemperatursupraleiter zu modellieren. Genau wie konventionelle Supraleiter leitet diese komplexe Materialklasse Elektronen ohne Widerstand, allerdings bei wesentlich höheren Temperaturen. Warum das so ist, versteht seit Jahrzehnten allerdings niemand. Theoretiker entwickelten zwar eine Reihe von konkurrierenden Modellen, um das Verhalten zu erklären. Doch waren sie bisher nicht in der Lage, diese auch zu testen: Die Elektronen im Supraleiter lassen sich nicht einfach isolieren und untersuchen. Bloch will deshalb Atome an Stelle der Elektronen verwenden. Indem er die Intensität von gekreuzten Laserstrahlen verändert, können die Atome dazu gebracht werden, von einem Punkt im Gitter zu einem anderen zu tunneln. Auf diese Weise lässt sich die Bewegung von Elektronen durch das Atomgitter eines Hochtemperatursupraleiters nachahmen. Immerhin einige Theorien sollten mit diesem Experiment überprüfbar werden.
Quantensimulatoren könnten auch Phänomene außerhalb der Quantenwelt modellieren, wie beispielsweise die Proteinfaltung. Um solche Fragestellungen zu bearbeiten, braucht es nämlich extrem große Mengen an Rechenleistung. Eine Forschergruppe von der kanadischen Firma D-Wave Systems in Burnaby und von der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, machte einen ersten Schritt in diese Richtung: Sie übertrugen das Proteinfaltungsproblem vor Kurzem auf ein Quantensystem aus 128 Stromschleifen in einem supraleitenden Chip [4]. Jede Schleife konnte sich im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen, oder aber sie befand sich in einer Überlagerung der beiden Richtungen. Die Erfolgsquote des Systems war nicht besonders gut: Bei einem der Proteinfaltungsprobleme lieferte es nur in 13 von 10 000 Fällen die richtige, experimentell bestimmte Antwort. Dennoch hält es der theoretische Chemiker und Koautor des Papers Alan Aspuru-Guzik von der Harvard University für bemerkenswert, dass es überhaupt gelang.
Zielwechsel
Trotz aller technischen Fortschritte handelt es bei den gegenwärtigen Simulatoren im besten Fall um eine begrenzte Annäherung an die ursprüngliche Vision von Feynman – einen vollwertigen Quantencomputer, der "universell" einsetzbar ist, also jeden Quantenalgorithmus ausführen und alle denkbaren Quantensysteme simulieren kann. Seitdem Feynman einen solchen Rechner erstmals beschrieb, erforschen Wissenschaftler dessen Einsatzmöglichkeiten. Die wohl wichtigste stammt aus dem Jahr 1994: Der Mathematiker Peter Shor, derzeit am MIT, legte einen Algorithmus vor, mit dem ein Quantencomputer effizient Verschlüsselungen knacken könnte [5]. Es folgten weitere Quantenalgorithmen, woraufhin sich viele Wissenschaftler (und etliche Nachrichtendienste) mit der Quanteninformationsverarbeitung beschäftigten und viel Aufwand betrieben, um einen solchen Apparat zu bauen.
Doch die Entwicklung eines leistungsstarken, universellen Quantencomputers erwies sich als schwierige Aufgabe. Während ein echter Feynman-Computer in der Lage wäre, Tausende oder Millionen von Atomen auf einmal zu kontrollieren, müssen die meisten heutigen Systeme einen Kompromiss zwischen Atomanzahl und Kontrollierbarkeit machen. So kann Bloch zwar Hunderttausende von Atomen in seinem Lasergitter halten, doch lassen sich deren Quantenzustände dann nicht individuell einstellen. Andere Forscher haben dagegen mehr Kontrolle über einzelne Teilchen, aber mit ihren Systemen – bestehend aus eingefangenen Berylliumionen – lassen sich nur wenige Atome mit ausgezeichneter Präzision handhaben. Ein weiteres Problem stellen Wechselwirkungen mit der Außenwelt dar: Selbst die kleinste Störung kann die empfindlichen Quantenzustände ruinieren und einen Rechenfehler hervorrufen.
Da die aktuellen Systeme noch so weit vom Ideal entfernt sind, sehen Wissenschaftler den Quantensimulator inzwischen weniger als Sprungbrett denn als Ziel mit eigener Berechtigung an. Zum einen müssen Simulatoren nicht so groß sein wie Computer, und zum anderen ist die Lösung in allen Atomen darin kodiert, wodurch sie unempfindlicher gegenüber äußeren Störungen sein sollten. "In einem Quantencomputer müssen Sie sicherstellen, dass keines der Teilchen einen Fehler macht", sagt Ignacio Cirac vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik. "Wenn dagegen in einer Quantensimulation eines von 100 Teilchen falsch liegt, dann liegen 99 noch richtig."
Manche sehen Parallelen zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als Wissenschaftler wie Vannevar Bush mit "analogen" Computern aus Widerständen und Kondensatoren experimentierten. Die Geräte wurden jeweils für ein spezifisches Problem oder aber eine Klasse von Problemen konstruiert und führten mit einem Eingangssignal einen einfachen Satz von Operationen durch. Einige dieser Computer waren sogar in der Lage, mathematische Berechnungen durchzuführen. Im Vergleich zu digitalen Computern erscheinen sie rückblickend allerdings kläglich. Die modernen Rechner verwenden programmierbare Kombinationen von Transistoren, um praktisch jedes Programm auszuführen. Dennoch waren die analogen Gegenstücke schnell, robust und nützlich für Anwendungen, die auf ihre Architektur abgestimmt waren, sagt Seth Lloyd vom MIT. Sie eigneten sich zum Beispiel besonders gut dafür, Maschinen zu steuern. "Alle Regelkreise in der Saturnmondrakete waren analog", so der theoretische Physiker und Ingenieur.
Quantensimulatoren werden wie auch analoge Computer durch ihre Bestandteile bestimmt und sind weniger anpassungsfähig als echte Quantencomputer. Dennoch glaubt Lloyd, dass man sie im Bereich der Quantenkomplexität erfolgreich einsetzen könnte. Weil Mikroprozessoren immer weiter schrumpfen und man neue Materialien auf molekularer Ebene entwickelt, gewinnen Quanteneffekte zum Beispiel mehr und mehr an Bedeutung. Das wiederum führt zu einem stark wachsenden Bedarf an quantenmechanischen Modellen, mit denen die Entwickler das Materialverhalten verstehen und vorhersagen können. Zumindest einige dieser Bedürfnisse werden Quantensimulatoren erfüllen, prognostiziert Lloyd. "Vermutlich werden Quantensimulatoren unterschiedliche Spezialfälle bearbeiten", sagt er, "und die Zahl dieser Fälle scheint ziemlich schnell anzuwachsen."
Aspuru-Guzik hat einen solchen Fall bereits im Sinn: die Fotosynthese. Wenn Licht auf ein Blatt fällt, erzeugt es ein Paar aus negativen und positiven Ladungen. Diese legen lange Wege zu den Reaktionszentren zurück, wo sie schließlich zur Energiegewinnung für die Pflanze genutzt werden. Die Ladungspaare reisen womöglich nach den Regeln der Quantenmechanik: Einige Forscher glauben, dass die kollektive Wellenfunktion der Paare sich über die Licht absorbierenden Chromophormoleküle im Blatt ausbreitet, so dass sich die Paare effizienter bewegen, als sie es auf klassische Weise könnten [6].Mit einem Simulator ließe sich genau nachvollziehen, vermuten Aspuru-Guzik und andere Forscher, wie dies vonstattengeht. Aspuru-Guzik nennt die Fotosynthese ein "unreines Quantensystem" – es enthält sowohl Quanten- als auch klassische Komponenten. Eine kleine Matrix aus supraleitenden Stromschleifen eigne sich vielleicht perfekt als Modell, erzählt er. Denn auch die Schleifen unterliegen den Störeinflüssen der Außenwelt. Doch nach wie vor wäre es kein einfaches Unterfangen: Aspuru-Guzik schätzt, dass man Hunderte von Quantenbits braucht, um etwas wie die Fotosynthese zu simulieren. Und derartige Systeme, prophezeit er, liegen mindestens ein Jahrzehnt entfernt.
Wissenschaftler haben sich zunächst deutlich bescheidenere Ziele gesteckt. Die meisten von ihnen gehen von Modellen aus, die sich auch mit herkömmlichen Supercomputern berechnen lassen. Auf diese Weise können sie prüfen, ob die entwickelten Quantensimulatoren zuverlässige Ergebnisse liefern. Allmählich wollen sie ihre Atome, Stromschleifen oder anderen winzige Einheiten dann bis zu dem Punkt vorantreiben, an dem Supercomputer überfordert sind.
An diesem Punkt "entspricht das Modell, das wir implementieren können, vielleicht keinem realen Material mehr", sagt Chris Monroe von der University of Maryland in College Park. Selbst wenn sie sich nicht wie ein Supraleiter oder ein Higgs-Teilchen verhalten, verraten die neuen Systeme den Forschern möglicherweise dennoch ein oder zwei Dinge, die ihre älteren Rechner nicht hätten ausspucken können. Je nach Problem, glauben Monroe und Kollegen, werden die Simulatoren schließlich maßgeschneidert werden. Kalte Atome könnten sich beispielsweise am besten für Supraleiter eignen, während sich mit Ionen magnetische Phänomene nachahmen lassen. Natürlich wird es trotzdem Quantensysteme geben, die zu schwierig und für keinen Versuchsaufbau zu bewältigen sind.
Auch wenn diese Vision weniger schillernd sein mag als Feynmans universeller Quantencomputer, so schenkt die Physikergemeinschaft den Quantensimulatoren mehr Aufmerksamkeit als je zuvor. "Viele Physiker taten die Idee eines Quantencomputers zunächst als nicht beachtenswert ab, insbesondere vor rund zehn Jahren. Und jetzt greifen sie diese Idee gern auf", sagt Monroe. Die Systeme mögen zwar nicht so anspruchsvoll sein, doch das macht sie leichter umsetzbar.
Lloyd formuliert es anders. "Wenn dir das Leben Quantenzitronen gibt, dann mach doch einfach Quantenlimonade daraus", sagt er. Die Simulatoren sind vielleicht nicht so süß wie Quantencomputer, aber "so lange die Limonade lecker und erfrischend ist, denke ich, geht das in Ordnung".
Dieser Artikel erschien unter dem Titel "Simulation: Quantum Leaps" in Nature 491, S. 322-324, 2012
Schreiben Sie uns!
1 Beitrag anzeigen