Pandemiebekämpfung: Rückwärts Kontakte verfolgen, um vorwärts zu kommen
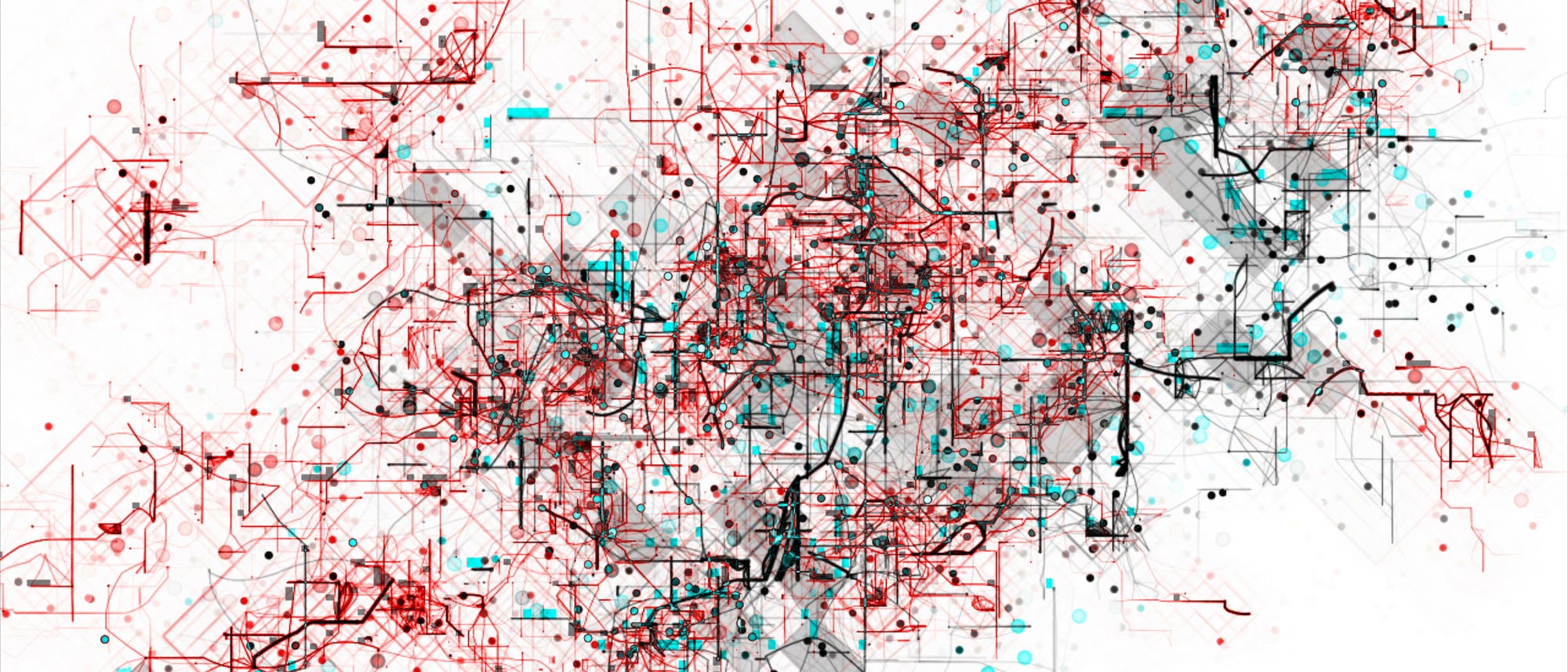
Eine Videokonferenz mit Hitoshi Oshitani vom japanischen Unterausschuss für die Kontrolle neuartiger Coronavirus-Krankheiten habe ihm die Augen geöffnet, sagt der US-Spezialist für Infektionskrankheiten KJ Seung. Ihm sei klar geworden, wieso das, was bislang in den USA gemacht werde, um die Kontakte von Covid-19-Patienten zu finden und zu isolieren, so wenig Erfolg hatte, erklärt Seung. Als Mitglied der gemeinnützigen Organisation »Partners In Health« hilft er, das Kontaktnachverfolgungsprogramm in Massachusetts, USA, umzusetzen.
Während die meisten Staaten Kontaktpersonen warnen, also Menschen, an die Infizierte das Virus möglicherweise weitergegeben haben, macht Japan es genau andersherum. Und das mit großem Erfolg, wie Seung zugeben muss. Er setzt diese Methode seither auch im US-Bundesstaat Massachusetts um. »Mit retrospektiver Kontaktnachverfolgung können wir Cluster viel gezielter finden; wir können mehr Fälle identifizieren und auf viel effizientere Weise.«
Hinter der Strategie steckt die Erkenntnis, dass vor allem »Superspreader« die Pandemie vorantreiben. Rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass derjenige, der den Infizierten angesteckt hat, das Virus auch an eine Reihe anderer Personen weitergegeben hat. Um ihn herum bildet sich ein so genannter Cluster, eine Gruppe Infizierter. »Wir versuchen, die Quelle der Infektion zu finden, denn da muss irgendwo ein Cluster sein«, erklärt Oshitani.
Auf der Jagd nach den Clustern
Im Juni schätzten Forscherinnen und Forscher der London School of Hygiene and Tropical Medicine, dass etwa 80 Prozent der Übertragungen von rund zehn Prozent der Infizierten ausgehen. »Mit der klassischen, nach vorne gerichteten Methode muss man viel mehr bestätigte Fälle identifizieren, um ein Cluster zu finden.« Ist hingegen einer aus dem Pool der zehn Prozent gefunden, werden dessen Kontakte wieder klassisch, nach vorne gerichtet verfolgt – schließlich hat er wahrscheinlich weitere angesteckt.
»Mit retrospektiver Kontaktnachverfolgung können wir Cluster viel zielstrebiger finden«KJ Seung
Bei der »retrospektiven Kontaktnachverfolgung« sucht man deswegen jene Kontakte, die ein Patient hatte, bevor er infiziert war. So versucht man, die Quelle seiner Ansteckung zu finden. Diese Vorgehensweise beruht auf der Erkenntnis, dass die meisten Covid-19-Infizierten niemanden anstecken, während nur wenige das Virus an andere weitergeben. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber ihre Bedeutung für die Bekämpfung der Pandemie sei von den Verantwortlichen in Europa und den USA bisher unterschätzt worden, erklärt die Techniksoziologin Zeynep Tüfekçi: »Länder, die diese Charakteristik des Virus übersehen, riskieren das Schlechteste aus zwei Welten: harte Restriktionen, die noch dazu kaum helfen, die Verbreitung des Virus zu stoppen.«
Dabei sei die Theorie einfach zu erklären, sagt Tüfekçi in einem Webinar des Berkman Klein Center for Internet and Society der Harvard University, zu dem auch KJ Seung und sein japanischer Kollege Hitoshi Oshitani, der als einer der Pioniere hinter dem japanischen Ansatz gilt, eingeladen sind. Dieser Ansatz, der sich unter anderem mittels retrospektiven »contact tracing« auf die Entdeckung von Clustern konzentriert, hat Japan relativ niedrige Zahlen beschert – ohne ausgefeilte Überwachungstechnologie, ohne einen strikten Lockdown, trotz weniger Tests und trotz einer dicht zusammenlebenden Bevölkerung.
Fokus auf die Superspreader
Die Öffentlichkeit diskutiert meist den R-Wert, der besagt, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Doch sehr viel entscheidender für die Frage, wie die Pandemie bekämpft werden kann, ist ein anderer Wert: k drückt aus, wie gleichmäßig weitere Ansteckungen auf die ursprünglichen Infizierten verteilt sind. Je kleiner dieser Wert, umso ungleicher ist die Weitergabe verteilt – umso weniger Menschen verursachen also die Mehrheit der Infektionen.
In der Studie vom Juni kam die Arbeitsgruppe auf der Basis chinesischer Daten zu einem k-Wert von 0,1 – bei dem ungefähr zehn Prozent der Infizierten 80 Prozent der weiteren Ansteckungen auslösen. Sie rät, sich bei der Bekämpfung der Pandemie auf diese Superspreader zu konzentrieren. Sars und Mers hatten übrigens ähnlich niedrige k-Werte, was auch erklärt, wieso einige asiatische Nationen besser auf diese Art der Verbreitung vorbereitet sind. Demgegenüber wies die Grippepandemie von 2018 beispielsweise einen k-Wert von rund 1 auf – sie verbreitete sich also deutlich gleichmäßiger.
Noch ist unklar, welche Eigenschaften einen Menschen in die eine oder andere Gruppe befördern. Unter anderem wird darüber spekuliert, dass eine feuchte Aussprache einer der Faktoren sein könnte. Ein niedriger k-Wert könne jedenfalls Grund zur Hoffnung sein, betont Tüfekçi: Schließlich finden die meisten Infektionsketten von selbst ein Ende.
Diese Erkenntnis zeigt aber auch, dass die westliche Praxis der Kontaktnachverfolgung wenig effizient ist und eigentlich fast immer die falschen Fälle findet: Denn wenn 80 oder gar 90 Prozent der Infizierten das Virus quasi nicht weitergeben, kann man sich sparen, deren Kontakte aufzuspüren und zu isolieren. Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht infiziert sein. Und wenn sie es sind, geben sie das Virus wiederum mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht weiter.
Die meisten Menschen werden binnen einer Woche krank
Nur: Wie lässt sich herausfinden, ob eine infizierte Person zu diesen 80 Prozent gehört oder zu jenen 20 Prozent, die andere anstecken? Das ist das Geheimnis, das der US-Amerikaner KJ Seung von seinem japanischen Kollegen Hitoshi Oshitani in jenem folgenreichen Video-Call erfuhr: nicht, indem man die Kontakte das Infizierten verfolgt, die er möglicherweise infiziert hat, sondern indem man versucht herauszufinden, wer ihn infiziert hat. Denn diese Person ist nachweislich im Pool der 20 Prozent, die das Virus weitergeben.
In der retrospektiven Kontaktnachverfolgung werden die Aktivitäten des Infizierten bis zu 14 Tage vor seiner Ansteckung rekonstruiert. »In den meisten Fällen findet sich die Quelle der Infektion in den fünf bis sieben Tagen vor Symptombeginn«, erklärt Oshitani, »in vielen Fällen sind es sogar nur drei bis fünf Tage.« Das Ziel sei, diese Quelle zu finden und zu sehen, ob sie das Virus an andere weitergegeben hat.
»Die größte Gefahr ist der isolierte Fall«, berichtet US-Kontaktverfolger KJ Seung aus seiner Praxis, »Menschen, bei denen wir keine Ahnung haben, wo sie sich angesteckt haben.« Denn diese deuten darauf hin, dass irgendwo ein Cluster lauert, der bisher übersehen wurde. Wird er nicht entdeckt, verbreitet sich das Virus von da aus weiter – bis wieder irgendwo ein scheinbar einzelner Fall auftaucht. Jene so genannte »Community-Übertragung«, in der Infektionsketten nicht mehr nachvollzogen werden können, ist die Regel in Zeiten wie diesen, in denen die Fallzahlen steigen und die Nachverfolger in den Gesundheitsämtern nicht mehr hinterherkommen, Kontakte aufzuspüren. »Wenn man dann retrospektives ›contact tracing‹ startet, kann man die Cluster eher finden«, so Seung.
»Der Hauptunterschied ist, dass man weiter in die Vergangenheit schaut«Akira Endo
Ist die Methode nicht viel aufwändiger als das hiesige, in die Zukunft gerichtete Tracing? Das kommt ganz drauf an. »Der Hauptunterschied ist, dass man weiter in die Vergangenheit schaut«, erklärt Akira Endo von der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Das kann auf den ersten Blick aufwändiger wirken. Wenn es aber andererseits dazu führt, dass Cluster schneller entdeckt werden, spart es an diesem Ende wieder Tracing-Arbeit: Denn wenn ein Cluster schnell entdeckt und die Ausbreitung gestoppt ist, müssen künftig weniger Kontakte jener Betroffenen nachverfolgt werden. Endo hat das mit Kolleginnen und Kollegen mathematisch modelliert. Die Studie geht davon aus, dass die Kontaktnachverfolgung zwei- bis dreimal effektiver sein kann, wenn sie auf die japanische Weise mit der retrospektiven Variante kombiniert wird.
Der entscheidende Faktor: Zeit
»Wir haben gezeigt, dass diese Kombination einen großen Unterschied bei der Verhinderung weiterer Übertragungen machen kann, wenn sie schnell und in großem Maßstab umgesetzt wird«, erklärt Endo. Allerdings müsste der Prozess gut organisiert und koordiniert sein: Eines der größten Probleme der Rückverfolgung sind die Verzögerungen – und wenn die identifizierten Kontakte eines nachweislich ansteckenden Kontakts bereits weitere angesteckt haben, besteht die Gefahr, diese Infektionsketten nie wieder einzuholen.
Da zwischen zwei »Generationen« Infizierter durchschnittlich vier bis sechs Tage liegen, muss die Rückverfolgung von Kontakten in einem ähnlichen Zeitrahmen geschehen – sonst zieht die Infektionskette weiter. Die Studie geht davon aus, dass Kontakte von zurückverfolgten Infektionsquellen erreicht und unter Quarantäne gestellt werden, bevor sie infektiös werden. »Das ist wahrscheinlich erst realistisch, wenn die aktuelle Welle abklingt«, sagt Endo. Momentan gebe es zu viel Community-Übertragung, also Ansteckungen, die sich nicht zurückverfolgen lassen.
Zudem lasse sich die Methode gut verbinden mit einer anderen Erkenntnis, sagt Hitoshi Oshitani im Webinar: nämlich mit jener, laut der das Virus vor allem in geschlossenen Räumen, Orten mit vielen Menschen sowie in engem Kontakt übertragen wird. Wenn die Kapazitäten der Kontaktnachverfolger ausgeschöpft sind, sei es sinnvoll, zunächst lediglich diese Events im Leben eines Infizierten etwa fünf bis sieben Tage vor Beginn von dessen Symptomen zu identifizieren. Die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass er sich bei einer solchen Gelegenheit angesteckt hat. Zudem können dann Cluster zügig identifiziert werden, also Gelegenheiten, bei denen sich möglicherweise viele Menschen auf einmal infiziert haben.
Schnelltests könnten das Verfahren weiter beschleunigen
Oshitani hat noch ein Muster beobachtet, das sich seit Beginn der Pandemie verändert hat: Die Orte, an denen eine solche Infektionskette startet, haben sich mehr und mehr ins Nachtleben und die Partyszene verlagert. »Die ersten Fälle eines Clusters sind oft junge Menschen, auch weil sie aktiver sind.« Erst wenn diese frühen Cluster nicht entdeckt werden, auch weil die Erkrankung bei jungen Menschen häufig asymptomatisch verläuft, startet eine Übertragungskette, die sich schnell kaum mehr nachvollziehen lässt. Dann stecken sich in größerer Zahl Menschen aus Risikogruppen an. »Wenn wir diese Übertragungsketten schnell stoppen, kommen weniger Menschen ins Krankenhaus«, erklärt der japanische Infektiologe. Mit nach vorne gerichtetem »contact tracing« sei das jedoch kaum möglich, da Cluster oft zu spät entdeckt werden.
Als Ergänzung schlägt Tüfekçi massenhafte günstige Schnelltests vor, so genannte Antigen-Tests, die zwar nicht so genau sind wie die klassischen PCR-Tests, aber trotzdem helfen können, Cluster zu entdecken. So könnte man die Kontakte eines Infizierten ohne Zeitverzug testen – und wenn auch nur ein Teil der Tests positiv ist und möglicherweise wegen der mangelnden Testgenauigkeit nicht alle Infizierten gefunden werden, wisse man, dass der Patient offenbar zu den 20 Prozent Menschen gehört, die das Virus weitergeben. »Wenn wir auch nur ein oder zwei Fälle unter den Kontakten entdecken, können wir davon ausgehen, dass mehr angesteckt wurden.« In diesem Fall mache es Sinn, alle Kontakte zur Selbstisolierung aufzufordern, denn dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich infiziert haben. Käme hingegen kein einziger positiver Test zurück, sei vermutlich auch niemand infiziert worden.
Dank der Strategie, mit schnellen, günstigen Antigen-Tests Cluster aufzuspüren, senkte Madrid die Infektionszahlen drastisch – trotz voll besetzter Restaurants und insgesamt wenig Einschränkungen. Manche bezeichnen das als »Wunder von Madrid«, doch einige US-Forscher sagen diesen Effekt von schnellem, massivem und günstigem Testen seit Monaten voraus. Kürzlich prophezeite der Epidemiologe Michael Mina von der Harvard T.H. Chan School of Public Health in einem viel beachteten Artikel, dass die Ausbreitung der Pandemie bereits bis Weihnachten gestoppt sein könnte, wenn auch nur die Hälfte der Bevölkerung regelmäßig in großem Stil mit Antigen-Tests getestet würde. Die Kosten dürften kein Argument sein: Für die gesamten Vereinigten Staaten würde ein solches landesweites Antigen-Schnelltestprogramm nur »einen Bruchteil der Kosten bedeuten, die dieses Virus für unsere Wirtschaft verursacht«.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.