Medizin: Streit um die Prostatakrebs-Früherkennung
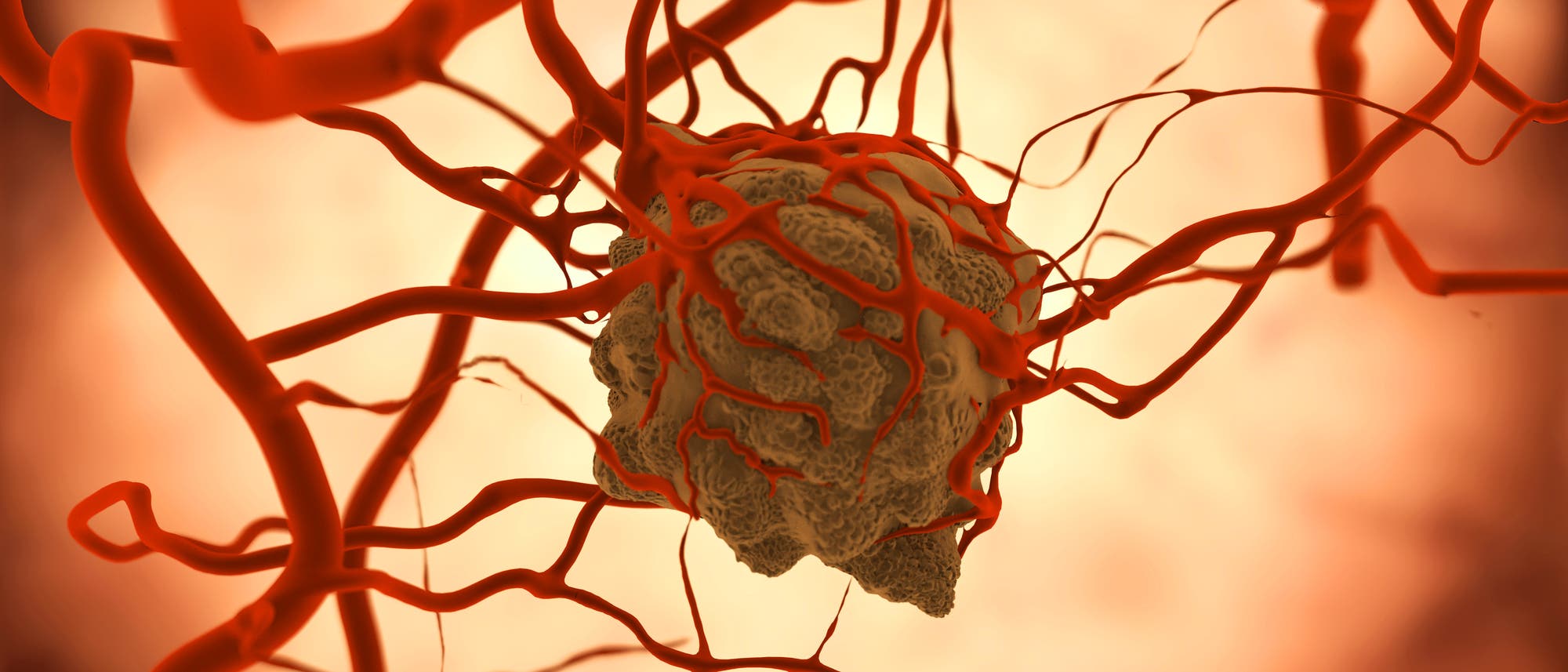
Im vergangenen Herbst ließ die amerikanische "Preventive Services Task Force" eine Bombe platzen. Das Expertengremium, das die US-Regierung in Gesundheitsfragen berät, empfahl gesunden Männern, nicht mehr an PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs teilzunehmen. Denn diese Messungen des Blutspiegels an prostataspezifischem Antigen (PSA) hätten als Instrument zur Krebsvorsorge nur wenig oder gar keinen Nutzen. Statt Leben zu retten, führten sie nur dazu, dass hunderttausende Männer unnötig operiert oder bestrahlt würden – mit Nebenwirkungen wie Impotenz, Inkontinenz und Rektalblutungen.
Die amerikanischen Experten schätzen, dass seit 1985 mehr als eine Million Männer auf Grund eines positiven PSA-Tests an der Prostata behandelt wurden. Mindestens 5000 von ihnen starben kurz nach dem Eingriff, weitere 300 000 wurden impotent, inkontinent oder beides. Kurz nachdem die Task Force diese alarmierenden Zahlen veröffentlicht hatte, hagelte es empörte Kommentare von medizinischen Fachgesellschaften. Auch die American Urological Association, ein amerikanischer Berufsverband von derzeit mehr als 18 000 Urologen, äußerte Kritik.
Die Kontroverse ist nicht neu – schon seit Langem debattieren Experten über den Nutzen des PSA-Tests. Trotzdem tendiert die öffentliche Meinung in den USA immer noch dahin, seinen massenhaften Einsatz zu befürworten. Als internistischer Onkologe, der sich auf Prostatakrebs spezialisiert hat, stimme ich der Einschätzung der Task Force jedoch in den wesentlichen Punkten zu. Vielen medizinischen Laien ist nicht klar, wie schwach die Belege sind, die für den PSATest als Instrument zur Krebsfrüherkennung sprechen. Er liefert zwar nützliche Informationen – aber erst, nachdem ein Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Zudem wissen nur wenige, dass bei der medizinischen Behandlung des Prostatakarzinoms häufig Komplikationen auftreten, trotz ausgefeilter Therapieformen, die zumindest unter Befürwortern als besonders fortschrittlich gelten.
Eine weitere Kontroverse betrifft die Frage, ob und wann diejenigen Patienten behandelt werden sollen, die unzweifelhaft an Prostatakrebs erkrankt sind. Auch hier sprechen die vorliegenden Daten für einen deutlichen Kurswechsel – weg von aggressiven Soforteingriffen und hin zu einem vorsichtigeren, individuell angepassten Vorgehen. Die Ursache für diesen Sinneswandel liegt in der Erkenntnis, dass eine Prostatakrebserkrankung von Patient zu Patient sehr unterschiedlich verlaufen kann. Die möglichst frühzeitige Therapie ist deshalb nicht das Patentrezept, für das viele Ärzte, ich einbegriffen, sie lange Zeit gehalten haben.
Kostenloses Probeheft | Blättern Sie durch die aktuelle Ausgabe und sichern Sie sich Ihr kostenloses Probeheft!
Sowohl die PSA-Messung als auch die heutigen Therapien gegen Prostatakrebs sind mit grundlegenden Problemen behaftet. Eine Reihenuntersuchung zum frühzeitigen Erkennen von Krankheiten – ein so genanntes Screening – liefert im Idealfall nur bei den Patienten ein positives Ergebnis, die unbehandelt tatsächlich die Symptome der Erkrankung ausbilden würden. Dementsprechend sollte ein perfektes Prostatakrebs-Screening ausschließlich Tumoren identifizieren, die ohne medizinischen Eingriff zu gesundheitlichen Problemen führten. Die betroffenen Männer könnten anschließend therapiert werden, wobei der Eingriff im besten Fall sowohl hocheffektiv wäre als auch keine ernsthaften Nebenwirkungen hätte. Wenn beides vorläge – ideales Screening und ideale Therapie –, dann wäre es in der Tat angezeigt, so viele Männer wie möglich zu testen und alle zu behandeln, bei denen der Test positiv ausfällt.
Doch davon sind wir weit entfernt. Ein positiver PSA-Test bedeutet nicht, dass der Patient ein Prostatakarzinom hat, sondern nur, dass er eins haben könnte. Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Protein, das von der Prostata produziert und der Samenflüssigkeit beigemischt wird. Normalerweise fällt seine Konzentration im Blut verschwindend gering aus. Sie kann aber aus verschiedenen Gründen ansteigen, etwa bei einer altersbedingten gutartigen Vergrößerung der Prostata, im Zuge einer Infektion, nach sexueller Aktivität – oder eben auf Grund des Wachstums eines bösartigen Prostatatumors.
Wenn der PSA-Test wiederholt ein positives Ergebnis liefert, entnimmt der Arzt Gewebe aus der Prostata, um es zu untersuchen. Diese so genannte Biopsie ist unangenehm und bringt gewisse Risiken mit sich, stellt aber noch nicht das eigentliche Problem dar. Denn sie erlaubt es immerhin festzustellen, ob sich in der Prostata des Patienten ein bösartiger Tumor gebildet hat oder nicht. Das wirkliche Dilemma besteht darin, dass die Mediziner nicht erkennen können, ob ein so gefundener Tumor gefährlich ist oder ob er dem Betroffenen zeitlebens nie Probleme bereiten wird.
Im fortgeschrittenen Alter erkrankt die Prostata fast immer
Studien zufolge haben mehr als die Hälfte der amerikanischen Männer, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind, Prostatakrebs. Bei den Männern über 80 sind es sogar mehr als drei Viertel. Die Mehrzahl von ihnen stirbt jedoch nicht an dem Tumorleiden, sondern an anderen Erkrankungen. Bei wem ist eine Behandlung unbedingt geboten und bei wem völlig unnötig? Die Ärzte wissen es in der Regel nicht.
Diese Unklarheit wäre hinnehmbar, wenn die Therapie keine Risiken mit sich brächte. Denn dann könnte man viele behandeln, um das Leben weniger zu retten. Leider sieht die Realität jedoch anders aus. Denn in unmittelbarer Nähe der Prostata liegen Enddarm, Harnblase und Penis. Das macht es schwierig, hier zu operieren oder zu bestrahlen, ohne die benachbarten Organe zu beschädigen.
Eine chirurgische Entfernung der Prostata führt oft zu Inkontinenz, da der Arzt den Blasenausgang von der Harnröhre trennen muss. Zwar verbindet er die beiden Strukturen später wieder, doch kommt es während solcher Eingriffe immer wieder zu Schäden am Schließmuskel, der die Blasenentleerung kontrolliert. Zudem können die Nerven und Blutgefäße, die für die Erektionsfunktion verantwortlich sind, versehentlich durchtrennt werden, was den Patienten impotent macht. Angeblich treten solche Komplikationen bei roboterassistierten Operationen seltener auf, doch fehlen bislang große, unabhängige Studien, die das klar belegen.
"Bei wem ist eine Behandlung unbedingt geboten und bei wem völlig unnötig? Die Ärzte wissen es in der Regel nicht."
Auch eine Bestrahlung der Prostata kann Impotenz zur Folge haben. Zusätzlich lauert hier die Gefahr, dass Enddarm und Harnblase Schaden nehmen, da sie von der kaum vermeidbaren Streustrahlung getroffen werden. Blutungen aus dem Enddarm und ungewollter Stuhlabgang sind häufige Nebenwirkungen der Strahlentherapie, die generell zu selten dokumentiert werden. Sie treten auch nach dem Einbringen kleiner radioisotopenhaltiger Nadeln oder Körner, so genannter Seeds, in die Prostata auf, sowie nach chirurgischen Eingriffen. Schließlich stehen zur Behandlung des Prostatakarzinoms noch diverse medikamentöse Verfahren zur Auswahl – Hormon-, Immun- und Chemotherapien –, die ebenfalls Nebenwirkungen haben. Dazu zählen der Verlust des Sexualtriebs, Impotenz, Gewichtszunahme, Knochenschwund, Hitzewallungen sowie Störungen der Herz- und Leberfunktion. Deshalb sollte der Arzt deshalb immer sämtliche Risiken sorgfältig gegen den möglichen Nutzen abwägen. Seit einiger Zeit mehren sich die Erkenntnisse, die gegen den Einsatz des PSA-Tests in der Krebsfrüherkennung sprechen. Bereits 2008 empfahl die Preventive Services Task Force, dass Männer über 75, die keine Prostatabeschwerden haben, nicht damit untersucht werden sollten. Denn die vorliegenden Daten hatten ergeben, dass Prostatakrebspatienten dieser Altersgruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an ihrem Tumorleiden sterben, sondern aus anderen Gründen.
Nur ein Jahr später zeigten die Ergebnisse zweier sehr großer Erhebungen – der europäischen "ERSPC" - und der amerikanischen "PLCO"-Studie –, dass dies auch für jüngere Männer gelten könnte. In beiden Studien teilten die Forscher gesunde Männer zwischen 50 und 74 Jahren per Zufall in zwei Gruppen ein (insgesamt lag die Teilnehmerzahl bei rund 250 000). Die erste Gruppe nahm regelmäßig an Früherkennungstests teil, entweder mittels PSA-Messung oder mittels Tastuntersuchung, also dem Befühlen der Prostata durch den Arzt. Lieferten die Tests ein auffälliges Ergebnis, wurden Biopsien vorgenommen, und falls darin Krebszellen erkennbar waren, empfahl der Arzt in der Regel eine Therapie. Die zweite Gruppe bekam kein regelmäßiges Screening angeboten, erhielt jedoch die übliche medizinische Versorgung, falls notwendig. Wenn ein Mann aus dieser Gruppe etwa Probleme beim Wasserlassen hatte – ein möglicher Hinweis auf Prostatakrebs –, wurde er entsprechend inspiziert und behandelt. Am Ende des Untersuchungszeitraums analysierten die Forscher beide Gruppen im Hinblick auf folgende Aspekte: Lebten die Männer, die an regelmäßigen Vorsorgetests teilgenommen hatten, länger als jene der Vergleichsgruppe? Und starben sie seltener an Prostatakrebs als diese? Die erste Frage beantworteten beide Studien mit einem klaren Nein. Bezüglich der zweiten Frage fiel die Antwort mehrdeutig aus. Die europäische Erhebung ergab bei den Männern, die am Screening teilnahmen, ein um 20 Prozent geringeres Risiko, an Prostatakrebs zu sterben. Die US-Untersuchung hingegen zeigte auch in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
Viele unnötige Eingriffe
In der europäischen Studie ermittelten die Forscher zudem, wie viele Patienten getestet und behandelt werden müssen, um einen Todesfall durch Prostatakrebs zu verhindern. Dieses Verhältnis zu kennen, ist sehr wichtig, um den Nutzen eines Screenings zu bewerten. Laut den Berechnungen ist es erforderlich, 1400 Männer zu untersuchen und 48 davon zu behandeln, um einem Todesfall vorzubeugen. Das bedeutet, dass 47 Patienten eine Therapie mit zweifelhaftem Nutzen erhalten, die bei vielen erhebliche Nebenwirkungen zeitigt. Zusätzlich fragwürdig erscheint das Screening, bedenkt man, dass sich die Gesamtsterblichkeit zwischen den regelmäßig untersuchten Männern und der Vergleichsgruppe nicht unterschied.
Allerdings müssen wir Vorsicht walten lassen, wenn wir diese Studien interpretieren. Denn die Daten zeigen zwar recht eindeutig, dass die meisten gesunden Männer ohne Prostatabeschwerden keine regelmäßigen Früherkennungsuntersuchungen benötigen. Doch bei Patienten mit einem Familienangehörigen, der vor dem 70. Lebensjahr an Prostatakrebs gestorben ist, erscheint die regelmäßige Messung des PSA-Werts gerechtfertigt. Sie besitzen möglicherweise eine ererbte Veranlagung, die das Erkrankungsrisiko erhöht. In einigen Jahren wird es vielleicht möglich sein, besonders gefährdete Männer mit genetischen Tests zu identifizieren, um sie in einem speziellen Vorsorgeprogramm zu betreuen. Einer meiner Patienten, Herr H., nahm bereits vor 16 Jahren den heutigen Standpunkt der Preventive Services Task Force ein. 1996 war bei ihm im Alter von 54 Jahren ein PSA-Test positiv ausgefallen und anschließend Prostatakrebs diagnostiziert worden. Er konsultierte viele Spezialisten, darunter auch mich, und alle rieten ihm zur Therapie. Trotzdem lehnte er jegliche Behandlung ab, denn nach dem Studium der verfügbaren Fachliteratur war er zu dem Schluss gekommen, es sei unwahrscheinlich, dass er in absehbarer Zukunft an dem Krebs sterben würde. Zudem ging er davon aus, dass nach einigen Jahren des Wartens neue, wirksamere Therapien zur Verfügung stehen würden. Er gewöhnte sich lediglich eine gesündere Lebensweise an und nahm ab. Jahr für Jahr, nachdem er diese mutige Entscheidung getroffen hatte, gab ich meinem Patienten erneut den Rat, sich behandeln zu lassen. Und jedes Mal lehnte er ab. Heute geht es dem inzwischen 70-Jährigen immer noch sehr gut. Weder wurde er operiert noch bestrahlt noch mit Medikamenten behandelt, trotzdem hat sein Tumor nicht gestreut. Sein PSA-Wert ist in dieser Zeit von 7 auf 18 Einheiten gestiegen – eine ausgesprochen gemächliche Zunahme, die darauf schließen lässt, dass der Krebs sehr langsam wächst. Der Verzicht auf eine Therapie war offenkundig richtig. Indem Herr H. sich ausführlich informierte und unsere Ratschläge kritisch hinterfragte, konnte er eine gut begründete Entscheidung treffen. So vermied er es, den ungewissen Nutzen einer frühzeitigen Behandlung mit ihren fast sicheren Folgeschäden zu erkaufen.
Tatsächlich beruhten die ärztlichen Therapieempfehlungen zu der Zeit, als Herr H. erstmals in meiner Sprechstunde erschien, nicht etwa auf hochwertigen klinischen Studien, sondern auf falschen Vorstellungen vom Verlauf einer Prostatakrebserkrankung. Wir wussten, dass manche Tumoren nur langsam wachsen, andere hingegen sich sehr aggressiv entwickeln. Doch es galt als ausgemacht, dass die weitaus meisten irgendwann metastasieren und somit unheilbar würden. Einen Krebs im Frühstadium zu entdecken und sofort zu bekämpfen, erschien damals als praktisch gleichbedeutend damit, ein Leben gerettet zu haben. Diese Logik liegt auch dem heutigen Prostatakrebs-Screening zu Grunde.
Tumorwachstum im Schneckentempo
Doch die Sterblichkeitsstatistiken der letzten 25 Jahre zeigen, dass die Angelegenheit komplizierter ist. Seit den 1990er Jahren geht die Zahl der Männer, die an Prostatakrebs sterben, zurück. Die Befürworter von Früherkennungsprogrammen führen dies auf den massenhaften Einsatz des PSA-Tests zurück – doch wie wir an den beiden prospektiven Studien aus Europa und den USA gesehen haben, steht diese Annahme auf wackligen Füßen. Zudem hätte die Prostatakrebssterblichkeit viel schneller und deutlicher sinken müssen, wenn sie wirklich auf Grund des PSA-Screenings abgenommen hätte. Tatsächlich scheinen unsere früheren Überzeugungen nicht korrekt gewesen zu sein. Wie wir inzwischen wissen, wachsen viele Prostatakarzinome extrem langsam, oft sogar praktisch gar nicht.
"Eingeübte Gewohnheiten zu ändern, ist in der Medizin genauso schwer wie in anderen Lebensbereichen."
Forscher entdecken immer mehr Beispiele für Tumoren, die zunächst als bösartig eingestuft werden und doch so gemächlich wachsen, dass sie sich weder im Körper ausbreiten noch schwer wiegende klinische Symptome verursachen. Deshalb erwägen Mediziner bereits, ihnen eine besondere Bezeichnung zu geben – etwa "indolenter Tumor", was soviel wie "träge Geschwulst" bedeutet. Dies soll unterstreichen, dass die betroffenen Patienten für einen sehr langen Zeitraum unbehandelt bleiben können oder vielleicht sogar überhaupt keine Therapie benötigen. Zum Zeitpunkt der ersten Diagnose wissen wir zwar noch nicht, ob es sich um einen indolenten Tumor handelt, doch können wir seine weitere Entwicklung anhand seiner Eigenschaften recht gut abschätzen und in regelmäßigen Untersuchungen verfolgen.
Zugegeben: Eingeübte Gewohnheiten zu ändern, ist in der Medizin genauso schwer wie in anderen Lebensbereichen. Sicherlich wird es viele Ärzte und Patienten geben, die sich nicht damit wohlfühlen, auf das PSA-Screening zu verzichten, nachdem jahrelang das Gegenteil empfohlen wurde. Einige Patienten sind überdies fest überzeugt davon, dass die Vorsorgeuntersuchung ihr Leben gerettet hat. Wir sollten ihre medizinische Betreuung jedoch umgestalten, um sie vor unnötigen Behandlungen zu bewahren. Dazu müssen wir bei einem diagnostizierten Prostatakarzinom die Therapieentscheidung nur so lange aufschieben, bis wir einigermaßen genau wissen, ob wir es mit einer aggressiven, potenziell tödlichen Erkrankung zu tun haben oder mit einem indolenten Tumor.
Viele meiner Prostatakrebspatienten haben sich gegen einen sofortigen Eingriff entschieden und erhalten keinerlei Therapie. Stattdessen nehmen sie an einem Programm teil, das als "aktives Beobachten" bezeichnet wird – sie lassen regelmäßig ihren PSA-Wert messen und Prostatabiopsien durchführen. Eine Therapie kommt in Betracht, wenn der PSA-Wert rasch steigt, die Biopsie ein beschleunigtes Tumorwachstum anzeigt oder die Einordnung des Tumorgewebes gemäß der Gleason-Klassifikation ergibt, dass die Krebszellen deutlich aggressiver geworden sind. Kürzlich kamen Experten im Auftrag der National Institutes of Health zu der Einschätzung, das aktive Beobachten sei "eine brauchbare Option, die Patienten mit einem Niedrigrisiko-Prostatakarzinom angeboten werden sollte". Und eine in Kanada durchgeführte Langzeitstudie hat ergeben, dass etwa ein Prozent der Patienten, die sich für diese Option entscheiden, innerhalb von zehn Jahren an der Krebserkrankung sterben. Zum Vergleich: Bei der chirurgischen Entfernung der Prostata beträgt das Risiko tödlicher Komplikationen etwa 0,5 Prozent.
Die Entscheidung gegen eine Therapie ist nicht endgültig. Operation, Bestrahlung und andere Therapien stehen auch später noch zur Verfügung, und die vorliegenden Studiendaten zeigen, dass der Aufschub der Behandlung das klinische Resultat nicht verschlechtert. Für die Patienten, bei denen irgendwann tatsächlich ein Eingriff erforderlich wird, eignen sich dann möglicherweise neue Behandlungsansätze, die nur den erkrankten Teil der Prostata entfernen und deshalb weniger Nebenwirkungen haben. Tragfähige Studien zum Vergleich mit konventionellen Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen.
Für die vier Prozent der amerikanischen Patienten, bei denen der Tumor bereits in die Knochen oder andere Organe gestreut hat, gibt es noch keine Therapie, die zur vollständigen Heilung führt. Aber die verfügbaren Behandlungen werden allmählich effektiver. Gängige Eingriffe zielen darauf ab, die Wirkung des Testosterons zu unterbinden, um das Wachstum der Tumoren zu hemmen. Es gibt jedoch stets einige Krebszellen, denen es irgendwann gelingt, diese chemische Kastration zu überwinden. Deshalb hat die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) vor Kurzem zwei neue Therapieverfahren zur Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms bewilligt. Bei dem einen handelt es sich um den therapeutischen Krebsimpfstoff Provenge, der die Immunreaktion gegen den Tumor verstärken soll (siehe SdW 3/2012, S. 24). Die zweite neu zugelassene Therapie basiert auf dem Arzneistoff Abirateron, der die Tumorzellen selbst an der Produktion von Testosteron hindert. Studien zu beiden Behandlungsansätzen zeigen, dass sie die Überlebenszeit der Patienten im Mittel um vier Monate verlängern. Weitere Verfahren sind in der Entwicklung.
In den mehr als anderthalb Jahrzehnten, seit Herr H. sich gegen eine Therapie entschied, haben wir viel über Prostatakrebs gelernt. Das ermöglicht uns heute, die medizinische Betreuung an die individuelle Situation des Patienten anzupassen, statt alle Betroffenen gleich zu behandeln. Wir Ärzte sollten zudem die Botschaft mitnehmen, dass wir sowohl uns selbst als auch unseren Patienten stets klarmachen müssen, über welche gesicherten Erkenntnisse wir tatsächlich verfügen und was wir nicht wissen. Und wir sollten den Mut haben, uns an der besten wissenschaftlichen Evidenz zu orientieren, statt etablierten Glaubensgrundsätzen zu folgen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.