Thalamus: Vorkammer des Denkens
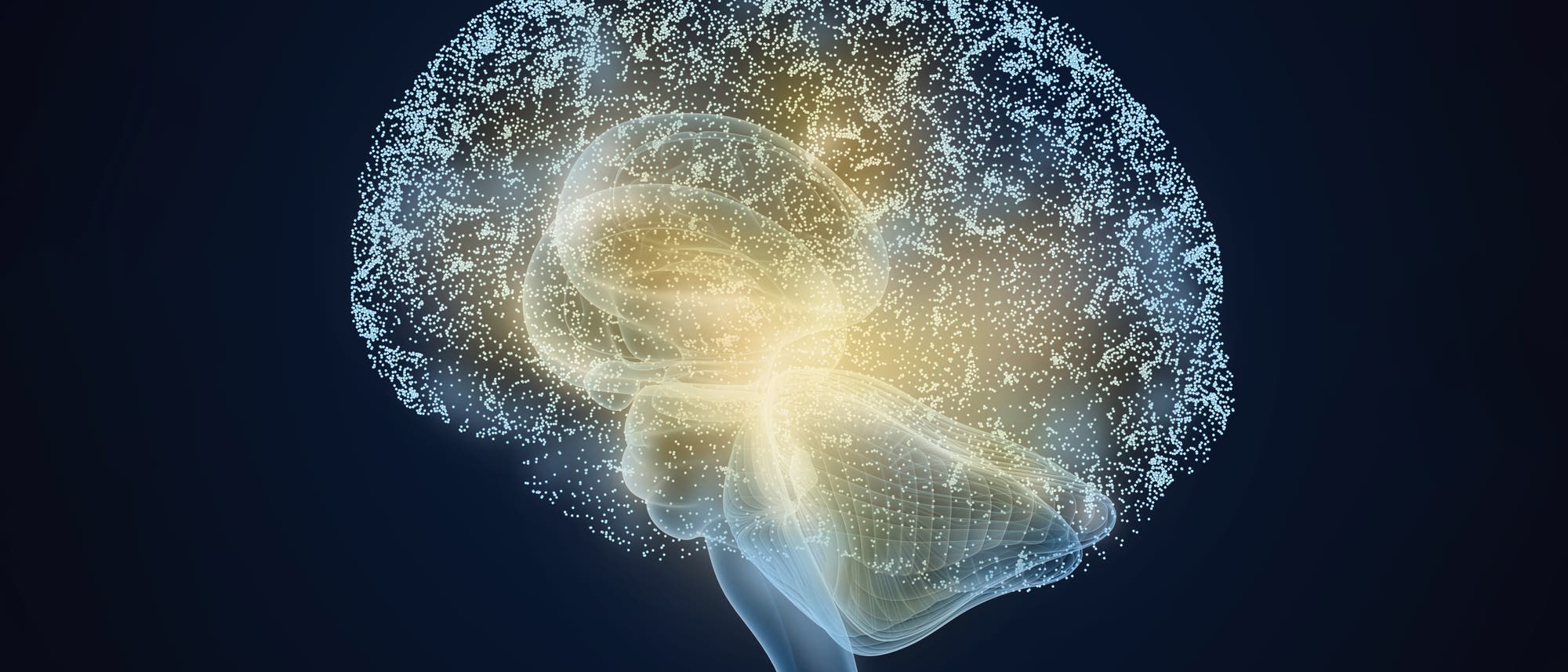
Dieser Artikel wurde erstmals im April 2024 veröffentlicht.
Eine wesentliche Funktion des Gehirns ist die Fähigkeit, uns auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist, und Irrelevantes auszublenden. Ihr verdanken wir, dass wir uns im Restaurant angeregt mit unserem Gegenüber unterhalten können, ohne mitzubekommen, was die Leute am Nebentisch gerade bereden. Aber auch, dass wir auf dem Spielplatz sofort die rote Wollmütze erkennen, die der eigene Nachwuchs trägt.
Über unsere Sinne strömen Unmengen von Informationen auf uns ein. Die Kapazität des Gehirns reicht nicht aus, sie alle zu verarbeiten. Es muss daher ständig priorisieren. Früher dachte man, die Hirnrinde sei dafür verantwortlich, vor allem der präfrontale Kortex (PFC), eine Region im Stirnlappen. Der PFC entsendet unter anderem Verbindungen in jene Zentren in der Großhirnrinde, die fürs Hören oder Sehen zuständig sind. Man nahm an, er weise diese Gebiete an, worauf sie besonders zu achten haben.
Eine andere Struktur scheint dafür wohl ebenso wichtig zu sein – der Thalamus. Er liegt nicht im Großhirn, sondern im entwicklungsgeschichtlich viel älteren Zwischenhirn, mitten im Zentrum unseres Denkorgans. Er ähnelt einem liegenden Hühnerei; allerdings ist er mit etwa vier Zentimeter Länge etwas kleiner. Seine Bedeutung wurde lange unterschätzt. In den letzten 20 Jahren hat sich das jedoch radikal geändert. Heute glaubt man, dass der Thalamus eine Schlüsselrolle bei dem spielt, was wir »Denken« nennen.
Seinen Namen verdankt er dem berühmten griechischen Arzt Galenos von Pergamon. Dieser beschrieb im 2. Jahrhundert n. Chr. eine Art Kammer im Gehirn (»Thalamus« bedeutet Schlafgemach oder Zimmer). Es ist umstritten, ob seine Entdeckung mit jener Struktur identisch ist, die heute den Namen trägt. Danach verschwand die Bezeichnung für 1400 Jahre in der Versenkung. Erst Anfang des 17. Jahrhunderts wurde sie von dem französischen Arzt Jean Riolan wiederbelebt. Wie der Thalamus im Detail aufgebaut ist oder wofür er zuständig sein könnte, wusste man damals noch nicht.
Gut 100 Jahre später entdeckte man, dass sich Gewebe mit Hilfe von hochprozentigem Alkohol fixieren und härten lässt. Dadurch ließ es sich mit Spezialmessern in hauchdünne Scheibchen schneiden und unter den immer leistungsstärkeren Mikroskopen untersuchen. »Zu diesem technologischen Sprung gesellten sich neue Färbemethoden«, erklärt Anatom Jürgen Mai von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. »Damit gelang es, die Feinstruktur des Thalamus besser aufzulösen.« In den folgenden Jahrzehnten wurde klar: Die mysteriöse Kammer gliedert sich in zahlreiche weitere Untereinheiten, die Thalamuskerne oder Nuklei.
Als einer der Väter der modernen Thalamusforschung gilt der französische Neurologe Julius Bernard Luys. Er stellte 1865 die These auf, dass die Struktur sensorische Reize zur Großhirnrinde weiterleitet. Jeder der Kerne war aus seiner Sicht für einen spezifischen Sinn zuständig: einer fürs Hören, ein anderer fürs Sehen und ein dritter für Berührungen. Tatsächlich weiß man heute: Fast alle Sinnesreize passieren auf dem Weg zur Großhirnrinde den Thalamus. Ausnahme sind lediglich Gerüche, die auf einem anderen Pfad verarbeitet werden.
Einer der am besten untersuchten Nuklei ist der seitliche Kniehöcker, abgekürzt LGN (nach seiner englischen Bezeichnung »lateral geniculate nucleus«, siehe »Die Thalamuskerne«). In ihn münden mehrere hunderttausend Axone aus der Netzhaut. Gleichzeitig entsendet der LGN Nervenfasern in den primären visuellen Kortex, einen Teil der Sehrinde, der im Bereich des Hinterkopfs liegt. Dort finden die ersten Verarbeitungsschritte optischer Reize statt. Lange dachte man, der LGN leite die Informationen aus dem Auge unverändert weiter. »Sie können im Prinzip im visuellen Kortex ablesen, welche Signale die Retina empfangen hat«, sagt der Thalamusexperte Jürgen Mai.
Demnach wäre der LGN eine Art Steckdose, die nicht mehr tut, als zwei Kabel miteinander zu verschalten. Der Psychologieprofessorin Sabine Kastner von der Princeton University kamen schon früh Zweifel, ob das simple Bild stimmt. »Der LGN erhält nur 10 Prozent seines Inputs aus der Netzhaut. Der Rest kommt aus anderen Hirngebieten. Da drängt sich doch die Frage auf, was diese 90 Prozent machen – ob sie zum Beispiel die Verarbeitung der visuellen Reize im LGN beeinflussen.«
Eine erste Antwort lieferte 2002 eine Studie aus Kastners Arbeitsgruppe. Die Fachleute hatten darin die Hirnaktivität von vier Versuchspersonen mit einem Magnetresonanztomografen (MRT) aufgezeichnet. Die Probandinnen und Probanden fixierten derweil ein Kreuz auf einem Bildschirm. Zu beiden Seiten des Kreuzes waren Schachbrettmuster zu sehen, die zu zufälligen Zeitpunkten ihre Helligkeit wechselten. Die Teilnehmer sollten ihre Aufmerksamkeit auf eine der beiden Seiten richten und angeben, wenn sich die Helligkeit in diesem Bereich änderte. Ihr Blick blieb dabei die ganze Zeit über auf das Kreuz gerichtet.
Wie nahezu sämtliche Strukturen im Gehirn ist auch der Thalamus paarig angelegt. In beiden Gehirnhälften gibt es damit einen LGN. Der rechte empfängt Informationen aus dem linken Gesichtsfeld, der linke aus dem rechten Gesichtsfeld. Auf den Hirnscans leuchteten während des Experiments beide LGN auf. Allerdings nicht gleich stark: Konzentrierten sich die Freiwilligen auf das linke Schachbrettmuster, war ihr rechter LGN besonders aktiv; im umgekehrten Fall ihr linker. Der Thalamuskern scheint also solche Signale bevorzugt zu verarbeiten, auf denen der Fokus der Aufmerksamkeit liegt. Andere Reize werden von ihm sogar unterdrückt, wie ein weiteres Experiment zeigte.
Signale je nach Fokus verstärken
Der LGN überträgt Signale demnach anscheinend nicht eins zu eins, sondern verstärkt oder schwächt sie je nach Aufmerksamkeitsfokus ab. Doch wie funktioniert das im Detail? Hinweise lieferte ein Mausexperiment an der New York University, dessen Ergebnisse 2015 publiziert wurden. Es ist ebenfalls ein Beispiel dafür, zu welchen kognitiven Leistungen die Nager fähig sind. Die Forschungsgruppe um den Neurowissenschaftler Michael Halassa hatte den Tieren eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt. In der Wand ihres Käfigs befanden sich nebeneinander zwei Aussparungen. Nur eine davon enthielt eine Belohnung in Form einiger Tropfen Kondensmilch.
Das Futterloch variierte von Versuch zu Versuch nach dem Zufallsprinzip. Die Tiere erhielten jedoch zwei Hinweise; einen optischen und einen akustischen: Einerseits hörten sie eine kurze Tonsequenz – absteigend für »rechts« und ansteigend für »links«. Andererseits war unter beiden Löchern ein Licht angebracht, von denen eines aufleuchtete. Das Problem dabei: Beide Informationen widersprachen sich. Leuchtete das linke Lämpchen, kam gleichzeitig ein absteigender Ton und umgekehrt. Wonach sollten sich die Nager bei ihrer Entscheidung richten?
Das bekamen sie ganz zu Beginn des Versuchs durch ein weiteres akustisches Signal mitgeteilt, eine halbe Sekunde vor den eigentlichen Ortshinweisen. Die Versuchstiere wussten dadurch, worauf sie ihre Aufmerksamkeit zu richten hatten, zum Beispiel: Gleich muss ich auf das Licht achten und kann die Tonsequenz getrost ignorieren. »Diese komplexe Aufgabe hat den Vorteil, dass sie eindeutig eine kognitive Leistung abfragt«, erklärt Halassa, der inzwischen Professor an der Tufts University in Boston ist und zudem das Zentrum für Neurowissenschaften des Helsinki Institute of Life Science leitet.
In einer Reihe von Experimenten störte das Team nun bei den Mäusen gezielt die Funktion verschiedener Hirnregionen. Dabei schien besonders ein Thalamuskern eine essenzielle Rolle für die erfolgreiche Futtersuche zu spielen: der TRN (das Kürzel steht für »thalamic reticular nucleus«). Der TRN unterscheidet sich grundlegend vom LGN: Er ist ein unspezifischer Kern, auch »Kern höherer Ordnung« genannt. Das heißt, er empfängt keine Sinnesreize. Stattdessen erhält er seinen Input aus der Hirnrinde, unter anderem dem präfrontalen Kortex (PFC). Und er ist dazu in der Lage, andere Thalamuskerne zu hemmen.
Das tut er offensichtlich auch: Wenn die Nager anfangs den Hinweis bekamen, ihre Aufmerksamkeit auf die Tonfolge zu richten, dann unterdrückte der TRN die Verarbeitung optischer Reize im LGN. Somit wurden jene Informationen weggefiltert, die in dieser Situation unwichtig waren. Die Instruktion dazu bekam der TRN vom PFC. Nur wenn alle drei Regionen zusammenspielen, können Mäuse unter komplexen Bedingungen die richtigen Entscheidungen treffen.
Hirnscanner-Untersuchungen am Menschen zeigen, dass bei Aufmerksamkeitsprozessen regelmäßig noch ein weiterer Thalamuskern aktiv wird: das Pulvinar. »Das ist ein Nukleus, der im Laufe der Evolution immer größer wurde«, sagt US-Psychologin Sabine Kastner. »Wir nehmen daher an, dass er eine wichtige Rolle für komplexere Hirnfunktionen spielt.« Das Pulvinar ist wie der TRN ein Kern höherer Ordnung. Es kommuniziert aber nicht in erster Linie mit dem präfrontalen Kortex, sondern vorwiegend mit solchen Regionen der Hirnrinde, die visuelle Informationen verarbeiten.
Was der Nukleus genau macht, ist erst in Ansätzen erforscht. Vermutlich fungiert er als eine Art Taktgeber: Er synchronisiert die verschiedenen Sehzentren miteinander und ermöglicht es ihnen so, untereinander Daten auszutauschen. Schon lange ist bekannt: Die Neurone im Gehirn haben einen Aktivitätsrhythmus. Es gibt Zeiten, in denen sie besonders leicht erregbar sind, und andere, in denen sie kaum feuern. Diese Phasen wechseln sich regelmäßig ab, oft zehnmal in der Sekunde oder noch häufiger.
Um miteinander zu kommunizieren, müssen Hirnareale im selben Rhythmus schwingen. »So lautet zumindest eine einflussreiche Hypothese, die Kommunikation-durch-Kohärenz-Theorie«, erklärt Tobias Staudigl, Professor für kognitive Neuropsychologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) in München. »Durch die Synchronisierung wird sichergestellt, dass die Informationen zu einem Zeitpunkt in dem Empfänger-Gebiet eintreffen, in dem sie dort auch verarbeitet werden können.« Es ist ähnlich wie beim Radio: Das Gerät muss auf die Frequenz des Senders eingestellt sein, sonst hört man nur Rauschen. Doch wer dreht im Gehirn am Empfangsknopf? Möglicherweise übernimmt das Pulvinar diese Funktion – zumindest in den Sehzentren. »Darauf deuten Versuche mit Affen hin, die wir vor einigen Jahren durchgeführt haben«, erklärt Sabine Kastner.
Pulsierende Aufmerksamkeit
Das visuelle System in der Hirnrinde verarbeitet das Gesehene nicht ganzheitlich, sondern getrennt: Farbe, Form und Bewegung erfasst es in unterschiedlichen Regionen. Später werden sie dann zu einem Gesamteindruck zusammengefügt; Fachleute sprechen hier von Binding. Das Pulvinar sorgt vermutlich dafür, dass die beteiligten Zentren miteinander sprechen können. Das ist eine Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Binding. Wenn der Nukleus geschädigt ist, etwa durch eine Hirnblutung, können charakteristische Defizite auftreten. Ein blauer Kreis und ein rotes Dreieck werden dann zum Beispiel als roter Kreis und blaues Dreieck wahrgenommen.
Wahrscheinlich funktioniert das Binding besonders gut, wenn sich das entsprechende Objekt gerade im Fokus unseres Interesses befindet. »So lassen sich zumindest die Daten aus unseren Affenexperimenten deuten«, erklärt Kastner. Das Pulvinar hilft uns also ebenfalls dabei, die Dinge bevorzugt zu verarbeiten, auf die wir unser Augenmerk richten. Interessanterweise ermöglicht der Thalamuskern wohl auch, unsere Aufmerksamkeit wieder zu lösen. Seit einigen Jahren ist nämlich bekannt, dass wir uns nicht immer gleich stark fokussieren. Stattdessen pulsiert unsere Aufmerksamkeit: Sie erreicht vier- bis sechsmal in der Sekunde ein Hoch und klingt dazwischen wieder ab.
Wenn wir etwa auf ein Ereignis in unserem Augenwinkel achten sollen, zum Beispiel, wann ein Lämpchen kurzzeitig heller leuchtet, dann klappt das jede fünftel Sekunde besonders gut. Doch warum ist das so? Vermutlich fällt es uns in den Phasen dazwischen leichter, das Interesse anderen Objekten zuzuwenden. Auch das ist enorm wichtig: Wer sich ausschließlich auf die Schlange vor seiner Nase konzentriert, überhört den Tiger, der sich von hinten anschleicht.
Der Thalamus synchronisiert Hirnareale
Die Synchronisierung verschiedener Gebiete im Kortex scheint eine sehr grundlegende Funktion des Thalamus zu sein. Durch sie lassen sich Hirnareale flexibel zusammenschalten, je nach Aufgabe. Grundsätzlich gibt es wohl kaum eine kognitive Leistung, an der der Thalamus nicht in irgendeiner Form beteiligt wäre – von der Aufmerksamkeitssteuerung über die Sprachverarbeitung und die Orientierung im Raum bis hin zur Verfrachtung von Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis. »Eine zentrale Rolle spielen dabei die so genannten Loops, also Verbindungen, die von der Hirnrinde zum Thalamus und umgekehrt wieder vom Thalamus zum Kortex laufen«, sagt Tobias Staudigl. Durch sie werden in beide Richtungen fortwährend Informationen ausgetauscht.
Wie wichtig das ist, zeigt ein Beispiel: »Der Hirnstamm kann durch motorische Befehle unsere Augenbewegungen steuern«, erklärt Staudigl. »Das Problem dabei: Der präfrontale Kortex kann nicht direkt auf diese Kommandos zugreifen.« Er erkennt zwar, dass die Bilder auf der Retina von links nach rechts wandern. Ohne zusätzliche Informationen kann er das Phänomen aber nicht deuten: Bewegt sich die Szene, die wir gerade betrachten? Oder bewegen sich die Augen?
Um diese Zweideutigkeit zu beseitigen, erzeugt das Gehirn einen Zwilling des Steuerkommandos. »Die so genannte Efferenzkopie wird über den Thalamus an den Stirnlappen weitergegeben«, sagt Staudigl. »Der Kortex weiß dann, dass sich die Augen bewegen, und trifft eine Vorhersage darüber, wie sich das auf die Signale von der Netzhaut auswirken sollte.« Der Mechanismus ist schon lange bekannt. Er hilft uns beispielsweise dabei, ein motorisches Kommando (etwa »Ergreife die Tasse!«) mit der tatsächlich erfolgten Bewegung zu vergleichen und letztere gegebenenfalls zu korrigieren.
»Der Thalamus reduziert vermutlich die Komplexität der Informationen und hilft so dem präfrontalen Kortex, ein komprimiertes Abbild der Welt zu formen«Michael Halassa, Neurowissenschaftler
»Wir glauben, dass es ähnliche interne Modelle auch auf der kognitiven Ebene geben muss«, sagt Sabine Kastner. »Woher weiß ich, dass ich gerade tatsächlich mit Ihnen spreche? Es muss irgendein Signal im Gehirn geben, das mir das sagt. Sonst kann ich mir nicht sicher sein, ob die Stimme, die ich höre, wirklich existiert oder nur in meinem Kopf.« Womöglich speichert der Thalamus solche Signale über längere Zeit und erinnert die Hirnrinde immer wieder daran: Das hier ist der Kontext, in dem du dich gerade befindest.
Wie Michael Halassa glaubt, hilft uns die Struktur in den Tiefen des Gehirns ebenfalls dabei, aus dem Kontext die richtigen Schlüsse zu ziehen. »Der präfrontale Kortex bildet ständig Annahmen über den Zustand der äußeren Welt«, erklärt er. »Wenn Sie zum Beispiel in einem Restaurant ein fürchterlich schmeckendes Gericht bekommen, kann das schlicht daran liegen, dass das Restaurant nicht gut ist. Der Grund kann aber auch sein, dass der Koch gerade ausgefallen ist. Zu welchem Schluss Sie kommen, hängt von den weiteren Informationen ab, die Sie haben.«
Über unsere Sinne strömen permanent Details auf uns ein. Manche von ihnen sind in der skizzierten Situation irrelevant (gegenüber vom Restaurant steht ein blaues Auto, die Sonne scheint), andere dagegen vermutlich nicht (ich bin der einzige Gast, die Tische sehen schmuddelig aus). Müsste der PFC all diese Daten verarbeiten, wäre das langsam und ineffizient. »Der Thalamus reduziert vermutlich die Komplexität der Informationen und hilft so dem präfrontalen Kortex, ein komprimiertes Abbild der Welt zu formen«, sagt Halassa.
»Von dem Thalamus zu reden, als wäre er eine einheitliche Region, ist Quatsch«Tobias Staudigl, Neuropsychologe
Wenn das nicht richtig funktioniert, sind möglicherweise psychische Störungen wie ADHS, Autismus oder Schizophrenie die Folge. So gibt es Hinweise darauf, dass bei Menschen mit Schizophrenie der Thalamus kleiner als normal und schlechter durchblutet ist. Je kleiner der Thalamus, desto häufiger leiden die Betroffenen unter Halluzinationen, wie Fachleute vom St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis 2021 resümierten. Dazu passt, dass in bestimmten Teilen des Thalamus gehäuft Gene abgelesen werden, deren Fehlfunktion vermutlich zu Schizophrenie oder Autismus führen kann. Wurden diese Erbanlagen im Thalamus von Mäusen ausgeschaltet, entwickelten die Tiere abnorme Erregungsmuster im Gehirn sowie Erinnerungsdefizite.
Der Thalamus könnte daher ein interessantes therapeutisches Ziel sein. Es ist beispielsweise denkbar, bestimmte Kerne mit einer Art »Hirnschrittmacher« elektrisch zu reizen. Das Verfahren nennt sich tiefe Hirnstimulation; es kommt bereits erfolgreich bei der Behandlung der Parkinsonkrankheit zum Einsatz. Möglicherweise eignet es sich auch zur Therapie bestimmter kognitiver Fehlfunktionen. »Dieser Ansatz könnte in Zukunft eine große Rolle in der Psychiatrie spielen«, meint Kastner. Die Forschung dazu stecke allerdings bisher in den Kinderschuhen: »Bis zur klinischen Anwendung ist es noch ein langer Weg.«
Lange Zeit nahm man an, die höheren kognitiven Fähigkeiten seien ausschließlich in der Großhirnrinde verortet. Doch die Tage jenes »neokortikalen Chauvinismus« (so Tobias Staudigl) sind vermutlich gezählt. Je besser die Studienlage wird, desto stärker zeigt sich, wie wichtig die rätselhafte Kammer im Zwischenhirn für Denkprozesse ist – und wie divers zugleich die Aufgaben sind, die sie übernimmt. »Von dem Thalamus zu reden, als wäre er eine einheitliche Region, ist Quatsch«, betont Staudigl. »Er besteht aus vielen Kernen, die mit ganz unterschiedlichen Hirnregionen vernetzt sind und entsprechend vielfältige Funktionen haben. Ich sage immer: Der Thalamus ist ein Gehirn im Gehirn.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.