Sterben: »Nach drei Minuten setzt sich eine riesige Welle in Gang«
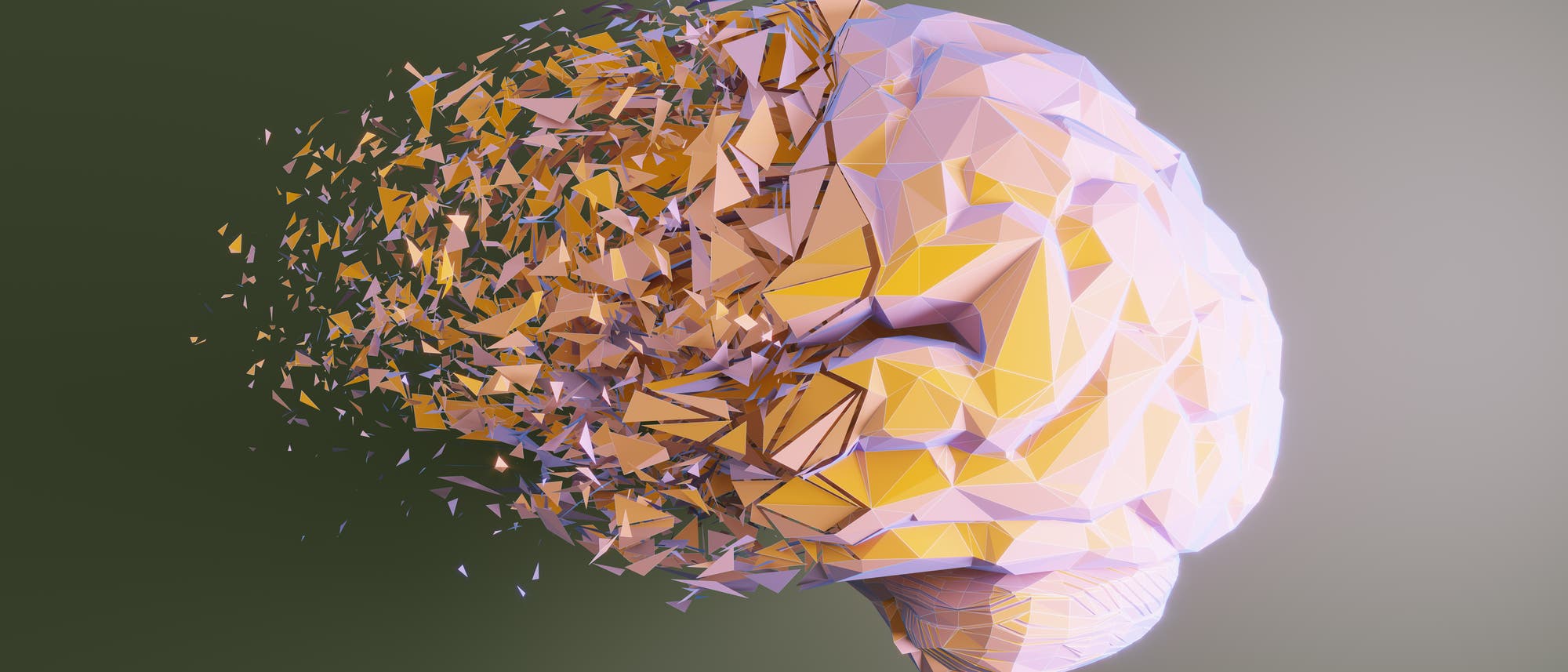
Außerkörperliche Erfahrungen, ein helles Licht am Ende des Tunnels: Darüber, was Menschen erleben, wenn sie sterben, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur spekulieren. Was kurz vor dem Tod im Gehirn passiert, ist inzwischen hingegen gut untersucht. Der Neurologe Jens Dreier erklärt im Interview, wie man die physiologischen Vorgänge während des Sterbens erforscht – und was sie mit Schlaganfällen und Migräneauren gemeinsam haben.
Herr Dreier, Sie erforschen das Gehirn zwischen Leben und Tod. Wie, glauben Sie, fühlt es sich an zu sterben?
Das hängt natürlich stark davon ab, warum man stirbt. Haben wir keine Schmerzen, merken wir den Übergang vielleicht gar nicht. Möglicherweise ist es dann so wie beim Einschlafen. Oder wir besitzen noch eine Art Bewusstsein und befinden uns vorübergehend in einem traumähnlichen Zustand, den wir aber für die Wirklichkeit halten. Das wäre so etwas wie eine Nahtoderfahrung.
Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es zum Todeserleben?
Unser Wissen dazu basiert ausschließlich auf Interviews: Menschen, die dem Tod nur knapp entgangen sind, etwa weil sie reanimiert wurden, berichten von ihren Erlebnissen. Allerdings haben nur die wenigsten solche Erinnerungen, weshalb die Datenlage relativ dünn ist. In der Forschung gibt es Skalen, anhand derer man bestimmt, ob etwas eine Nahtoderfahrung war oder nicht. Ich finde das jedoch nicht ganz unproblematisch, weil die Erlebnisse nur bedingt standardisierbar sind. Wenn jemand von seinen Erfahrungen berichtet, sollte man das meiner Meinung nach erst einmal so zur Kenntnis nehmen.
Was sind typische Nahtoderfahrungen?
Es gibt einige wiederkehrende Muster, etwa das Gefühl, sich gleichzeitig in verschiedenen Epochen und an verschiedenen Orten zu befinden. Häufig entstehen auch abstrakte Sinneseindrücke, zum Beispiel ein helles Licht oder eine Verengung des Sichtfelds – als würde man durch einen Tunnel laufen. Manche erzählen zudem von außerkörperlichen Erfahrungen.
Vergleichbare Empfindungen treten manchmal in völlig anderen Situationen auf.
Ja, ganz selten passiert das beispielsweise während chirurgischer Operationen. Ein Patient befindet sich in Narkose, und es tritt eine kritische Situation ein, etwa ein Kreislaufzusammenbruch. Einige berichten anschließend von Nahtoderfahrungen. Aber auch in nicht lebensbedrohlichen Situationen kann das vorkommen.
Zum Beispiel?
Sie sitzen im Opernhaus und hören einer Arie zu. Plötzlich driften Sie in Träume ab, die Sie jedoch als real erleben. Experten nennen dieses Phänomen REM-Intrusion. Dabei handelt es sich um eine in eine Wachphase eingebettete Schlafphase, die man selbst nicht als solche wahrnimmt. Besonders häufig passiert das beim Krankheitsbild der Narkolepsie.
ist Professor am Centrum für Schlaganfallforschung Berlin (CSB) und Oberarzt der Neurologischen Klinik der Charité. Seine Arbeitsgruppe erforscht unter anderem Schlaganfälle, die nach einer bestimmten Form von Hirnblutung, der Subarachnoidalblutung, auftreten. Die Untersuchungen sind Teil der internationalen Co-Operative Studies on Brain Injury Depolarizations (COSBID) und beschäftigen sich mit so genannten Spreading Depolarizations – großen Aktivitätswellen, die bei verschiedenen Hirnerkrankungen, aber auch beim Sterben entstehen.
Dennoch spricht man hier von Nahtoderlebnis?
Es gibt ein Set von sich ähnelnden Erfahrungen, die über Skalen definiert sind, jedoch in unterschiedlichen Kontexten auftreten können. Nur bei Reanimationen kommen sie wirklich gehäuft vor. Deshalb spricht man meist von Nahtoderlebnissen, wenn man diese Bewusstseinszustände meint.
Das ganze Feld hat einen anekdotischen Charakter, was den wissenschaftlichen Zugang dazu erschwert. Aber die Fülle an Berichten deutet darauf hin, dass es solche Erfahrungen wirklich gibt. Sie kommen übrigens auch in verschiedenen Kulturen vor und hängen nicht von bestimmten Religionen ab. All das lässt auf ihre Existenz schließen.
Besser untersucht sind die physiologischen Vorgänge während des Sterbens. Was passiert dabei im Gehirn?
Nehmen wir mal den einfachsten Fall: Jemand erleidet einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Wenige Sekunden nachdem das Herz stehen geblieben ist, sinkt die Sauerstoffkonzentration im Gehirn. Die Nervenzellen wechseln in einen Sparmodus, wodurch die neuronale Aktivität massiv gedrosselt wird. Nach etwa sieben bis acht Sekunden verliert der Betreffende das Bewusstsein; nach 30 bis 40 Sekunden ist die gesamte Hirnaktivität erloschen. Allerdings hängt der genaue Zeitpunkt vom Ausmaß der Restdurchblutung ab.
Sterben die Nervenzellen dann schon ab?
Nein. Zuerst kommt eine Phase ohne Aktivität, in der die Neurone lediglich gehemmt, aber noch lebendig sind. Sobald die Durchblutung erneut einsetzt, arbeiten sie wieder normal. Experten nennen den Zustand Hyperpolarisation.
Können Sie das genauer erläutern?
Nervenzellen haben ein so genanntes Membranpotenzial, sie sind »polarisiert«. Die Innenseite der Zellmembran ist im Ruhezustand normalerweise negativ geladen; es liegt gegenüber der Außenseite eine Spannung von –70 Millivolt an. Man muss sich das vorstellen wie eine geladene Batterie. Während eines Nervenimpulses depolarisieren die Zellen. Die Innenseite wird folglich kurzzeitig positiv, um anschließend wieder zu repolarisieren, das heißt in den Ausgangszustand zurückzukehren. Wenn die Sauerstoffversorgung abbricht, passiert aber Folgendes: Die Zellen hyperpolarisieren. Sie werden also noch negativer, als sie es ohnehin schon sind. Aus diesem sehr negativen Zustand können sie nicht mehr erregt werden, obwohl die Batterie noch voll geladen ist.
Was passiert dann?
Um die Hyperpolarisation aufrechtzuerhalten, braucht die Zelle immer noch ein bisschen Energie. Der Körper produziert diese normalerweise aus Glukose und Sauerstoff. Gibt es nicht mehr genug davon, können die Membranpumpen, die das Spannungsgefälle erzeugen, nicht mehr arbeiten. Nach ein paar Minuten entsteht eine riesige Depolarisationswelle, auch »terminal spreading depolarization« genannt, bei der sich die Nervenzellen ähnlich wie bei einem Kurzschluss nacheinander entladen. Wir haben sie 2018 erstmals beim Menschen nachgewiesen. Die Lichterscheinungen kurz vor dem Tod könnten auf diesen pathophysiologischen Prozess zurückgehen.
Welche Teile des Gehirns durchläuft die Welle?
Sie beginnt in der Regel an bestimmten vulnerablen Punkten der Hirnrinde und breitet sich mit einer Geschwindigkeit von schätzungsweise drei Millimetern pro Minute über das gesamte Gehirn aus. Dabei wandert sie durch alle Bereiche, in denen die Nervenzellkörper sitzen. Dazu gehören neben der Hirnrinde beispielsweise die Basalganglien, das Kleinhirn und sogar Strukturen im Rückenmark.
Manche sprechen auch von einer Todeswelle. Läutet sie letztlich den Hirntod ein?
Tatsächlich bewirkt sie massive Veränderungen im Inneren der Nervenzellen: Alle möglichen Moleküle werden wild durcheinandergewirbelt. Beispielsweise steigt die Konzentration von Kalzium um das 1000-Fache an. Wenn das zu lange andauert, werden die Neurone vergiftet und sterben. Das Erstaunliche jedoch ist, dass sie diesen Zustand für eine gewisse Zeit aushalten. Sofern die Membranpumpen wieder einsetzen und alles, was nicht ins Innere gehört, herausbefördern, überleben die Zellen.
Wann muss spätestens mit der Reanimation gestartet werden, damit die Pumpen wieder anspringen?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von der Temperatur und dem Lebensalter. Nehmen wir an, wir haben einen sonst gesunden jungen Menschen bei Zimmertemperatur. Vom Herzstillstand bis zum Einsetzen des Nervenzelltods dauert es schätzungsweise fünf Minuten. Bereits nach zirka drei Minuten setzt sich die riesige Welle in Gang. Sobald aber jemand reanimiert, also ordentlich aufs Herz drückt, werden Körper und Gehirn leicht durchblutet. Dann halten die Nervenzellen deutlich länger durch.
Wie haben Sie die Welle kurz vor dem Tod entdeckt? Dazu mussten Sie ja die Hirnaktivität genau in dem Moment erfassen, in dem eine Patientin oder ein Patient gestorben ist.
Das war Zufall. Die eigentliche Motivation für unsere Untersuchungen war es, Menschen mit einer bestimmten Form von Hirnblutung zu helfen. Die Depolarisationswellen treten nämlich nicht nur beim Sterben auf, sondern auch bei Schlaganfällen. Mit meinem Team an der Charité in Berlin untersuche ich so genannte Subarachnoidalblutungen. Sie entstehen, wenn eine Aussackung eines Hirngefäßes platzt. Oft stoppt die Blutung vorübergehend. Dann haben Neurochirurgen oder Neuroradiologen die Chance, die Aussackung sicher zu verschließen, so dass die Gefahr einer weiteren Blutung gebannt ist. Allerdings sind die Patienten damit leider noch nicht über den Berg. Denn das geronnene Blut liegt nun auf der Hirnoberfläche und löst oft etwa eine Woche später Schlaganfälle durch eine Mangeldurchblutung aus.
Und die wollten Sie mit Ihren Messungen aufspüren?
Genau. Die Patienten liegen nämlich in der Regel im Koma auf der Intensivstation, wo man sie nur sehr eingeschränkt neurologisch untersuchen kann. Deshalb passieren diese verzögerten Schlaganfälle meist unbemerkt. Wie beim Sterbeprozess treten hierbei aber auch die Depolarisationswellen auf. Erfasst man die neuronale Aktivität mit auf der Hirnoberfläche aufliegenden Elektroden, erkennt man anhand der Wellen, wenn der Betreffende einen Schlaganfall erleidet. So können wir rechtzeitig therapeutisch eingreifen.
Das heißt, bei einem Hirnschlag passiert das Gleiche im Gehirn wie beim Sterben?
Die »spreading depolarization« folgt hier ähnlichen Prinzipien wie jene kurz vor dem Tod. Ein wichtiger Unterschied ist, dass der Energiemangel beim Schlaganfall nur lokal auftritt, beim Sterben aber global.
Ähnlich wie die Nahtoderfahrungen tritt die Depolarisationswelle auch in Situationen auf, die nicht lebensbedrohlich sind. Welche sind das?
»Die Welle ist größer als jeder epileptische Anfall – sowohl bei der Migräneaura als auch kurz vor dem Tod«
Ein Beispiel ist die Migräneaura. Hier konnten Wissenschaftler unter anderem per funktioneller Magnetresonanztomografie beobachten, wie sich die Welle im Gehirn ausbreitet. Bei einer Studie von 2001 gab es einen ganz amüsanten Hintergrund: Ein Team in Boston hatte einen Mitarbeiter, der jedes Mal beim Basketballspielen eine visuelle Migräneaura bekam. Er musste dann immer direkt vom Sportplatz in den Scanner. So konnte er während der MRT-Aufnahme berichten, in welchem Teil des Gesichtsfelds er die Aura wahrnimmt.
Es heißt, die Entladungswelle vor dem Tod sei riesig. Ist sie bei der Migräne auch so groß?
Ja, sie ist viel größer als jeder epileptische Anfall – sowohl bei der Migräneaura als auch kurz vor dem Tod! Bei Ersterer hinterlässt sie aber fast nie Folgeschäden.
Dem sterbenden Gehirn geht die Energie aus, so dass die Membranpumpen das Spannungsgefälle nicht mehr aufrechterhalten und die »spreading depolarization« entsteht. Aber wieso tritt das bei Migräne auf?
Wie schon erwähnt, passiert beim Schlaganfall – wenn ein Blutgefäß verstopft – das Gleiche wie beim Sterben, nur lokal. Das liegt am Energiemangel. Ein Teil der Migräneauren könnte die gleiche Ursache haben: Ein kleines Blutgerinnsel verschließt ein Gefäß und löst die Welle aus. Es ist aber so winzig, dass es sich wieder von allein auflöst und daher keinen Schaden anrichtet.
Ein persistierendes Foramen ovale (PFO), also ein kleines Loch zwischen den beiden Herzvorhöfen, geht bei Erwachsenen häufiger mit Schlaganfällen einher. Nun deuten Studien darauf hin, dass auch Migräne mit Aura bei Menschen mit PFO öfter auftritt. Das würde Ihre Theorie zur Ursache stützen.
Ja, das stimmt. Durch das Loch entsteht eine Art Kurzschluss: Sauerstoffarmes, venöses Blut fließt statt in die Lunge direkt zur anderen Seite des Herzens und gelangt mitsamt etwaigen Gerinnseln von dort ins Gehirn. Manchmal können wir sogar ganz kleine Schlaganfälle nach einer Migräneaura feststellen. Erst kürzlich hatten wir so einen Fall: Ein Kollege von mir war sich sicher, dass es sich bei den Symptomen eines Patienten um eine Migräneaura handeln musste. Vorsichtshalber machten wir ein MRT und sahen drei Pünktchen im Gehirn, also drei winzige Schlaganfälle. Die einzige Ursache, die wir fanden, war ein offenes Foramen ovale.
Könnte man Migräne mit Aura also behandeln, indem man das Loch im Herz verschließt?
Das hat man tatsächlich versucht. Aber es funktioniert offenbar nicht bei allen Betroffenen, denn es gibt noch viele andere Auslöser für die Welle, die größtenteils noch nicht verstanden sind. Zum Beispiel gehen bestimmte angeborene Störungen im Nervenzell- oder Astrozytenstoffwechsel mit dieser Migräneform einher, was mit Gefäßproblemen nichts zu tun hat. Der Prozess der »spreading depolarization« kann übrigens sogar ganz ohne typischen Blutkreislauf auftreten: bei Grashüpfern und Kakerlaken etwa. Er ist stammesgeschichtlich sehr alt.
Manche glauben, die Entladungswelle beim Sterben könnte das physiologische Pendant zu den visuellen Erscheinungen beim Nahtoderleben sein. Haben wir alle vor dem Tod eine große Migräneaura?
Ich wäre da vorsichtig. Ein Kollege von mir an der Universität Kopenhagen hat mittels internetbasierter Umfragen untersucht, ob Menschen mit Migräneauren eher zu Nahtoderfahrungen neigen. Demnach gibt es tatsächlich eine Assoziation. Allerdings sind das lediglich vage Hinweise. Meine Gruppe von der Charité führt im Moment gemeinsam mit dem Kopenhagener Team eine weitere Studie zum Thema durch, diesmal an Patienten der Kopfschmerz-Ambulanzen. Leider liegen die Ergebnisse noch nicht vor. Was aber vielleicht ebenfalls hilft, die Natur von Nahtoderlebnissen aufzuklären, sind bestimmte Drogen.
Warum das?
Es gibt Substanzen, die genau solche Erfahrungen auslösen. Die beiden wichtigsten sind Ketamin und Dimethyltryptamin (kurz: DMT). Das Interessante daran ist, dass sie die Depolarisationswellen hemmen. Möglicherweise setzt der Körper in Notsituationen ähnliche Stoffe frei, um die »spreading depolarization« zu verhindern oder hinauszuzögern. Die Nahtoderlebnisse könnten auf die Wirkung der »inneren Drogen« zurückgehen und nicht auf die Welle selbst. Erst das helle Licht wäre ein Hinweis darauf, dass bereits Teile des Gehirns von der Welle betroffen sind. Aber das ist natürlich reine Spekulation.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.