Topologische Isolatoren: Wie Quantenphysik die Materialwissenschaft revolutioniert
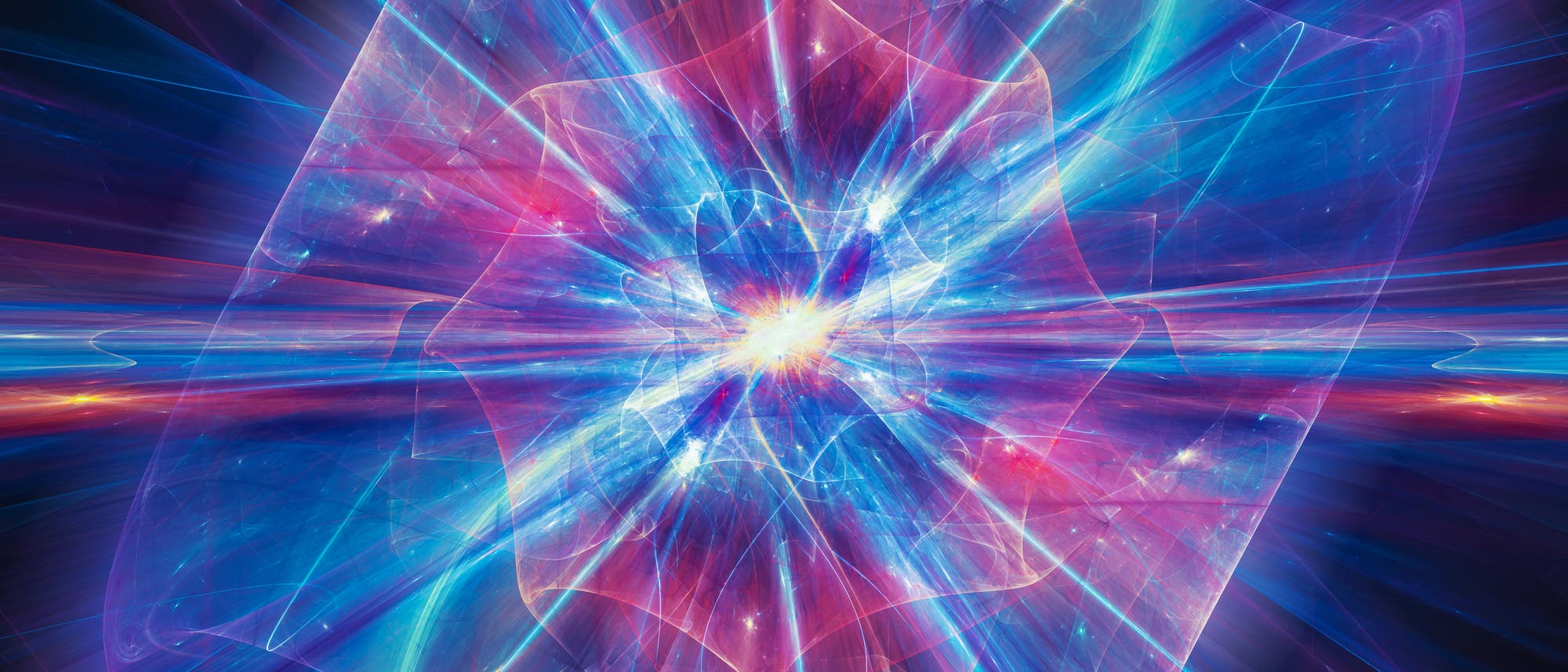
Im Jahr 1743 besuchte Benjamin Franklin eine unterhaltsame Vorführung elektrischer Phänomene in Boston. Der spätere Gründervater der Vereinigten Staaten war so begeistert davon, dass er beschloss, Elektrizität genauer zu erforschen. Während seiner Untersuchungen beobachtete Franklin, dass es offenbar zwei Arten von Materialien gibt: Leiter, in denen sich Ladungen frei bewegen, und Isolatoren, durch die kein Strom fließt.
Die Entdeckung ermöglichte eine der wichtigsten Erfindungen des 18. Jahrhunderts, den Blitzableiter. Zwei Jahrhunderte später rückten dann plötzlich Halbleiter ins Rampenlicht, deren elektrische Leitfähigkeit gesteuert werden kann. Inzwischen bilden sie die Grundlage für Technologien wie Computer und Smartphones, die zur Basis des Informationszeitalter wurden.
Verborgener Schatz der Quantentheorie
Maßgeblich für diesen Fortschritt ist ein tieferes Verständnis der Quantenmechanik, die unter anderem erklärt, wie Materie im Inneren aufgebaut ist. Isolatoren leiten beispielsweise keinen Strom, weil ihre Elektronen eine Barriere – eine so genannte Energielücke – überwinden müssen, um sich frei zu bewegen. In Leitern gibt es hingegen keine Energielücke, so dass Strom durch sie hindurchfließen kann.
Lange dachten Physiker, das sei das Ende der Geschichte. Doch die Quantentheorie der Festkörper enthält einen verborgenen Schatz, den Forscher erst in den vergangenen Jahren entdeckt haben: Es gibt verschiedene Varianten von Isolatoren, die sich durch die abstrakten Prinzipien der Topologie unterscheiden lassen. So stießen Forscher auf eine neuartige Materialklasse, die vorher undenkbare Technologien ermöglichen könnte, die so genannten topologischen Isolatoren.
Die Energielücke in Festkörpern eröffnet einen neuen Blickwinkel auf Materialien: So kann man sich beispielsweise vorstellen, dass man die atomare Zusammensetzung oder die Anordnung der Atome nach und nach verändert. Das Ergebnis ist meist ein anderes Material mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften. Aber so lange sich die Energielücke nicht schließt, bleibt der neue Stoff ein Isolator.
Das gemächliche Verschieben der Objekteigenschaften ähnelt dem Vorgehen in der Topologie, einem Gebiet der Mathematik. Hier verformen Experten Schritt für Schritt geometrische Objekte, ähnlich einem Kindergartenkind, das mit Knete hantiert. Aus Sicht eines Topologen sind zwei geometrische Objekt gleich, solange sie sich reibungslos ineinander verformen lassen. Ein Donut lässt sich beispielsweise problemlos in eine Tasse verwandeln, denn beide haben nur ein Loch.
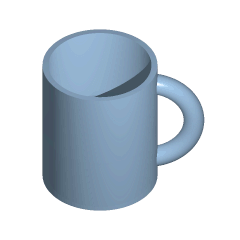
Verblüffenderweise gibt es Isolatoren, die sich nicht problemlos in eine andere isolierende Materialzusammensetzung überführen lassen, ohne dass während des Vorgangs die Energielücke verschwindet. Irgendwo auf dem Weg wird aus dem Stoff zumindest kurzzeitig ein elektrischer Leiter. Experten sprechen in diesem Fall von einem »topologischen Isolator«. Er unterscheidet sich topologisch gesehen deutlich von einem gewöhnlichen Isolator, lässt sich also nicht ohne große Umbrüche in diesen umwandeln.
Die Unterschiede zwischen den zwei Stoffen zeigen sich vor allem, wenn man sie zusammenbringt. Berühren sich beide Materialien, dann verschwindet die Energielücke irgendwo zwischen ihnen, der Grenzbereich leitet also Storm, während das Innere der Körper nach wie vor isolierend ist. Das ist der Fall, wenn ein topologischer Isolator von Luft umgeben ist, die einen gewöhnlichen Isolator darstellt. In diesem Fall wird die Oberfläche des besonderen Körpers leitend, während in seinem Inneren überhaupt kein Strom fließen kann.
Neuinterpretation eines alten Phänomens
Diese besondere Eigenschaft zeigt sich bei einem Phänomen, das der deutsche Physiker Klaus von Klitzing bereits 1980 beobachtete. Damals untersuchte er Elektronen, die zwischen zwei Halbleitern eingeklemmt sind und sich somit nur auf einer zweidimensionalen Fläche bewegen können, und setzte den Aufbau einem extrem starken Magnetfeld aus. Als er das Feld einschaltete, schwirrten die Elektronen plötzlich nur noch entlang des Rands der zweidimensionalen Fläche. Dieser so genannte Quanten-Hall-Effekt brachte von Klitzing 1985 den Nobelpreis für Physik ein.
Heute können Physiker den Effekt elegant erklären: Die Grenzfläche zwischen den Halbleitern wird im Magnetfeld zu einem Isolator, während der Rand leitet, genau so wie bei topologischen Isolatoren. Es handelt sich dabei jedoch um eine besondere Form der Leitung. In herkömmlichen Metallen schränken ständige Kollisionen mit anderen Teilchen die freien Elektronen ein. Die Situation ist wie die einer Person, die zur Hauptverkehrszeit durch einen überfüllten Bahnhof rennt, um einen Zug zu erwischen. Sie wird ständig abgebremst und stößt unter Umständen sogar mit anderen Passanten zusammen. Der Rand eines Quanten-Hall-Systems verhält sich anders. Er ähnelt einer Einbahnstraße, auf der Pendler ohne Gegenverkehr vorankommen.
Anschaulich gesehen ruft ein Quanten-Hall-System eine leitende Bahn am Rand hervor, der Elektronen nur in einer Richtung folgen können. Das isolierende Innere trennt die zwei entgegengesetzten Einbahnstraßen voneinander, in die eine Richtung geht es nur auf der linken, in die andere nur auf der rechten Seite der Grenzschicht (siehe Bild). Interessanterweise können einspurige (»unmögliche«) Leiter niemals isoliert auftreten, ein Rückweg in umgekehrter Richtung muss immer existieren, auch wenn dieser räumlich getrennt von der anderen Spur ist.
Das große Interesse an topologischen Materialien nahm massiv zu, als Physiker feststellten, dass nicht bloß die sehr exotischen Quanten-Hall-Systeme elektrische Leiter »halbieren« können. Auch andere Festkörpersysteme ermöglichen »unmögliche« Leitungsbahnen an ihren Rändern, und dabei sind weder spezielle Halbleiteranordnungen noch äußere Magnetfelder nötig. Wie sich herausstellte, gibt es sogar dreidimensionale Körper, bei denen dieses Phänomen auftritt; hier wird statt dem Rand die Oberfläche leitend.
Diese Einsicht hat zu einem regelrechten Boom in der Festkörperphysik geführt: Theoretische Physiker suchen mit großem Eifer nach Kristallstrukturen, die sich als topologische Isolatoren entpuppen könnten. 2018 erkannten mehrere Teams, dass die besonderen Stoffe gar nicht so rar sind, wie Wissenschaftler bisher annahmen. In einer der Arbeiten identifizierten Forscher unter 40 000 Kristallstrukturen etwa 8000 Kandidaten für dreidimensionale topologische Isolatoren.
Innen Isolator, außen Leiter
Auch sie weisen leitende Oberflächen auf, deren Eigenschaften denen von einspurigen Leitern in Quanten-Hall-Systemen ähneln. Das macht topologische Isolatoren für praktische Anwendungen attraktiv. Zum Beispiel könnte das Problem der Wärmeabfuhr bei kleinen Computerchips durch die neuen Wunderstoffe gelöst werden. Die Aufteilung in einspurige Bahnen könnte den Stromfluss in immer kleineren elektrischen Schaltungen organisieren, wodurch sich die Wärme auch kontrollierter abgeben ließe.
Neben den Anwendungen in der Elektronikindustrie, gibt es ein ehrgeizigeres – und spekulativeres – Einsatzgebiet für topologische Isolatoren: Sie könnten zu neuartigen Quantencomputern führen.
Herkömmliche Computer führen logische Operationen mit Bits durch: Sie bilden binäre Zahlen aus Nullen und Einsen. Der quantenmechanische Mechanismus der Überlagerung ermöglicht es dagegen, dass ein Quantenbit (kurz Qubit) die Werte null und eins auch gleichzeitig annehmen kann. Während eine Reihe von N gewöhnlichen Bits eine einzelne N-stellige Binärzahl darstellt, entsprechen N Qubits allen N-stelligen Binärzahlen gleichzeitig. Ein Quantencomputer könnte dadurch bestimmte Rechenaufgaben schneller durchführen als ihre klassischen Analoga.
Allerdings sind Quantencomputer schwer herzustellen. Das liegt daran, dass Qubits äußerst empfindlich sind. Misst man ein Qubit, verliert es seine quantenmechanischen Eigenschaften und nimmt einen festen Wert null oder eins an. Daher muss man sicherstellen, dass sich der Quantencomputer während einer Berechnung nicht versehentlich selbst misst. Das macht den Bau dieser Geräte zu einer der größten technischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Eine Möglichkeit wäre, die Qubits räumlich voneinander zu isolieren, was aber sehr aufwändig ist. Topologische Materialien könnten einen alternativen Ansatz liefern. Die Idee besteht darin, ein Qubit aufzuteilen, so wie ein topologischer Isolator einen elektrischen Leiter in zwei Teile spaltet. Theoretische Physiker haben herausgefunden, dass ein eindimensionaler »topologischer Supraleiter« einen Qubit halbiert, der dann an beiden Enden des Materials auftritt. Daher kann eine lokale Störung an einem Ende des topologischen Supraleiters dem halbierten Teilchen nichts anhaben, man müsste dazu schon beide Enden gleichzeitig stören. Das Qubit ist damit immun gegen unbeabsichtigte Messungen beziehungsweise Störungen von außen.
Der perfekte Quantencomputer
Topologische Supraleiter bestehen üblicherweise aus einem gewöhnlichen Supraleiter, den man auf einem topologischen Isolator aufträgt. Inzwischen haben Forscher einige solcher Stoffe im Labor getestet. Doch der endgültige Nachweis, dass sie Quanteninformationen auch wirklich auf vorhergesagte Art speichern, bleibt eine schwierige Herausforderung – aber eine, die wahrscheinlich bald gelöst wird.
Diese zwei möglichen Anwendungen, welche die Halbleiterindustrie und Quantencomputer revolutionieren könnten, erklären jedenfalls das weiter ansteigende wissenschaftliche Interesse an den ungewöhnlichen Materialien. Noch gibt es viele Hürden, die es zu überwinden gilt. Häufig gehen aber gerade aus Problemen kreative neue Ideen und Anwendungen hervor. Als wir 2004 unsere Forschung in dem Gebiet begannen, die 14 Jahre später mit dem »Breakthrough Prize in Fundamental Physics« belohnt wurde, hatten wir keine Ahnung, dass die Welt der topologischen Materialien so breit gefächert ist. Doch wir haben unsere Lektion inzwischen gelernt: Man sollte immer das Unerwartete erwarten.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.