Kommunikation: Verbale Allzweckwaffe
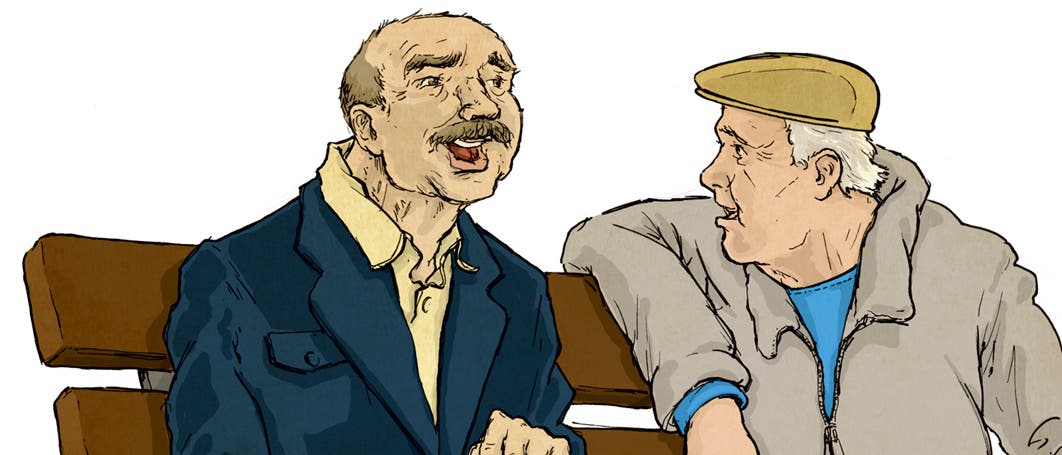
"Liebe Teilnehmerin, stellen Sie sich vor, Sie sind Single und Ihre neue Nachbarin flirtet bei jeder Gelegenheit mit einem Mann aus Ihrer Straße, in den Sie seit geraumer Zeit heimlich verliebt sind. Würden Sie beim Kaffeeklatsch mit einer Freundin über die Nachbarin lästern?"
Mit diesem Szenario konfrontierten die Sozialpsychologin Karlijn Massar von der niederländischen Universität Maastricht und ihre Kollegen 83 Probandinnen zwischen 20 und 50 Jahren. Das erstaunliche Ergebnis der 2012 erscheinenden Studie: Frauen lästerten umso eher über eine Rivalin, je höher sie ihren eigenen "Marktwert" einschätzten, gemessen etwa daran, wie häufig ihnen Männer Komplimente machten. Ob sie Single oder in festen Händen waren, machte keinen Unterschied. Anders als das Klischee von Tratschtanten beim Kaffeeklatsch vielleicht vermuten lässt, zogen jüngere Probandinnen außerdem öfter vom Leder als ältere. Aber als die Forscher Frauen mit gleichem gefühltem "Marktwert" verglichen, spielte das Alter keine Rolle mehr. Die subjektive Anziehungskraft auf Männer verriet sogar mehr über ihre Klatschfreudigkeit als das Alter.
Ist Tratschen also ein charakterliches Defizit von Frauen, die sich für etwas Besseres halten? Oder doch nur ein harmloser, unterhaltsamer Zeitvertreib?
Bedenkliche Lästermäuler
Klatsch hat ein Imageproblem: Die meisten Menschen stehen ihm mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits interessiert es uns schon, welcher Kollege ein Alkoholproblem hat, wer seinen Partner betrügt und wer mit welchem Promi per Du ist. Andererseits würden wir nicht wollen, dass andere unsere Privatangelegenheiten kommentieren, schon gar nicht hinter unserem Rücken. Klatsch oder Tratsch – ein Gespräch über einen abwesenden Dritten mit wertender Note – kann sogar Freundschaften zerstören, vor allem, wenn das böse Stiefkind der Tratschtante am Werk ist: das Lästermaul, das über Eigenarten, Misserfolge und andere Unzulänglichkeiten von Mitmenschen herzieht.
Diese moralisch bedenkliche Seite macht Psychologen die Erforschung des schwer greifbaren Phänomens nicht leicht. Denn wer Probanden um Selbsteinschätzungen per Fragebogen oder Tagebuch bittet, muss damit rechnen, dass die Antworten geschönt sind. So mancher Befragte spielt mehr oder minder bewusst seine eigene Tratscherei herunter, um sich vorteilhaft darzustellen.
Experimente umgehen dieses Problem, indem sie negative Kommentare oder ganz allgemein Tratsch über Mitspieler oder Versuchsleiter zu provozieren versuchen. Doch derart gewonnene Daten lassen sich nicht ohne Weiteres auf Situationen außerhalb des Labors übertragen. Um unverfälschte Ergebnisse zu erhalten, bevorzugen manche Wissenschaftler deshalb die Feldforschung. Sie belauschen Restaurantbesucher und Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln, protokollieren den Flurfunk im Büro oder schleusen sich gar in eine Stammesgesellschaft ein. Eine aufwändige Methode, denn sie müssen sich erst einmal das Vertrauen ihrer unfreiwilligen Probanden erwerben, bevor sie damit rechnen können, mit Klatsch und Tratsch versorgt zu werden.
"Menschen finden andere Menschen einfach so spannend, dass sie über sie reden"Paul Bloom
In solchen Feldstudien beobachteten verschiedene Forscher in den 1990er Jahren, dass sich der Löwenanteil der Gespräche zwischen Erwachsenen um deren eigene Angelegenheiten drehte und erst an zweiter Stelle um die von abwesenden Dritten. Nur in fünf Prozent der Zeit äußerten sich die unfreiwilligen Forschungsobjekte deutlich negativ. Dabei kam es auch auf den Kontext an. Wenn sich beispielsweise Kollegen in der Pause treffen, hat demnach etwa jedes siebte Gespräch einen negativen Beigeschmack.
Jungs tratschen anders
Kinder stehen Erwachsenen dabei in nichts nach. Jungs ebenso wie Mädchen tratschen im Schnitt 18-mal pro Stunde, berichteten die Psychologen Jeffrey Parker und Stephanie Teasley von der University of Michigan in Ann Arbor 2006. Sie hatten Videoaufnahmen von Kindern zwischen neun und zwölf Jahren in einem Sommercamp ausgewertet. Die Schüler ließen sich dreimal häufiger über Angehörige des eigenen als des anderen Geschlechts aus. Während enge Freundinnen am meisten tratschten – und zwar besonders gerne über ihren Schwarm –, führten männliche Kumpels solche Gespräche eher selten und schon gar nicht über ihre weiblichen Favoritinnen.
Ähnliche Geschlechtsunterschiede zeigten sich auch in zahlreichen Studien mit erwachsenen Probanden. Männer bewegen sich demnach lieber auf emotional ungefährlichem Terrain. Sie unterhalten sich zum Beispiel über Prominente wie Sportler und Politiker, die sie aus dem Fernsehen kennen, oder über entfernte Bekannte. Frauen reden am häufigsten über nahe Angehörige wie Freunde und Verwandte.
Verbale Parasitenjagd
Wesentlich kniffliger zu erfassen sind Sinn und Zweck des Austauschs. Der Psychologe Paul Bloom von der Yale University in New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) glaubt, dass der so genannte gossip (englisch für Klatsch und Tratsch) im Allgemeinen kein spezielles Ziel verfolgt.
"Menschen finden andere Menschen einfach so spannend, dass sie über sie reden", meint er. Und wie der Smalltalk übers Wetter könne auch Klatsch allerlei Zwecken dienen. Diese minimalistische Erklärung verträgt sich laut Bloom durchaus mit der Annahme, Talent im Tratschen habe Menschen einst einen evolutionären Vorteil verschafft. Die These fußt auf einer grundlegenden Annahme: "Was so tief im menschlichen Verhalten verankert ist, dient der sozialen Fitness", meint beispielsweise der britische Anthropologe Robin Dunbar von der University of Liverpool.
Wer etwa potenzielle Rivalen treffsicher zu identifizieren weiß und dieses Wissen mit Verbündeten teilt, der genieße besonderen Respekt im zwischenmenschlichen Zusammenleben. Für den sozialen Kitt zwischen Gruppenmitgliedern sorgte bei unseren Vorfahren vermutlich das wechselseitige Lausen, das so genannte grooming, das Forscher heute noch bei Affen beobachten. Während der Fellpflege schütten die Tiere Endorphine aus, ihre Herzschlagrate sinkt, und sie entspannen sich.
Doch mit steigender Gruppengröße (im Kampf gegen Feinde ein Überlebensvorteil) beanspruchte die nötige wechselseitige Fellpflege wohl zu viel Zeit. An ihrer Stelle habe sich der verbale Informationsaustausch als eine Art soziale Ersatzwährung etabliert; die Beteiligten bauen dabei Vertrauen zueinander auf und festigen ihre Beziehung.
Ein weiterer Vorteil für die Gruppe: Wie einst beim Lausen lassen sich "Parasiten" identifizieren – nicht die ungebetenen Gäste im Fell der Artgenossen, sondern die menschlichen Sozialschmarotzer. Und so halten wir es auch heute noch, wenn wir über einen Nachbarn schimpfen, der nie die Treppe putzt.
Ein Schwätzchen zwischendurch …
Wie effektiv Gruppentratsch egoistischen Entscheidungen Einzelner vorbeugt, demonstrierte schon Mitte der 1990er Jahre ein Team um die Politologin Elinor Ostrom, Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissenschaften von 2009 und heute Professorin an der Indiana University in Bloomington.
Die Forscher ließen Probanden am Computer Geld investieren und zahlten ihnen immer dann die Höchstsumme aus, wenn alle auf einem bestimmten Markt investierten. Scherte allerdings einer aus und investierte auf einem anderen Markt, bekam dieser zwar eine stattliche Summe, doch die anderen guckten in die Röhre. Das geschah so häufig, dass die Probanden im Schnitt nur 20 Prozent der maximal möglichen Auszahlung kassierten.
Ostrom und Kollegen variierten nun eine einzige Bedingung: Sie erlaubten den Teilnehmern eine Erfrischungspause, bei der sie miteinander sprechen konnten. Und siehe da, die Auszahlungsquote sprang auf 80 Prozent! Allein die Möglichkeit, dass andere schlecht über sie reden könnten, bewahrte die Gruppe vor den meisten egoistischen Alleingängen.
Allerdings müssen potenzielle Nutznießer dafür auch identifizierbar sein, stellten Jared Piazza und Jesse Bering von der Queen's University in Belfast 2008 fest. Ihre studentischen Versuchspersonen sollten jeweils zehn Lose mit einer Chance auf einen 100-Euro-Gewinn mit einem zweiten Probanden teilen. Die Hälfte glaubte, dass der Mitspieler ihre Entscheidung danach mit einem Dritten diskutieren könnte, mit dem sich wiederum ein Teil von ihnen zuvor bekannt gemacht hatte. Mit diesem Vorwissen gaben die Teilnehmer im Schnitt sogar mehr als fünf der zehn Lose ab. Die Probanden in den übrigen Bedingungen billigten ihren Mitspielern im Schnitt nur vier Scheine zu. Die Befürchtung, Zielscheibe von Klatsch und Tratsch zu werden, motiviert offenbar viele Menschen zu fairem oder gar altruistischem Verhalten.
Was uns der Märchenonkel lehrt
Das Entlarven von Schmarotzern kann die Gruppe aber auch auf anderem Weg stärken: als gesellschaftliches Lehrstück. Nach Meinung des Psychologen Roy Baumeister von der Florida State University in Tallahassee vermitteln Klatschgeschichten soziale Regeln und Normen. Das informelle Gespräch am Kaffeeautomaten etwa sei "die zentrale Informationsquelle für neue Mitarbeiter in einem Unternehmen"; auf diese Weise lernten sie die Gepflogenheiten an ihrem Arbeitsplatz am besten kennen.
Dasselbe gelte für Märchen und Bibelgeschichten, denn auch sie brächten moralische Werte und Verhaltensnormen unters Volk. Ohne die Konsequenzen eines Regelverstoßes am eigenen Leib erfahren zu müssen, lernten die Zuhörer aus den Erfahrungen der handelnden Personen in den Geschichten.
"Klatsch enthält wertvolle Lektionen darüber, wie man sich verhalten sollte", bestätigen Sarah Wert und Peter Salovey von der Yale University. Als Wurzel des menschlichen Klatschinstinkts betrachten die Psychologen aber ein eigennütziges Bedürfnis mit dem Ziel, persönliche Ansichten zu überprüfen, Bestätigung zu suchen und sich mit anderen zu vergleichen, etwa um sich als klüger darzustellen.
Wer sich zum Beispiel über Nachbars neuen Geländewagen wundere, füge gerne hinzu, dass er selbst das Geld lieber in ein Klavier für den Sprössling anlege. Aus solchen Vergleichen erwachse ein befriedigendes Gefühl eigener Überlegenheit und gemeinsamer Identität in Abgrenzung zu Dritten.
Die eigennützige Seite des Tratsches beobachteten auch Francis T. McAndrew und Megan A. Milenkovic vom Knox College in Galesburg (US-Bundesstaat Illinois). In einer Studie von 2002 legten die Psychologen Studierenden zwölf Arten von gossip vor, zum Beispiel über Drogenmissbrauch und eheliche Untreue. Den Tratsch bezogen sie jeweils auf Verwandte, Freunde, Bekannte, Fremde oder Professoren.
Die Befragten sollten angeben, wie stark sie sich dafür interessierten und wie wahrscheinlich es wäre, dass sie die Geschichte weitererzählen würden. Wie die Auswertung zeigte, bevorzugten die Probanden im Allgemeinen Tratsch über enge Bekannte. Weitererzählen wollten sie vor allem gute Neuigkeiten über Freunde und Verwandte, nicht aber unehrliches Verhalten wie Computerdiebstahl und Betrug.
Der einzige Fall, wo Freunde nicht das größte Interesse weckten, waren jene Themen, bei denen die Verwandtschaftsverhältnisse eine Rolle spielen könnten, nämlich bei einer Erbschaft und bei einer schweren Krankheit.
Frauen interessierten sich besonders für gleichaltrige Rivalinnen, und am stärksten dann, wenn es um Promiskuität und Untreue ging. Männer zeigten keine besonders ausgeprägte Vorliebe für den Tratsch über das eigene Geschlecht, es sei denn, der finanzielle Status oder die sexuelle Potenz eines anderen Mannes waren das Thema.
An der Informationsbörse
McAndrew und Milenkovic lesen aus ihren Daten eine egoistische Motivation ab. "Menschen suchen nach Informationen, die sich im sozialen Wettstreit für sie als nützlich erweisen können", so ihr Fazit. Das könnten bedeutsame Vorgänge in der Familie sein, potenziell schädliches Wissen über Rivalen oder statusförderliche Neuigkeiten über Freunde. Letztere stünden ganz natürlich im Fokus.
"Freunde sind unsere besten Verbündeten und wichtig für den sozialen Aufstieg, aber zugleich unsere größten Rivalen", glauben die Psychologen. Ihre Untersuchung zeigt beispielhaft, woran die Forschung zu Klatsch und Tratsch krankt: Die meisten Ergebnisse lassen sich ebenso im Sinn einer egoistischen wie auch einer sozialen Motivation deuten. Dass wir zum Beispiel Freunde vor übler Nachrede schützen wollen, muss nicht dem Eigennutz geschuldet sein, sondern kann auch auf besondere Anteilnahme und Sympathie hindeuten.
Befunde von Aggressionsforschern legen allerdings nahe, dass zumindest das Lästern als Sonderform des Tratsches eine indirekte Form von Gewalt darstellt und durchaus im Dienst der eigenen Durchsetzungskraft steht. So berichtete die Anthropologin Nicole Hess vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2006 gemeinsam mit einem US-Kollegen, dass Frauen in einem fiktiven Szenario eher dazu neigten, nach Verleumdung durch einen Kollegen ihrerseits mit bösem Klatsch zu antworten.
Zwar gaben die 255 studentischen Probandinnen und Probanden gleichermaßen an, am ehesten nach einem anderen Mittel greifen zu wollen, etwa den Chef über den wahren Sachverhalt aufzuklären. An zweiter Stelle wählten die Frauen jedoch üble Nachrede, während Männer zu körperlicher Gewalt tendierten. Lästern ist demnach eine vornehmlich weibliche Reaktion auf eine Provokation, vermutlich weil sie sich mit den Geschlechternormen eher vereinbaren lässt.
Zwei Seiten derselben Medaille
Dass physische und indirekte verbale Aggressionen ähnliche Funktionen erfüllen, demonstrierten auch die britische Psychologin Sarah M. Coyne von der University of Lancashire und ihre Kollegen in zwei Experimenten mit Schülern und erwachsenen Frauen.
In einer 2004 veröffentlichten Untersuchung präsentierten die Forscher 11- bis 14-jährigen Kindern zunächst ein Video, in dem sich ein Mädchen einer Clique anschloss und ihre bisherige Freundin dafür sitzen ließ. Diese reagierte darauf in der einen Filmversion mit indirekter Aggression, etwa indem sie über ihre ehemalige Freundin lästerte. In einer zweiten Fassung gab sie ihr beispielsweise eine Ohrfeige und rempelte sie an. Aber in jedem Fall vertrugen sich die beiden am Ende wieder; das aggressive Verhalten wurde also belohnt.
Nach der Videosession mussten alle Probanden eine schwierige Aufgabe lösen, wobei der Versuchsleiter ihr Bemühen herablassend kommentierte. Zum Schluss sollten die Schüler den Versuchsleiter in einem Fragebogen bewerten – angeblich, weil die Universität wissen wollte, wie gut er seine Arbeit gemacht hatte. Sollte er den Job behalten? Und wie viel Honorar (zwischen 1 und 100 Pfund) würden sie ihm zahlen?
Die Rache der Probanden
Wie eingangs erwähnt, setzen Forscher die negative Bewertung einer Person per Fragebogen mit Lästern gleich. Und das bestätigte auch dieser Befund: Welche Art von aggressivem Verhalten die Probanden im Film gesehen hatten, spielte keine Rolle. In beiden Fällen bewerteten sie den Versuchsleiter deutlich schlechter, als wenn sie in einer neutralen Kontrollbedingung Sportclips präsentiert bekamen. Auch das Honorar fiel unter diesen Bedingungen niedriger aus, nämlich 7 beziehungsweise 14 Pfund bei direkter und indirekter Aggression und 26 Pfund in der Kontrollgruppe, die den Sportfilm gesehen hatte. Es machte keinen Unterschied, ob die Probanden Mädchen oder Jungen, jünger oder älter waren, ob sie von ihren Mitschülern als mehr oder weniger aggressiv beschrieben wurden.
Ein ähnliches Ergebnis erhielten Coyne und Kollegen 2008 in einem Experiment mit rund 60 Studentinnen, die Ausschnitte aus Kinofilmen mit verbaler oder physischer Gewalt gesehen hatten, zum Beispiel Szenen aus Quentin Tarantinos "Kill Bill".
Sie absolvierten daraufhin einen frustrierenden Intelligenztest, wobei die Versuchsleiterin sie unter Druck setzte und ihre Ergebnisse abwertend kommentierte. Dann sollten sie einer Mitspielerin schlechte Reaktionszeiten per Tonsignal zurückmelden und schließlich noch Mitspielerin sowie Versuchsleiterin in einem Fragebogen bewerten. Egal, welche Form von Gewalt die Studentinnen zuvor in den Filmszenen gesehen hatten: Sie reagierten daraufhin stets aggressiver als jene, die das neutrale Video präsentiert bekommen hatten. Das äußerte sich sowohl im höheren Lautstärkepegel und der längeren Dauer des Tons, mit dem sie die Mitspielerin traktierten, als auch in ihrer negativeren Bewertung im Fragebogen. Die Versuchsleiterin kam in dem Bewertungsbogen hingegen nicht schlechter weg, obwohl es ja eigentlich sie war, die den Probandinnen Frust bereitet hatte. Stattdessen zielte der Ärger der Studentinnen allein auf die Mitspielerin. Offenbar übertrugen die Versuchsteilnehmerinnen ihre Aggressionen vom eigentlichen Übeltäter auf eine "schwächere" Zielscheibe.
Wie die Faust aufs Auge
Das zwiespältige Image des Tratschens hat also einen wahren Kern, denn hinter scheinbar harmlosen Worten verbergen sich mitunter Aggressionen. Demnach verrät Klatsch wohl weniger über sein Objekt als über den, der ihn verbreitet. Wer es damit übertreibe, riskiere gar "den sozialen Tod", glaubt denn auch Francis T. McAndrew. Mit einem Ruf als Lästermaul gewinne man keine Freunde und schon gar kein Vertrauen. Ist Klatsch also eine schlechte Strategie? Oder zahlt sie sich im Konkurrenzkampf trotzdem aus?
Sie zahlt sich tatsächlich aus – aber nur für jene, die in Sachen Attraktivität ohnehin im Vorteil sind. Dieses Fazit zogen Forscherteams um die Psychologin Maryanne Fisher von der Saint Mary's University im kanadischen Halifax aus Studien von 2009 und 2010. In den Augen männlicher Zuhörer verblassten die körperlichen Reize einer Frau nämlich tatsächlich, wenn andere, attraktive Frauen negative Kommentare über sie abgaben.
Die Klatschbasen selbst büßten hingegen nicht an Anziehungskraft ein; auch als kurz- oder langfristige Sexualpartner disqualifizierten sie sich nicht. Der Klatsch fiel aber insofern negativ auf sie zurück, als sie nicht mehr so freundlich und vertrauenswürdig erschienen.
Attraktive Jugendliche haben ebenfalls keine negativen Konsequenzen zu fürchten, wenn sie Gleichaltrige direkt oder indirekt attackieren. Das ergab ein Befund von Lisa Rosen und Marion Underwood von der University of Texas in Dallas aus dem Jahr 2010. Weniger attraktive Jugendliche, die tratschten, verloren dagegen an Popularität.
Diese Befunde erklären auch das erstaunliche Resultat aus der eingangs geschilderten Studie, dass Frauen mit einem hohen gefühlten "Marktwert" besonders gerne klatschen. Offenbar können sie es sich leisten – während die unattraktiveren damit ihren Ruf aufs Spiel setzen. Die unerfreuliche Moral dieser Geschichte: Um ungestraft tratschen zu dürfen, sollte man vor allem gut aussehen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.