Quantencomputer: Welche Qubit-Technologie macht das Rennen?
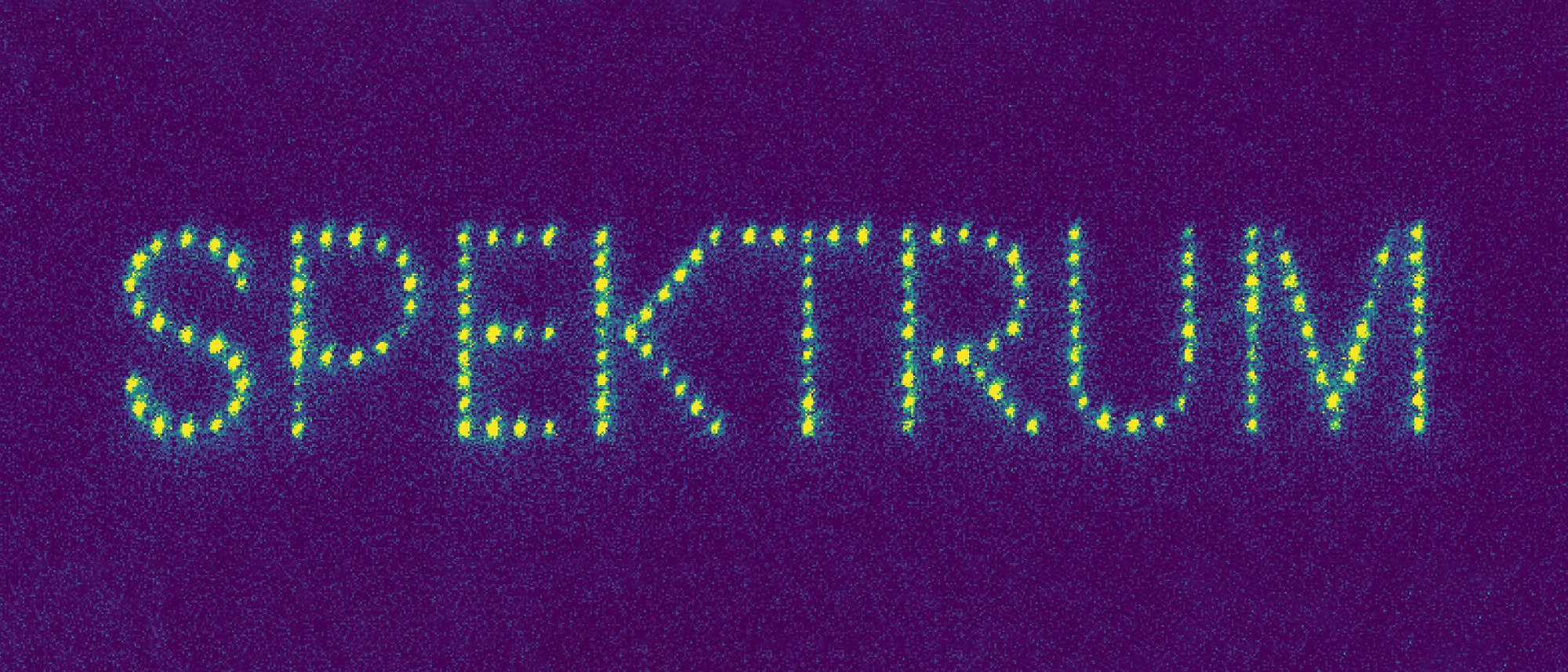
Dieser Artikel wurde erstmals im September 2024 veröffentlicht.
Wer an einen Quantencomputer denkt, hat oft das Bild eines Kryostaten vor Augen – jenen an einen Kronleuchter erinnernden Spezialkühlschrank, der fingernagelgroße Quantenchips auf annähernd -273 Grad Celsius bringt. Das beeindruckende Gebilde, das im Inneren aus unzähligen Kabeln und golden glänzenden Steckverbindungen besteht, hat es bereits in etliche Filme, Sciencefiction-Romane und Bilddatenbanken geschafft. Und das vor allem aus einem Grund: Lange Zeit sah es so aus, als würden Quantencomputer eines Tages aus einer Vielzahl von winzigen supraleitenden Schaltkreisen bestehen, die erst bei extrem tiefen Temperaturen ihr volles Potenzial entfalten. Doch längst zeigt sich, dass auch andere Quantensysteme als Qubits in Frage kommen – das sind die quantenmechanischen Pendants zu den Recheneinheiten im klassischen Computer. Einige davon machen den supraleitenden Schaltkreisen ernsthafte Konkurrenz. Ist die Ära der supraleitenden Qubits womöglich vorbei, bevor sie richtig begonnen hat?
Die Idee, einen Computer zu bauen, der auf den Gesetzen der Quantenmechanik basiert, stammt bereits aus den 1980er Jahren. Damals schlug der Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman vor, die Eigenheiten der mikroskopischen Welt zu nutzen, um damit quantenmechanische Probleme zu lösen, an denen selbst die fähigsten Supercomputer scheitern – etwa herauszufinden, was der energetisch günstigste Zustand eines bestimmten Materials ist oder wie einzelne Moleküle an andere andocken, um daraus neue Wirkstoffe zu gewinnen. Feynman hatte die Idee, dass sich ein Quantensystem wahrscheinlich am effektivsten durch ein anderes Quantensystem simulieren lässt – dieses besitzt nämlich bereits die quantenmechanischen Eigenschaften, die so schwer zu berechnen sind.
Ein solcher »Quantensimulator« ist aber noch kein vollwertiger Computer: Der Simulator kann nur eine bestimmte Aufgabe lösen, etwa den Grundzustand eines ganz bestimmten Materials ermitteln. Computer sind hingegen Maschinen, die jede Art von Berechnung durchführen können. Ein solches theoretisches Modell einer Quanten-Rechenmaschine entwickelte 1985 der Physiker David Deutsch, lange bevor jemals ein physisches Qubit realisiert wurde. Das Gerät sollte dabei wie ein klassischer Computer Informationseinheiten mit Hilfe von logischen Operationen verarbeiten.
Doch die Eigenschaften eines Quantencomputers unterscheiden sich grundlegend von denen eines gewöhnlichen Rechners. Während ein klassisches Bit nur den Schaltzustand 0 oder 1 annehmen kann (Strom an oder aus), kann ein quantenmechanischer Schalter gleichzeitig an und aus sein – und ebenso alles dazwischen. So gibt es bei nur einem einzigen Qubit bereits unendlich viele mögliche Zustände. Diese lassen sich durch die Punkte auf der Oberfläche einer Kugel visualisieren, der so genannten Bloch-Kugel: Die Pole entsprechen den klassischen Zuständen 0 und 1; jeder andere Punkt auf der Kugeloberfläche stellt eine Überlagerung daraus dar, zum Beispiel 40 Prozent Zustand 1 und 60 Prozent Zustand 0.
Mit jedem weiteren Qubit wächst die Menge an Zuständen exponentiell an. Zudem bieten die quantenmechanischen Informationseinheiten einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich miteinander verschränken. Hierbei sind die Zustände von mehreren Qubits gekoppelt; ist eines in Zustand 1, so ist es auch das andere und umgekehrt. Egal, wie weit man die Qubits voneinander entfernt, ihr Zustand ist aufeinander abgestimmt.
Allerdings sind überlagerte und verschränkte Zustände extrem empfindlich. Sobald die Qubits mit ihrer Umgebung wechselwirken, »kollabiert« ihr quantenmechanischer Zustand in einen klassischen: Sie entsprechen dann entweder einer Null oder einer Eins. Falls dies während einer laufenden Berechnung passiert, kommt es zu Fehlern. Daher müssen die Quantensysteme möglichst gut von ihrer Umgebung abgeschirmt werden.
Auch wenn die Idee für Quantencomputer bereits in den 1980er Jahren entstand, gab es noch keine eindeutigen Belege für ihre Überlegenheit gegenüber klassischen Rechnern – ganz abgesehen davon, dass eine Umsetzung in weiter Ferne lag. Deswegen widmeten Fachleute ihnen zunächst nur wenig Aufmerksamkeit. Das änderte sich schlagartig 1994, als der Mathematiker Peter Shor erstmals einen Quantenalgorithmus präsentierte, der ein relevantes Problem deutlich schneller als jedes klassische Programm lösen kann: Wie er bewies, sind Quantencomputer dazu in der Lage, selbst große Zahlen schnell in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Da viele Verschlüsselungsmethoden darauf aufbauen, dass herkömmliche Rechner solche Aufgaben nur sehr schlecht lösen können, sorgte das Ergebnis für Aufsehen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Quantenrechner eines Tages dabei helfen könnten, neue Materialien und Medikamente zu entwickeln sowie komplexe Probleme etwa im Banken- und Versicherungsbereich zu lösen.
Damit wuchs das Interesse an der futuristischen Technologie. Als die drei Physiker Peter Zoller, Ignacio Cirac und Rainer Blatt während einer Atomphysik-Konferenz in Boulder 1994 von den ersten Quantenalgorithmen hörten, entwickelten sie eine Idee, wie sich diese Geräte umsetzen lassen könnten. Schon ein Jahr später beschrieben Cirac und Zoller in einer theoretischen Arbeit eine mögliche Realisierung eines Quantencomputers durch gefangene Ionen. Kurz darauf konnten sie ihr Konzept zusammen mit Blatt experimentell verwirklichen: Sie hatten den ersten Prototypen eines Quantencomputers gebaut.
Dass es nicht nur eine einzige mögliche Bauart für Qubits gibt, stellte der US-amerikanische Physiker und Elektrotechniker David DiVincenzo bereits 1996 klar. Als eine Art Leitfaden für die mögliche Umsetzung formulierte der Quantencomputer-Pionier, der heute an der RWTH Aachen lehrt und forscht, fünf Kriterien, die ein skalierbarer, fehlertoleranter Quantencomputer zwingend erfüllen muss:
- Er muss Qubits enthalten, die sich in möglichst großer Zahl erzeugen lassen.
- Die Qubits müssen wiederholt jeden gewünschten Zustand einnehmen können, um eine Null, eine Eins oder eine beliebige Überlagerung daraus darzustellen.
- Das System braucht ausreichend lange »Kohärenzzeiten«, das heißt, die Qubits dürfen ihren überlagerten Zustand nicht zu schnell verlieren.
- Man braucht eine universelle Sammlung von Gattern, die jede beliebige Berechnung mit den Qubits ermöglichen. Dafür sind sowohl Gatter nötig, die einzelne Qubits manipulieren, als auch solche, die mit zwei Qubits arbeiten und sie beispielsweise miteinander verschränken.
- Man braucht eine Messvorrichtung, um den Zustand der Qubits am Ende einer Berechnung auszulesen.
Diese Kriterien lassen sich nicht nur mit Ionenfallen oder supraleitenden Schaltkreisen erfüllen, sondern auch mit Gitterdefekten in Diamanten, Elektronenspins in Halbleitern, neutralen Atomen und verschränkten Photonen – um nur die sechs vielversprechendsten Technologien zu nennen. Wie unterscheiden sie sich? Wie weit ist die Entwicklung? Und welche Bauart wird am Ende das Rennen machen?
Supraleitende Schaltkreise
Ginge es nur um die Anzahl der Qubits, dann hätten supraleitende Schaltkreise aktuell die Nase vorn: 1121 quantenmechanische Recheneinheiten stecken in dem Quantenprozessor namens Condor, den IBM im Jahr 2023 vorgestellt hat. Die Fachleute des US-amerikanischen Technologiekonzerns verwenden dazu winzig kleine Schaltungen, in denen Strom verlustfrei fließt.
Grundlage für diese Form der Qubits ist der so genannte Josephson-Effekt. Das bereits 1962 entdeckte Phänomen tritt bei Supraleitern auf, die nur durch eine winzige isolierende Barriere von wenigen Nanometern Dicke voneinander getrennt sind. Der elektrische Strom in Supraleitern nutzt nicht wie in normalen Leitern einzelne Elektronen zum Transport, sondern Elektronenpaare. Letztere können durch die Barriere zwischen den Supraleitern hindurchtunneln und sorgen dafür, dass trotz des Isolators Strom fließt.
Wie sich herausstellt, können Schaltkreise mit solchen Josephson-Kontakten nur bestimmte Energien einnehmen, wie ein Elektron in einem Atomorbital, weshalb sie sich als Qubits eignen. Außerdem ermöglichen es die Josephson-Kontakte, den Fluss des Stroms zwischen den Supraleitern präzise zu steuern, was die Quantenzustände der Schaltkreise beeinflusst. Und die Überlagerungen der Quantenzustände zerfallen nicht so einfach mit der Zeit.
Um die Schaltkreis-Qubits anzusteuern und zu manipulieren, benötigt man Mikrowellenstrahlung. Dadurch lassen sich die Qubits in einen gewünschten Zustand überführen: null, eins oder jede Überlagerung aus beiden. Mit Mikrowellenstrahlung lassen sich außerdem mehrere Qubits miteinander verschränken. Auf diese Weise ist es möglich, allgemeine Berechnungen mit supraleitenden Schaltkreisen durchzuführen. Um das Ergebnis anschließend auszulesen, muss man den Zustand der Qubits messen. Dazu bestrahlt man die Schaltkreise mit Photonen, die teils absorbiert, teils gestreut werden. Je nach Zustand wird das Licht anders abgelenkt, woraus sich das Ergebnis ableiten lässt.
Supraleitende Qubits haben den Vorteil, dass die Gatteroperationen sehr schnell ablaufen, in der Regel innerhalb weniger Nanosekunden. Allerdings ist die Kohärenzzeit der Schaltkreise mit lediglich einigen Millisekunden vergleichsweise kurz – sie kollabieren also rasch. Ein weiterer Nachteil: Es lassen sich stets nur benachbarte Qubits miteinander verschränken.
Im Jahr 1999 gelang es Yasunobu Nakamura und seinem Team der Nippon Electric Company (NEC) erstmals, ein supraleitendes Qubit zu erzeugen. Seitdem bemühen sich zahlreiche Labore und Firmen weltweit, einen leistungsfähigen Quantencomputer mit dieser Technik zu bauen. Dazu gehören beispielsweise Rigetti Computing und Bleximo, die beide ihren Ursprung in Berkeley, Kalifornien, haben. Auch die Quantenprozessoren des deutsch-finnischen Start-ups IQM beruhen darauf.
Bislang am erfolgreichsten in dem Bereich sind allerdings die Tech-Giganten Google und IBM. So soll der IBM-Quantenprozessor Condor nur einer von vielen Meilensteinen auf dem Weg zu einem Rechner mit 100 000 Qubits sein, den die Firma in den nächsten zehn Jahren realisieren möchte. Die Entwickler von Google haben ebenfalls große Pläne: Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen sie einen Prozessor mit einer Million Qubits bauen.
»Es wird nicht funktionieren, die Prozessoren mit den supraleitenden Qubits einfach nur immer größer zu machen«Gerhard Kirchmair, Quantenphysiker
Aber: »Es wird nicht funktionieren, die Prozessoren einfach nur immer größer zu machen«, sagt Gerhard Kirchmair von der Universität Innsbruck. Stattdessen könnten Wellenleiter eine wichtige Rolle spielen, erklärt der Physiker. Diese Leiter, zu denen etwa Glasfaserkabel zählen, können Quanteninformationen durch Lichtwellen übertragen. Kirchmair und sein Team forschen derzeit an Möglichkeiten, mehrere kleine Prozessoren derart miteinander zu verbinden. Einen solchen modularen Ansatz verfolgt auch IBM. Die Firma entwickelt derzeit den Quantenprozessor Kookaburra, der 1386 Qubits umfassen, vernetzbar sein und so den Weg zu aufwändigen Quantenberechnungen ebnen soll.
Ionenfallen
Ein schwarzer Serverschrank, mehr ist es nicht: So sieht der kommerzielle Quantencomputer von Alpine Quantum Technologies (AQT) in Innsbruck aus. Wenn man sonst nur die Fotos der goldenen, an Kronleuchter erinnernden Geräte von IBM kennt, ist man vielleicht enttäuscht. Doch wie bei Letzteren ist auch das Herz des AQT-Rechners tief im Inneren verborgen: Der Quantenprozessor, eine Ionenfalle, versteckt sich in Form eines Chips in einer kleinen unteren Schublade des großen Schranks.
Die Technik für Ionenfallen entstand bereits in den 1950er Jahren. Damals wurden sie für Massenspektrometer genutzt und führten später zu hochpräzisen Atomuhren. Die Grundidee ist recht einfach: Da ionisierte Atome und Moleküle geladen sind, lassen sie sich mit elektromagnetischen Feldern kontrollieren. Über Elektroden und eine hochfrequente Wechselspannung kann man die Teilchen einzeln einfangen und wie Perlen auf einer Kette aufreihen. Ionenfallen ermöglichen es, die Teilchen selbst bei Raumtemperatur extrem gut zu kontrollieren und mit ihnen zu experimentieren.
Um die eingefangenen Ionen als Qubits einzusetzen, nutzt man zwei klar voneinander unterscheidbare elektronische Energiezustände – in der Regel einen Grundzustand und einen langlebigen metastabilen Zustand. Besonders geeignet sind Erdalkalimetalle wie Kalzium oder Magnesium, da ihre Elektronenhüllen über die dafür nötigen Eigenschaften verfügen. Beleuchtet man solche Ionen mit einem geeigneten Laserimpuls, kann man sie vom Grundzustand in einen langlebigen angeregten Zustand bringen – und wieder zurück. So entsteht ein Zwei-Zustands-System, wie in den DiVincenzo-Kriterien gefordert. Indem man die Phase des Lichts und die Dauer der Impulse präzise kontrolliert, lässt sich jeder beliebige überlagerte Zustand erzeugen. Typischerweise nimmt das nur wenige Mikrosekunden in Anspruch. Abhängig von der Lebensdauer des angeregten Zustands lassen sich recht lange Kohärenzzeiten von teils sogar einigen Sekunden erreichen.
Für allgemeine Berechnungen muss man Gatteroperationen mit mehreren Qubits durchführen. Das lässt sich erreichen, indem man die Ionen in der Kette zum Schwingen bringt. Dafür werden die Teilchen anfangs mit Laserlicht gekühlt, damit die Ionen nahezu erstarren. Dann stößt man ein Ion mit einem Laserimpuls an, wodurch es anfängt zu schwingen. Diese Bewegung folgt den Gesetzen der Quantenmechanik: Sie setzt ruckartig ein und ändert sich nur sprunghaft. Da sich die Ionen elektrisch abstoßen, beginnt so die gesamte Kette zu schwingen. Mit weiteren Lichtimpulsen lässt sich dann eine Gatteroperation zwischen Qubits ausführen. Anschließend stoppt man mit einem erneuten Impuls die Bewegung der Teilchen und beendet damit die Berechnung. So lässt sich ein Quantengatter realisieren, das Qubits miteinander verschränkt.
»Die Kopplung über die Bewegung bietet einen großen Vorteil, den alle anderen Qubit-Plattformen nicht haben«Rainer Blatt, Quantenphysiker
»Die Kopplung über die Bewegung bietet einen großen Vorteil, den alle anderen Qubit-Plattformen nicht haben«, sagt der Quantenpionier Rainer Blatt. Denn alle Teilchen in der Kette haben eine gemeinsame Bewegung. »Diese Konnektivität, die Verbindung aller Qubits mit allen anderen, erreicht man nur mit Ionen«, erklärt der Experimentalphysiker von der Universität Innsbruck. 2024 gelang es der Firma Quantinuum auf diese Weise, 56 Qubits miteinander zu verschränken: ein Rekord.
Um das Ergebnis einer Berechnung auszulesen, also die Zustände der Qubits am Ende der Operationen zu bestimmen, nutzt man wieder Laserlicht. Dabei bescheint man das System mit einer Wellenlänge, die alle Ionen im Grundzustand in einen kurzlebigen Anregungszustand versetzt, wodurch sie kurz darauf ein Photon aussenden und wieder in den Grundzustand zurückfallen. Qubits, die sich bereits im angeregten Zustand befinden, reagieren nicht auf das Laserlicht. Das heißt: Ionen im Grundzustand leuchten auf, während solche im angeregten Zustand dunkel bleiben. Auf diese Weise lässt man alle Ionen beim Auslesen unberührt und kann anschließend ohne großen Aufwand mit ihnen weiterarbeiten.
Inzwischen ist die Ionenfallen-Technologie schon so ausgereift, dass sich mehr als 50 Qubits auf einem Mikrochip unterbringen lassen. Neben den experimentellen Maschinen an Universitäten gibt es bereits einige Unternehmen, die derartige Quantencomputer vermarkten. Dazu gehören etwa AQT, eleQtron in Siegen, universal quantum in Sussex, Oxford Ionics sowie IonQ in Maryland und Quantinuum in Colorado.
Mit Ionenfallen lassen sich auch »logische Qubits« realisieren. Diese bestehen nicht aus einzelnen Ionen, sondern aus mehreren Teilchen. So lassen sich Fehler erkennen und teilweise korrigieren, was längere Berechnungen ermöglicht. An der Universität Innsbruck gelang es 2022 und 2023, zwei logische Ionenfallen-Qubits miteinander zu verschränken und verschiedene Fehlerkorrektur-Algorithmen auszuführen. Im April 2024 hat Quantinuum in Zusammenarbeit mit Microsoft erstmals vier logische Ionen-Qubits erzeugt und fehlertolerante Gatteroperationen durchgeführt.
Allerdings haben Quantencomputer mit Ionenfallen auch Schwächen. »Der größte Nachteil ist die Geschwindigkeit«, sagte Roee Ozeri vom Weizmann Institut in Israel bei der Konferenz »QuantumBasel«. Ein Zwei-Qubit-Gatter zu realisieren, dauert bis zu 150 Mikrosekunden, was im Vergleich zu Berechnungen mit supraleitenden Quantenschaltkreisen sehr lang ist. Um das Problem anzugehen, versuchen Ozeri und andere Fachleute, die Anzahl an Gattern zu reduzieren. Das funktioniert, wenn man Operationen zwischen drei, vier oder mehr Qubits zulässt. Auf diese Weise konnte das Team um Ozeri beispielsweise Berechnungen, die sonst sieben Gatter benötigen, zuverlässig mit nur einem einzigen Multi-Qubit-Gatter realisieren.
Der Vorteil, dass Ionenfallen bei Raumtemperatur funktionieren, wird allerdings nicht von Dauer sein. »Wir werden bei großen Fallen auch Kryostaten einsetzen müssen«, sagt Blatt. »Wir haben die ersten Kryostaten jetzt schon hier.« Denn: Hat man viele Ionen, vor allem in Mikrochips, dann heizen sie sich schneller auf und bewegen sich rascher, was die Laserkühlung nicht immer abfangen kann. Dem kann man zuvorkommen, indem man die Apparatur auf vier bis zehn Kelvin abkühlt. Zudem ermöglichen Kryostaten ein besseres Vakuum, was die Anzahl von Stößen mit dem Hintergrundgas reduziert.
Das sind nur einige der Herausforderungen, die sich mit wachsender Anzahl von Qubits ergeben. Darüber hinaus ist es schwer, große verschränkte Zustände zu erzeugen, weil die Gatteroperationen mit zunehmender Masse der Ionenkette noch langsamer werden. Das begrenzt aktuelle Fallen auf Größen von etwa 100 Qubits. Eine mögliche Lösung besteht darin, die Fallen klein zu halten und aufzuspalten. Man kann beispielsweise auf einem Ionenfallen-Chip einzelne Ionen einer Kette hinzufügen und wieder entfernen, je nachdem, ob sie gebraucht werden oder nicht. Dieser Ansatz ist als Quantum Charge-Coupled Device (QCCD) bekannt und wurde 2021 von der Firma Honeywell umgesetzt. Zwei Jahre später gelang es einer Arbeitsgruppe an der University of Sussex, zwei QCCD-Chips miteinander zu koppeln: Die Ionen konnten von einem Prozessor zum anderen hin- und herpendeln und dabei Quanteninformation transportieren. Und auch mehrere statische Ionenfallen können inzwischen aneinandergekoppelt werden, wie ein Team der Universität Innsbruck im Juni 2024 gezeigt hat.
Aktuelle Bestrebungen bestehen darin, die Ionenketten auf zwei Dimensionen auszuweiten. »Die größte Herausforderung stellt die optische Zugänglichkeit dar«, sagt Dean Kassman von der Firma IonQ in Maryland. Dennoch lassen sich viele Forschungsgruppen und Unternehmen nicht davon abhalten, es zu probieren. Zusammen mit Infineon versuchen beispielsweise die Fachleute von der Universität Innsbruck aktuell, Mikrochips mit zweidimensionalen Ionenfallen herzustellen. »Wir arbeiten gerade ganz konkret an einem 32 mal 32 Chip, das heißt an 1000 Qubits«, sagt Blatt.
Kalte Neutralatome
Bei keiner anderen Qubit-Plattform gab es 2023 so viele richtungsweisende Erfolge innerhalb kürzester Zeit wie auf dem Gebiet der kalten Neutralatome. Die bislang wohl beeindruckendste Leistung präsentierte im Dezember des Jahres ein Forschungsteam um Mikhail Lukin und Markus Greiner von der Harvard University in Kooperation mit dem Start-up QuEra: Sie stellten einen Quantenprozessor mit 280 Neutralatom-Qubits vor, mit denen sie 48 logische Qubits codierten und miteinander verschränkten. Solche Ergebnisse zeigen, dass das Rennen um die am meisten Erfolg versprechende Qubit-Plattform noch lange nicht entschieden ist, ja sogar gerade erst richtig Fahrt aufnimmt.
Als Recheneinheiten nutzt die Gruppe um Lukin neutrale Rubidium-Atome, die in optischen Gittern gefangen sind. Es eignen sich dazu aber ebenso Strontium- oder Ytterbium-Atome. Anders als bei den Ionenfallen kann man bei neutralen Atomen nicht ihre elektrische Ladung nutzen, um sie zu steuern. Dennoch erinnern die eingesetzten Verfahren stark an die Methoden, die bei Ionenfallen zum Einsatz kommen. Die beiden Zustände 0 und 1 werden ebenfalls durch verschiedene elektronische Energiezustände realisiert. Demnach verfügen auch Systeme mit Neutralatomen über lange Kohärenzzeiten von in der Spitze sogar 40 Sekunden.
Um die Atome zu fangen und sicherzugehen, dass sie zu Beginn einer Berechnung den gleichen Grundzustand einnehmen, kommt eine Technik zum Einsatz, die als Laserkühlung bekannt ist. Dabei werden die Atome in einer Vakuumkammer eingesperrt und mit Lasern so stark abgebremst, dass sie sich praktisch nicht mehr bewegen. Ihre Temperatur entspricht dann wenigen Mikrokelvin und ist damit sogar noch um den Faktor 1000 niedriger als bei supraleitenden Qubits. Viel entscheidender für das Gesamtprinzip ist aber: Auch wenn die Atome superkalt sind, kann das System selbst bei Raumtemperatur betrieben werden. Es braucht keinen Kryostaten und keine kälteresistente Ausleseelektronik.
Für Alexander Glätzle ist das allerdings nicht der einzige Vorteil. »Neutralatom-Qubits sind von Natur aus alle identisch, Fabrikationsfehler sind dadurch vollkommen ausgeschlossen«, sagt der Quantenphysiker und Mitgründer des Münchener Start-ups planqc. Zudem lasse sich die Plattform recht einfach skalieren, weil man nicht jedes Qubit kompliziert mit den anderen verdrahten muss wie bei den supraleitenden Schaltkreisen. Und im Vergleich etwa zu Ionenfallen stoßen sich die einzelnen Qubits nicht gegenseitig ab, man kann also theoretisch hunderttausende auf engstem Raum zusammenbringen. »Zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik ist es uns bereits gelungen, 1200 Atome mehr als eine Stunde lang in einem sortierten Gitter zu halten«, sagt Glätzle.
Die Idee, die Quantenzustände neutraler Atome für die Verschlüsselung von Informationen zu nutzen, schlug eine Gruppe um Zoller, Cirac und Lukin (Harvard University) bereits Anfang der 2000er Jahre vor. Lange Zeit war sich die breitere Forschungsgemeinschaft einig, dass das »im Prinzip eine großartige Idee ist, es in der Praxis aber einfach nicht funktioniert«, sagte Lukin dem Magazin »Quanta«.
Wie aber lassen sich nun mit den ungeladenen Atomen Quantenberechnungen durchführen? Ein besonderes Merkmal von Neutralatom-Quantenprozessoren ist die Möglichkeit, jedes Teilchen einzeln anzusteuern und in beliebigen räumlichen Konfigurationen anzuordnen – meist in einem zweidimensionalen Gitter. Dazu wird jedes Atom von einer Art Laserpinzette an einem klar definierten Ort festgehalten. Mit dieser Pinzette lassen sich die Atome aber auch beliebig verschieben – etwa von einer Speicherregion in eine Wechselwirkungsregion und dann in eine Ausleseregion. Die jeweilige Positionierung der Qubits ermöglicht es, die Maschine zu programmieren und beliebige Wechselwirkungen zwischen den Qubits zu realisieren.
Um ein Zwei-Qubit-Gatter auszuführen, kommt ein spezieller Energiezustand ins Spiel: der so genannte Rydberg-Zustand. Dabei wird das äußerste Hüllenelektron auf ein extrem weit vom Atomkern entferntes Energieniveau gebracht. Das Atom als Ganzes bleibt so zwar elektrisch neutral, aber durch die Ladungstrennung entsteht ein Dipolmoment. Das nutzen die Physiker, um die Atome auch über einen Abstand von einigen Mikrometern hinweg miteinander wechselwirken zu lassen. Befindet sich anschließend ein Teilchen im Rydberg-Zustand, sind die umliegenden Atome blockiert und lassen sich auf Grund der sehr starken Dipolwechselwirkung nicht ebenfalls anregen. So kann man die Qubits miteinander verschränken. Am Ende einer Berechnung lesen Laser die Zustände der Atome aus.
»Wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit weitermachen wie in den zurückliegenden fünf Jahren, ist ein funktionaler Quantencomputer auf der Basis von Neutralatomen in greifbarer Nähe«Alexander Glätzle, CEO von planqc
In der Theorie scheint alles zu funktionieren. Sind Neutralatom-Qubits also die heißesten Anwärter auf den Qubit-Thron? Noch nicht ganz. In der Praxis gibt es einige Herausforderungen zu bewältigen. Quantenzustände sind generell sehr kurzlebig in Gegenwart von äußeren Einflüssen. Es lässt sich vermutlich nie ein perfektes Vakuum in der Kammer erreichen, so dass die verbleibenden Teilchen die sorgfältig hergestellten Quantenzustände der Atome immer wieder zerstören. Zudem ist der Rydberg-Zustand anfälliger für Dekohärenz als der Grundzustand, was die Anzahl der Berechnungen begrenzt, die nacheinander durchgeführt werden können. Die Skalierbarkeit ist derzeit vor allem durch die aktuelle Optik- und Lasertechnik limitiert. Laser mit höherer Intensität befinden sich noch in der Entwicklung. Doch Alexander Glätzle ist optimistisch, dass sich auch diese Hürden in naher Zukunft überwinden lassen. »Wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit weitermachen wie in den zurückliegenden fünf Jahren, ist ein funktionaler Quantencomputer auf der Basis von Neutralatomen in greifbarer Nähe«, sagt er.
Halbleiter-Spin-Qubits
Anstatt auf eine völlig neue Technologie zu setzen, beruhen Spin-Qubits auf bereits bestehender Halbleitertechnik. »All unsere technischen Geräte basieren darauf«, sagte John Morton vom University College London auf der Konferenz »QuantumBasel«.
Die Idee zu spinbasierten Qubits entwickelten David DiVincenzo, heute an der RWTH Aachen, und Daniel Loss von der Universität Basel im Jahr 1998. Ausgangspunkt sind dabei Quantenpunkte: Sie entstehen durch metallische Gate-Elektroden in Halbleitern. Kühlt man die Materialien auf bis zu vier Grad über dem absoluten Nullpunkt ab und wählt die passende Spannung in den Gate-Elektroden, bildet das elektrische Feld eine Art Senke, Potenzialtopf genannt, in dem sich einzelne Elektronen festhalten lassen. Da die Teilchen auf sehr kleinem Raum eingesperrt sind, entstehen diskrete Orbitale, die den Schalen eines Atoms ähneln und sich präzise steuern lassen.
Um die isolierten Elektronen als Qubits zu nutzen, greift man auf eine quantenmechanische Eigenschaft namens Spin zurück. Diesen kann man sich wie einen kleinen Magneten vorstellen, den die Teilchen mit sich tragen und der entweder mit dem Nordpol nach oben oder unten zeigt. Damit besitzt das Elektron auf natürliche Weise zwei Zustände, die man als 1 und 0 ansehen kann. Über Mikrowellenpulse lässt sich die Spin-Ausrichtung der Elektronen steuern. So kann man ein Qubit in jeden gewünschten Zustand bringen: eins, null oder eine Überlagerung aus beidem. Die Qubits können so dutzende Millisekunden überdauern, bevor sie eine eindeutige Spin-Ausrichtung annehmen.
Damit Operationen mit zwei Qubits durchführbar sind, muss man zwei Quantenpunkte sehr nah zusammenbringen, bis auf etwa 100 Nanometer. Indem man die Spannung durch die Elektroden passend einstellt, sinkt die Potenzialbarriere zwischen den beiden Qubits, wodurch sich die Wellenfunktionen der beiden Teilchen überlappen. Auf diese Weise lassen sich die Elektronen innerhalb weniger Nanosekunden miteinander verschränken – was sehr viel schneller ist als bei Ionenfallen. Durch ihre Nähe und die geringe Ausdehnung der Quantenpunkte (etwa 20 mal 20 Nanometer) lassen sich die Quantencomputer extrem kompakt bauen – im Gegensatz zu Quantenprozessoren, die mit Ionen oder kalten Atomen arbeiten, bei denen viel größere Distanzen zwischen den Teilchen nötig sind.
Um die Zustände der Elektronen am Ende einer Berechnung auszulesen, nutzt man einen transistorähnlichen Aufbau. Zwei Metallkontakte am Quantenpunkt übernehmen dabei die Rolle von Source (Zufluss) und Drain (Abfluss), das aufliegende Metall (durch den der Quantenpunkt erzeugt wurde) entspricht dem Gate (Gatter). Über die Spannung an den beiden Kontakten lässt sich das Elektron im Quantenpunkt steuern: Unter gewissen Umständen kann ein Qubit mit nach oben ausgerichtetem Spin aus dem Quantenpunkt entkommen, wodurch ein elektrisches Signal im Transistor entsteht. Zeigt der Spin hingegen nach unten, bleibt das Elektron gefangen, und es ist kein Strom messbar.
Die ersten Spin-Qubits wurden Anfang der 2000er Jahre aus Galliumarsenid hergestellt – einem Halbleiter, der damals sehr verbreitet war. Allerdings haben die Atomkerne des Materials ebenfalls einen Spin, der mit den Elektronen wechselwirkt und die Operationen stört. Deshalb wenden sich die Forschungsgruppen inzwischen anderen Halbleitern wie Silizium-28 oder Germanium zu, die keinen Kernspin besitzen. Damit kann man präzisere Berechnungen durchführen. Da alle heutigen Technologien auf Halbleitern aufbauen, lässt sich dieser Ansatz für Quantencomputer recht einfach mit der bestehenden Elektronik verbinden, etwa klassischen Speichern und Prozessoren.
Inzwischen haben Arbeitsgruppen an diversen Universitäten Quantenprozessoren mit rund einem halben Dutzend Spin-Qubits realisieren können. Es gibt auch Firmen wie Silicon Quantum Computing in Sydney, die Vier-Qubit-Prozessoren vermarkten und bis 2028 einen 100-Qubit-Prozessor bauen wollen. »Eine Herausforderung ist die Verkabelung«, sagt Lieven Vandersypen von der TU Delft, der 2023 ein zweidimensionales System aus zwei mal vier Quantenpunkten aufgebaut hat. Denn der kompakte Aufbau der Qubits hat auch Nachteile: Er macht es schwierig, die Elektronik passend miteinander zu verbinden.
Um die Systeme zu vergrößern, setzen die Quantenphysiker auf modulare Ansätze, bei denen mehrere kleine Qubit-Systeme miteinander gekoppelt werden. Dies kann entweder durch supraleitende Schaltkreise geschehen, die die Quanteninformation eines Systems auf ein anderes übertragen. Alternativ kann man die Qubits von einem Ort an einen anderen bewegen. Vandersypen und sein Team haben dazu schon erste Experimente durchgeführt, indem sie die Quantenpunkte innerhalb der Halbleiter verschoben haben.
Eine weitere Schwierigkeit sind die Halbleiter, die für Qubit-Anwendungen extrem rein sein müssen. Inzwischen arbeiten viele Forschungsgruppen mit Firmen wie Intel oder Infineon zusammen, um professionell gefertigte Halbleiterstrukturen zu erhalten. »Das Verhalten des Qubits wird durch die Position jedes einzelnen Atoms beeinflusst«, betont Vandersypen.
»Für eine Hand voll Qubits lassen sich die einzelnen Einstellungen noch manuell vornehmen, doch wenn wir es irgendwann mit Hunderten oder gar Tausenden von Qubits zu tun haben, wird das schlicht unmöglich«Natalia Ares, Quantenphysikerin
Zu diesem Zweck hat die Physikerin Natalia Ares von der Oxford University nun Methoden entwickelt, um die speziellen Anforderungen jedes einzelnen Halbleiters zu erfüllen: Mit Hilfe von KI-Programmen lassen sich die Spannungen an den Elektroden so einstellen, dass die Qubits möglichst optimal erzeugt werden. »Das wird umso wichtiger, wenn die Systeme irgendwann skalieren«, erklärt Ares. »Für eine Hand voll Qubits lassen sich die einzelnen Einstellungen noch manuell vornehmen, doch wenn wir es irgendwann mit Hunderten oder gar Tausenden von Qubits zu tun haben, wird das schlicht unmöglich. Wir müssen die Verfahren daher automatisieren.«
Stickstoff-Fehlstellen in Diamanten
Die gewissermaßen funkelndste Qubit-Variante ist die auf Basis so genannter NV-Zentren. Die Abkürzung NV steht für »nitrogen-vacancy«, was mit Stickstoff-Fehlstelle übersetzt werden kann. Dabei handelt es sich um Verunreinigungen innerhalb des Kohlenstoffgitters von Diamanten. Statt zwei der natürlicherweise vorhandenen Kohlenstoffatome im Diamantgitter liegt bei einem NV-Zentrum an einer Stelle ein Stickstoffatom und an einer benachbarten Position gar kein Atom vor. Das Besondere an der Fehlstelle ist nun, dass sich zu den fünf Valenzelektronen der umliegenden Atome ein weiteres freies Elektron aus dem Kristallgitter gesellt. Der resultierende Gesamtspin dieser Elektronenkonfiguration lässt sich als Qubit nutzen. Indem man ihn mit Mikrowellenstrahlung manipuliert, lassen sich Gatteroperationen für quantenmechanische Berechnungen durchführen.
Die verwendeten Diamanten werden aber weder illegal ausgegraben noch zu Brillanten geschliffen – das Material lässt sich künstlich in Laboren züchten und speziell für die Anwendung in Quantentechnologien anpassen. Das Bild des funkelnden Diamanten hat dennoch Einzug in die Namen und Logos der in diesem Feld tätigen Start-ups gefunden wie bei Quantum Brilliance in Australien, Diatope in Ulm oder auch Quantum Diamond Tech in Sommerville, Massachusetts. Dabei sind die künstlichen Diamanten nicht gänzlich farblos. Der eingebaute Defekt emittiert Licht bei einer Wellenlänge von etwa 637 Nanometern, das heißt im roten Spektralbereich. Diamanten, die eine hohe Konzentration an NV-Zentren aufweisen, sind daher lila oder pink gefärbt. Die Fluoreszenz einzelner Defektzentren kann man mit einem konfokalen Mikroskop und entsprechend empfindlichen Detektoren nachweisen.
Im Vergleich zu den anderen Systemen, die sich für die Anwendung in zukünftigen Quantenprozessoren eignen, ist die Idee der NV-Zentren recht jung – und dazu noch »made in Germany«. Im Jahr 2001 schlug ein Team um Jörg Wrachtrup, Professor für Physik an der Universität Stuttgart, das Prinzip vor und trieb die Entwicklung eines Quantenprozessors aus Diamant voran. Bis heute konnten jedoch erst wenige Qubits realisiert werden – erste Demonstratoren der deutschen Start-ups SaxonQ und XeedQ bestehen lediglich aus je vier Qubits. Insbesondere die gezielte Herstellung der Defekte und die präzise Adressierung der Spins stellen eine große Herausforderung dar.
»Der Schlüssel ist die Kontrolle der Diamantschicht. Wir müssen sie sehr gezielt erzeugen, um die gewünschten Wechselwirkungen zwischen den NV-Zentren und der unmittelbaren Umgebung herbeizuführen«Johannes Lang, CEO von Diatope
»Der Schlüssel ist die Kontrolle der Diamantschicht«, sagt Johannes Lang, CEO und Mitgründer des Start-ups Diatope. »Wir müssen das Diamantmaterial sehr gezielt erzeugen, um die gewünschten Wechselwirkungen zwischen den NV-Zentren und der unmittelbaren Umgebung herbeizuführen.« Eine Besonderheit ist nämlich, dass nicht nur der Elektronenspin als Qubit in Frage kommt, sondern auch der Kernspin des unmittelbar benachbarten Stickstoffatoms. Somit können die Stickstoffatome als Quantenspeicherelemente dienen. Die Kohärenzzeit des Systems liegt im Bereich von einigen Millisekunden.
Und Diamant bietet noch einen weiteren Vorteil gegenüber anderen Technologien: Das Material behält bei Raumtemperatur seine Quanteneigenschaften. Somit sind tiefe Temperaturen hier nicht notwendig, nicht einmal eine Laserkühlung wie bei den Ionenfallen oder den Neutralatomen. Experimente können daher unter Umgebungsbedingungen durchgeführt werden. Zudem sind dank der Qubit-Architektur mobile, sehr kompakte Quantencomputer denkbar, die in eine Butterbrotdose passen würden.
Wie aber lassen sich nun die DiVincenzo-Kriterien mit NV-Zentren umsetzen? Die Elektronenspins können mit Mikrowellen manipuliert werden und ihre Quanteninformationen durch Laserlicht optisch ausgelesen. Mit Lasern kann man zudem gezielt einen Anfangszustand herstellen. Wegen ihrer besonderen Struktur sind NV-Zentren Einzelphotonenquellen. Deshalb lassen sich Zwei-Qubit-Gatter erzeugen, indem man die Quanteninformation über Photonen an weiter entfernte NV-Zentren überträgt. Quantenberechnungen mit Diamanten funktionieren also wie folgt: Zunächst wird mittels eines Lasers das System in einen klar definierten Anfangszustand versetzt, dann führt man eine Mikrowellen-Pulssequenz durch, sozusagen das Programm, und liest schließlich den Endzustand wieder mit dem Laser aus.
»Ich denke, dass NV-Zentren eine einzigartige Kombination aus optischer Adressierung und langlebigen Spin-Zuständen bieten«, sagt Fedor Jelezko, Direktor des Instituts für Quantenoptik an der Universität Ulm. »Ich bin zuversichtlich, dass sie deshalb eines Tages wettbewerbsfähig sein werden.«
Photonen
Fast alle Arten von Quantencomputern haben eines gemeinsam: Sie sind extrem empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Da Lichtteilchen dagegen kaum mit ihrer Umgebung wechselwirken, sind sie viel versprechende Qubit-Kandidaten.
Es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt zu bestimmen, aber ein bedeutender Anstoß für die Entwicklungen im Bereich photonischer Quantencomputer erfolgte vermutlich im Jahr 2001. Damals gelang es einem Team um den Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger und seinen Mitarbeiter Jian-Wei Pan erstmals, ein verschränktes Ensemble aus vier Photonen zu teleportieren. Damit zeigte die Gruppe, dass die Methoden, die für photonische Quantencomputer notwendig sind, tatsächlich funktionieren. Allerdings entstanden erst in den 2010er Jahren erste Start-ups und Firmen, die an einen wirtschaftlichen Erfolg der Qubit-Plattform glauben.
Um Information mit Photonen zu codieren, lassen sich die beiden zueinander senkrecht stehenden Polarisationsrichtungen von Licht nutzen. So ergibt sich das erwünschte Zwei-Zustands-System. Externe Anregungen (etwa mit einem Laser) können beliebig überlagerte Zustände hervorrufen. Die Lichtteilchen zu erzeugen, zu kontrollieren und zu messen, ist für Physiker inzwischen zur Routine geworden. Als »fliegende Qubits« können sie zudem große Distanzen überwinden.
Der Segen der Unempfindlichkeit von Photonen ist aber gleichzeitig ein Fluch: Denn es ist sehr schwer, die Teilchen zu verschränken. Eine Methode hierzu ist die parametrische Fluoreszenz. Dabei richtet man einen Laserstrahl auf eine bestimmte Art von Kristall. Ein Photon kann beim Passieren des Kristalls ein verschränktes Photonenpaar erzeugen, das wegen der Energieerhaltung etwas weniger Energie besitzt. Der Zustand des einen Photons hängt dann unmittelbar vom Zustand des anderen im verschränkten Paar ab.
Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik forscht Gerhard Rempe unter anderem zu diesem Thema. Rempe und sein Team nutzen einen anderen Ansatz, um Photonen zu verschränken. Dafür sperren sie zwei Lichtteilchen mit einem einzelnen Atom in einen optischen Hohlraum. Die Wellenlänge der Photonen ist so gewählt, dass das Atom sie im Grundzustand absorbieren kann und dadurch angeregt wird. Nimmt es entsprechend eines der Photonen auf, kann das derart angeregte Atom das Photon anschließend wieder ausstrahlen – es wird vom Absorber zum Emitter. Das zweite Photon »registriert« diese Änderung und wechselwirkt dadurch indirekt mit dem ausgesendeten Photon: Die Teilchen werden verschränkt.
Wie bei supraleitenden Schaltkreisen ist die Kohärenzzeit von photonischen Qubits mit einigen Millisekunden recht kurz - im September 2023 wurde eine Rekordzeit von 34 Millisekunden gemessen. Die Dauer einer Gatteroperation beträgt nur einige Nanosekunden, was viel schneller als bei anderen Qubit-Plattformen ist. Auch photonische Qubits müssen nicht gekühlt werden. Lediglich die extrem empfindlichen Detektoren, die den Zustand der Qubits auslesen, brauchen niedrige Temperaturen von wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt.
Um einen photonischen Quantencomputer zu realisieren, benötigt man eine Photonenquelle, die einzelne Photonen erzeugt. Hierfür bieten sich Atome an, die durch die Anregung mit Lasern ein Lichtteilchen mit bekannter Wellenlänge aussenden. Dieser Vorgang benötigt allerdings eine sehr genaue Kontrolle und ist daher noch nicht für große Maßstäbe geeignet. Zwar lassen sich Photonengatter im Labor bereits gut umsetzen und kontrollieren, doch an einen Computer, der nützliche Berechnungen anstellt, ist noch nicht zu denken.
Während sich Fachleute also noch mit grundlegenden Fragen rund um photonische Quantencomputer beschäftigen, bemüht sich die Industrie bereits, erste Prototypen zu verwirklichen. So unterstützt die Quantencomputing-Initiative des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt das 2019 gegründete deutsch-niederländische Unternehmen QuiX Quantum. Deren Qubits bestehen aus photonisch integrierten Schaltkreisen: Mikrochips, deren elektronische Bauteile durch photonische Komponenten (wie Laserdioden oder Wellenleiter) ersetzt wurden. Neben höheren Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht das auch einen geringeren Energieverlust, was diese Technologie sehr attraktiv macht. Bis Ende 2026 will das Unternehmen 64 solcher Qubits umsetzen.
Eine Firma, die in den vergangenen Jahren für ihren unkonventionellen Ansatz bekannt wurde, ist PsiQuantum. Anders als etwa IBM oder Google, die ihre Zukunftsvision veröffentlichen, geschieht die genaue Planung bei PsiQuantum hinter verschlossenen Türen. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen will direkt einen großen Quantencomputer mit einer Million Qubits entwickeln, statt wie andere in kleinen Trippelschritten voranzukommen.
Doch die Konkurrenz schläft nicht. Im Oktober 2023 hat ein Team aus China den photonischen Quantencomputer JiuZhang 3 vorgestellt, der in seiner neuesten Version aus 255 Qubits besteht. Berichten zufolge hat das Gerät ein komplexes mathematisches Problem in nur einer millionstel Sekunde gelöst und dabei den schnellsten Supercomputer der Welt weit übertroffen, der dafür angeblich 20 Milliarden Jahre benötigen würde. Allerdings wurde die Aufgabe extra zu dem Zweck entworfen, die Überlegenheit von Quantencomputern zu demonstrieren – und nicht, um ein sinnvolles Problem zu lösen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.