Universum: Exoplaneten - Chaos im Weltraum
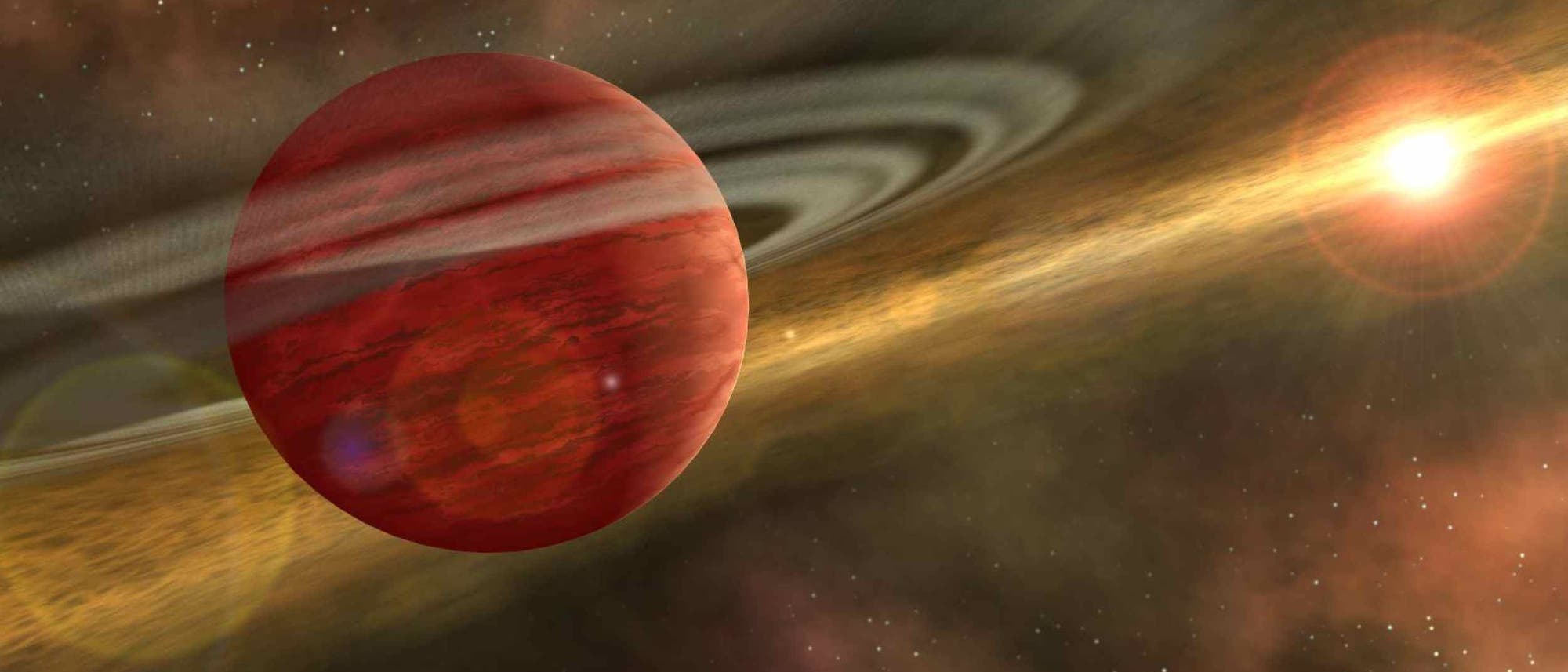
Allein wegen ihrer Schönheit, so dachten Astronomen noch Mitte der 1990er Jahre, müsste diese Theorie einfach stimmen - das so genannte Kernakkretionsmodell. Die Eleganz dieser Theorie liegt dann auch weniger im sperrigen Namen als vielmehr darin begründet, dass sie alle wesentlichen Eigenschaften unseres Sonnensystems mit Hilfe weniger physikalischer und chemischer Grundprinzipien beschreibt. Sie erklärt, warum alle Planeten die Sonne in derselben Richtung umlaufen; warum ihre Bahnen nahezu kreisrund sind und in oder nahe der Äquatorebene des Sterns liegen; warum es sich bei den vier inneren Planeten (Merkur, Venus, Erde und Mars) um vergleichsweise kleine, dichte Himmelskörper handelt, die vor allem aus Gestein und Eisen bestehen; und warum die vier äußeren Planeten (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) riesige Gaskugeln sind, die sich hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium zusammensetzen. Da die Gesetze der Physik und Astronomie im gesamten Universum gelten müssen, sollte jedes extrasolare Planetensystem ziemlich ähnlich aussehen.
Mitte der 1990er Jahre entdeckten Astronomen dann die ersten extrasolaren Planeten - viel gemein mit den Exemplaren in unserem Sonnensystem hatten die allerdings nicht. Gasriesen so groß wie Jupiter wirbelten nahe um ihre Sterne, obwohl sie gemäß dem Kernakkretionsmodell auf solchen engen Bahnen eigentlich nicht vorkommen dürften. Andere Exoplaneten fanden sich auf stark elliptischen Bahnen. Einige kreisten um die Pole ihres Muttersterns. Planetensysteme, so schien es, konnten jede erdenkliche Form besitzen, solange diese die Gesetze der Physik nicht verletzte.
Nach dem Start des Satelliten Kepler im Jahr 2009 stieg die Zahl möglicher Exoplaneten schnell in die Tausende. Damit waren Astronomen in der Lage, die ersten aussagekräftigen Statistiken über andere Planetensysteme vorzulegen - und die Standardtheorie endgültig zu entkräften. Denn viele fremde Systeme sehen nicht nur komplett anders aus als das unsere, der am häufigsten beobachtete Planetentyp - "Supererden", deren Durchmesser zwischen dem der Erde und dem viermal größeren Neptun liegt - kommt nicht einmal in unserem Sonnensystem vor. Unsere Planetenfamilie als Vorlage zu nehmen, sagt Astronom Gregory Laughlin von der University of California in Santa Cruz, "und daraus abzuleiten, was sich da draußen findet, führte nicht zum Erfolg".
Die neuen Funde führten zu allerlei Kontroversen und Durcheinander. Denn Astronomen versuchen nun herauszufinden, woran es der alten Theorie mangelt. Sie probieren dabei verschiedene Ideen aus - ohne so recht zu wissen, wie die einzelnen Puzzleteile zusammengehören. Das Forschungsgebiet in seiner gegenwärtigen Phase "ergibt nicht viel Sinn", kommentiert Norm Murray vom Canadian Institute for Theoretical Astrophysics in Toronto. "Derzeit ist es unmöglich, alles zu erklären", so der Astrophysiker Kevin Schlaufman vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Solange sich die Forscher nicht auf ein neues Modell einigen, werden sie auch nicht verstehen, wie sich unser Sonnensystem in das Gesamtbild einfügt, - geschweige denn vorhersagen, was möglicherweise sonst noch alles im Weltall existiert.
Ein Planet entsteht
Auf der Suche nach einer allumfassenden Theorie stimmen Astronomen immerhin überein, dass das Kernakkretionsmodell zumindest einige Aspekte richtig beschreibt: Planeten formen sich aus den Überresten einer Sterngeburt, wo sich interstellare Wolken aus Wasserstoff- und Heliumgas verdichten, bis ihre Kerne so dicht und heiß sind, dass Kernfusion zündet.
Ein Teil der Gasmassen fällt nicht geradewegs in den neugeborenen Stern, sondern wirbelt um ihn und bildet eine dünne, flache Scheibe um den Äquator des Gestirns. Neben Wasserstoff und Helium finden sich in dem Gas auch winzige Staubkörner aus schwereren Elementen wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Silizium und Eisen, die in früheren Sterngenerationen erzeugt wurden. Sobald die zirkumstellare Scheibe abkühlt, haften diese Körner durch ihre elektrostatische Aufladung zusammen und formen zunächst lose Zusammenschlüsse, die schließlich zu kilometergroßen Objekten heranwachsen, Planetesimale genannt. Ab diesem Punkt bestimmt die Schwerkraft das Geschehen: Die Planetesimale stoßen zusammen, zertrümmern sich und verschmelzen miteinander. Teils wachsen sie zu stattlichen Planeten heran - Reibung mit dem umgebenden Gas zwingt diese schließlich auf nahezu kreisförmige Bahnen.
Dieser Prozess läuft zwar in der gesamten Gas- und Staubscheibe ab, führt aber an unterschiedlichen Positionen zu unterschiedlichen Resultaten. Durch die Hitze des neugeborenen Sterns können nahe dem Zentrum nur Materialien mit hohen Schmelzpunkten bestehen, wie Eisen und verschiedene Mineralien - also Gestein. Im Innenbereich entstehen demzufolge Gesteinsplaneten mit Eisenkern. Deren Masse ist auf die der Erde oder weniger beschränkt, da Feststoffe vergleichsweise selten in solchen protoplanetaren Scheiben vorkommen.
Weiter entfernt vom Stern fallen die Temperaturen dagegen stark ab, so dass auch verschiedene Eisformen bestehen können - diese sind deutlich häufiger vorhanden als Eisen und Gestein und sammeln sich schnell auf den Planetesimalen an. Erreichen solche Objekte rund die zehnfache Erdmasse, ziehen sie alles an Wasserstoff- und Heliumgas in ihrer Nähe an und entwickeln sich schnell in jupiter- und saturnähnliche Gasriesen mit Dutzenden oder Hunderten von Erdmassen. Ihr Wachstum stoppt erst, wenn sie das gesamte Gas auf ihrer Umlaufbahn abgeräumt haben.
Kuriositäten im Weltall
Hier endet die Standardtheorie der Planetenentstehung - vor allem deshalb, weil sie unser Sonnensystem so gut beschreibt: Gesteinsplaneten im Innenbereich, Gasriesen im Außenbereich. Doch das Standardmodell scheint noch Lücken zu haben, wie sich 1995 zeigte. In jenem Jahr vermeldeten Astronomen aus der Schweiz den eindeutigen Nachweis des ersten Exoplaneten um einen sonnenähnlichen Stern. Präzise Messungen der Radialgeschwindigkeit des Sterns 51 Pegasi ließen winzige, periodische Änderungen erkennen, verursacht durch die Schwerkraft eines Planeten. Den Daten zufolge besaß der Planet die 150-fache Erdmasse oder fast die Hälfte der Jupitermasse. Damit gehörte er eindeutig zur Klasse der Gasriesen. Doch der Planet namens 51 Pegasi b umkreiste seinen Stern alle vier Erdtage in einem Abstand von nur 7,5 Millionen Kilometern oder 0,05 Astronomischen Einheiten (1 AE ist die Entfernung zwischen Erde und Sonne). Sein Orbit fällt damit kleiner aus als die Umlaufbahn des Merkurs mit 0,47 AE. In der Entstehungsphase dürfte die Temperatur der protoplanetaren Scheibe in dieser Region ungefähr bei 2000 Kelvin (rund 1700 Grad Celsius) gelegen haben - viel zu heiß für Eis und Gase. "Damals habe ich nur gesagt: 'Was! Wir waren nicht einmal auf der Suche danach'", erinnert sich Derek Richardson von der University of Maryland in College Park.
Astronomen bezeichnen solche Objekte als heiße Jupiter. Schon bald hatte man viele dieser riesigen Exoplaneten aufgespürt, mit einem Drittel bis der zehnfachen Jupitermasse und zwischen 0,03 und 3 AE von ihren Muttersternen entfernt. Und es gab noch andere Exoten: WASP-7b umrundet die Pole und nicht den Äquator seines Sterns; die Umlaufbahn von HD 80606b ist stark elliptisch - der Radius schwankt zwischen 0,03 und 0,8 AE; HAT-P-7b läuft auf seinem Orbit entgegen der Drehrichtung seines Sterns.
2000 hatten Astronomen bereits 30 Exoplaneten gefunden; bis Ende 2008 waren es schon 330. Dann startete die NASA ihren Satelliten Kepler, der in den folgenden vier Jahren einen Himmelbereich mit rund 150 000 sonnenähnlichen Sternen durchkämmte. Die Wissenschaftler suchten dabei nach minimalen Helligkeitsschwankungen bei Sternen. Denn womöglich gehen diese auf einen extrasolaren Planeten zurück, wenn der vom Weltraumobservatorium betrachtet vor seinem Mutterstern vorbeizieht. Mit dieser Transitmethode lassen sich deutlich kleinere Planeten aufspüren als über die Radialgeschwindigkeit der Sterne, und das erhöht die Chancen, andere Erden zu finden. Inzwischen entdeckte man mit Kepler 974 Exoplaneten sowie 4254 Kandidaten, die erst noch durch erdgebundene Teleskope bestätigt werden müssen. Sollten sich die potenziellen Planeten allesamt als echt erweisen - und es sieht so aus -, dann hat man mit dieser Methode zusammengenommen weit über 5000 extrasolare Planeten ausfindig gemacht.
Die von Kepler registrierten Planeten befinden sich in teils bizarren Systemen. Um Kepler-56 kreisen beispielsweise zwei Planeten mit 22 und 181 Erdmassen, deren Bahn um 45 Grad gegenüber der Äquatorebene des Sterns geneigt ist. Im System Kepler-47 umrunden zwei Planeten einen Doppelstern. Bei Kepler-36 liegen zwei Orbits dichter zusammen als in jedem anderen bekannten System: Die beiden Planeten umrunden ihren Stern alle 14 beziehungsweise 16 Tage. Bei einem der Trabanten handelt es sich um einen Gesteinsplaneten, der eine achtmal höhere Dichte aufweist als sein Partner, der aus Eis besteht. "Wie konnten sie sich so nahe kommen?", fragt sich Richardson. "Und wie kann es sein, dass sie so verschieden sind?" Um den Stern Kepler-11 finden sich sechs Planeten - fünf davon gehören zu den kleinsten und masseärmsten Exemplaren, die man bisher kennt. Ihre Dichten, erläutert David Charbonneau vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, "sind überraschend niedrig. Sie müssen sich hautsächlich aus Eis zusammensetzen oder ausgedehnte Gashüllen besitzen" - darüber hinaus kreisen alle fünf innerhalb eines Radius von 0,25 AE um den Mutterstern.
Drei Arten von Planeten
Die größte Überraschung lieferte jedoch die statistische Auswertung der Kepler-Daten. Die bislang aufgespürten Planeten lassen sich in drei Kategorien einteilen: heiße Jupiter, Riesenplaneten mit eigenwilligen Umlaufbahnen und Supererden. Die Welten in dieser dritten Kategorie finden sich meist in kompakten Systemen mit zwei bis vier Planeten, die ihren Stern in einem Abstand von 0,006 bis 1 AE umrunden und dafür wenige Stunden bis zu mehr als 100 Tage brauchen. Auch wenn es in unserem Sonnensystem keine Supererden gibt, umkreisen sie mindestens 40 Prozent aller benachbarten sonnenähnlichen Sterne - das macht sie zum häufigsten Typ unter den bislang bekannten Planeten. "Die heißen Jupiter sind Sonderlinge, mit weniger als einem Prozent", sagt Joshua Winn, der am MIT Exoplaneten erforscht. "Gasriesen mit langen Umlaufzeiten und exzentrischen Orbits machen vielleicht zehn Prozent aus. Die 40 Prozent - die geben einem zu denken."
Wie lässt sich diese Vielfalt an Planetensystemen in der Theorie berücksichtigen? Meist gehen Astronomen vom herkömmlichen Kernakkretionsmodell aus und fügen Prozesse hinzu, die sich vermutlich nicht in unserem eigenen Sonnensystem abgespielt haben.
Im Fall heißer Jupiter nehmen sie beispielsweise an, dass die Planeten nicht an ihrem Geburtsort in den kalten Außenbereichen der zirkumstellaren Scheibe verharren. Stattdessen schrauben sich die jungen Riesenplaneten allmählich nach innen - denn durch Reibung mit umgebendem Gas vermindert sich ihre Umlaufgeschwindigkeit. Irgendwann beenden sie - aus bislang unbekannten Gründen - ihre Migration und nehmen einen stabilen Orbit nahe ihrem Stern ein. Trotz der extremen Temperaturen kann sich das Gas auf den Riesenplaneten halten, dank ihrer starken Gravitation.
Auf stark exzentrische Umlaufbahnen geraten die Gasriesen vielleicht durch gravitative Wechselwirkungen. Wandern nämlich mehrere Riesenplaneten gen Zentrum und kommen sich dabei nahe genug, könnten sie sich durch ihre Schwerkraft gegenseitig in neue, ungewöhnliche Orbits befördern. Dadurch neigt sich ihre Bahnebene beispielsweise gegen die des restlichen Systems, sie laufen auf ihrer Bahn entgegen der Rotationsrichtung des Sterns oder werden sogar komplett aus dem Planetensystem geschleudert.
Supererden lassen sich dagegen nicht so leicht erklären. Zum einen gibt es für diese Himmelskörper keine allgemein anerkannte Definition, sagt Winn: Bei einigen der kleinsten, sonnennächsten Planeten handelt es sich möglicherweise um die frei gelegten Kerne von Gasriesen, die ihrem Stern bei der Migration ins Zentrum zu nahe kamen und dabei ihre Gashülle verloren. "Supererden sind wahrscheinlich keine hübschen, stereotypen Vögel", veranschaulicht Eric Ford, Astrophysiker an der Pennsylvania State University in University Park. "Vielleicht gleichen einige eher Pinguinen."
Warum der "Schwarm" von Supererden so groß ausfällt, gilt es zu klären. Die Standardtheorie kann da allerdings wenig helfen: In bestehenden Modellen enthält der Innenbereich von protoplanetaren Scheiben viel zu wenig Baumaterial, um dort mehrere Supererden zu bilden. Inzwischen konnten Theoretiker dieses Problem jedoch umgehen. Laughlin und Eugene Chiang, Astronom an der University of California in Berkeley, zeigten beispielsweise, dass kompakte Systeme mit Supererden aus zirkumstellaren Scheiben hervorgehen können, die deutlich mehr Masse besitzen und diese näher am Stern konzentrieren. Auch Murray und Brad Hansen, Astrophysiker an der University of California in Los Angeles, schlugen eine massereichere Gas- und Staubscheibe vor. Hier formen sich die Supererden allerdings aus Planetesimalen, die in den Außenbereichen entstanden und nach innen wanderten, bevor sie sich zu Planeten zusammenschlossen.
Das Alleskönnermodell
Douglas Lin von der University of California in Santa Cruz und seine Kollegen vereinten alle Planetenklassen in einem, wie Winn es nennt, "Alleskönnermodell", das jedes beobachte System erklären kann. Demnach variiert die Masseverteilung in der protoplanetaren Scheibe von System zu System. Ein weiterer wichtiger Punkt, sagt Lin, sei "Migration, Migration, Migration": Alle Planetentypen wachsen in den mittleren bis äußeren Bereichen der Scheibe zu ihrer vollen Größe heran und bewegen sich erst dann nach innen.
Solche Modelle sind zwar reizvoll, doch insbesondere im Fall kleinerer Planeten zweifeln einige Forscher am Konzept der Migration - allein weil man dieses Phänomen bisher nie beobachtet hat. Und vermutlich sind entsprechende Aufnahmen auch gar nicht möglich: Wandernde Planeten finden sich nur bei sehr jungen Sternen, die noch von allerhand Staub umgeben sind und deren Licht zu flackern scheint. Durch einen Transitplaneten verursachte Helligkeitsschwankungen in solchen Systemen aufzuspüren, gilt zumindest mit derzeitigen Methoden als äußerst unwahrscheinlich. Zudem ist die Theorie noch lückenhaft. Warum die Reise der wandernden Planeten, ob groß oder klein, in genau den Umlaufbahnen endet, in denen Astronomen sie beobachtet haben, können die Modelle bisher nicht erklären. In Simulationen, berichtet Winn, tun sie es jedenfalls nicht: "Die Planeten plumpsen einfach auf den Stern."
Die größte Frage lautet aber wohl: Warum ähnelt unser Sonnensystem den anderen so wenig? Warum beherbergt es keine Supererde - den häufigsten Planetentyp um sonnenähnliche Sterne? Warum befinden sich innerhalb der Merkurbahn keine Planeten, obwohl hier in anderen Systemen die meisten Exoplaneten anzutreffen sind? Warum halten sich bei uns die großen und kleinen Planeten die Waage, während in den meisten anderen Systemen die eine oder andere Seite dominiert?
Wie anders wir tatsächlich sind, wissen Astronomen noch nicht. Denn die Beobachtungen von Exoplaneten liefern derzeit noch ein stark verzerrtes Bild: Zum einen würden die beiden hauptsächlich verwendeten Techniken unser weit ausgedehntes Sonnensystem gar nicht entdecken, zum anderen können sie nicht gleichzeitig große und kleine Planeten in einem System aufspüren. Womöglich sind wir also gar nicht so untypisch.
Zukünftige Beobachtungen liefern vielleicht einige Antworten. An Bord von Kepler versagte leider die Technik, mit deren Hilfe er seine Zielregion am Himmel zuverlässig erfasste. Kürzlich hieß es allerdings, der Satellit könne auch weiterhin Daten sammeln. Je länger das gelingt, desto länger kann er die Exoplaneten auf ihren Bahnen verfolgen. Erdgebundene Programme beobachten mit immer besseren Instrumenten - einige davon sind in der Lage, Planeten mit einem Abstand von fünf AE oder mehr von ihren Sternen auszumachen. Und ab 2017 soll der von der NASA geplante Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) nach Planetentransits bei allen hellen Sternen am Himmel suchen. Das breitere Spektrum an potenziellen Exoplaneten macht es wahrscheinlicher, dass Astronomen ein Sonnensystem wie das unsere aufspüren - falls es denn eines gibt.
Bis dahin werden die Forscher weiter an ihren Modellen feilen, die inzwischen fast so exotisch und reichlich vorhanden sind wie die Planeten, die sie zu beschreiben versuchen. Und wenn die aktuellen Theorien auch zusammenhanglos, ad hoc und nicht mehr elegant wirken - so läuft es oft in der Wissenschaft, bemerkt Murray: "So spielt das Leben."
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.