Festkörperphysik: Die sieben exotischsten Quasiteilchen
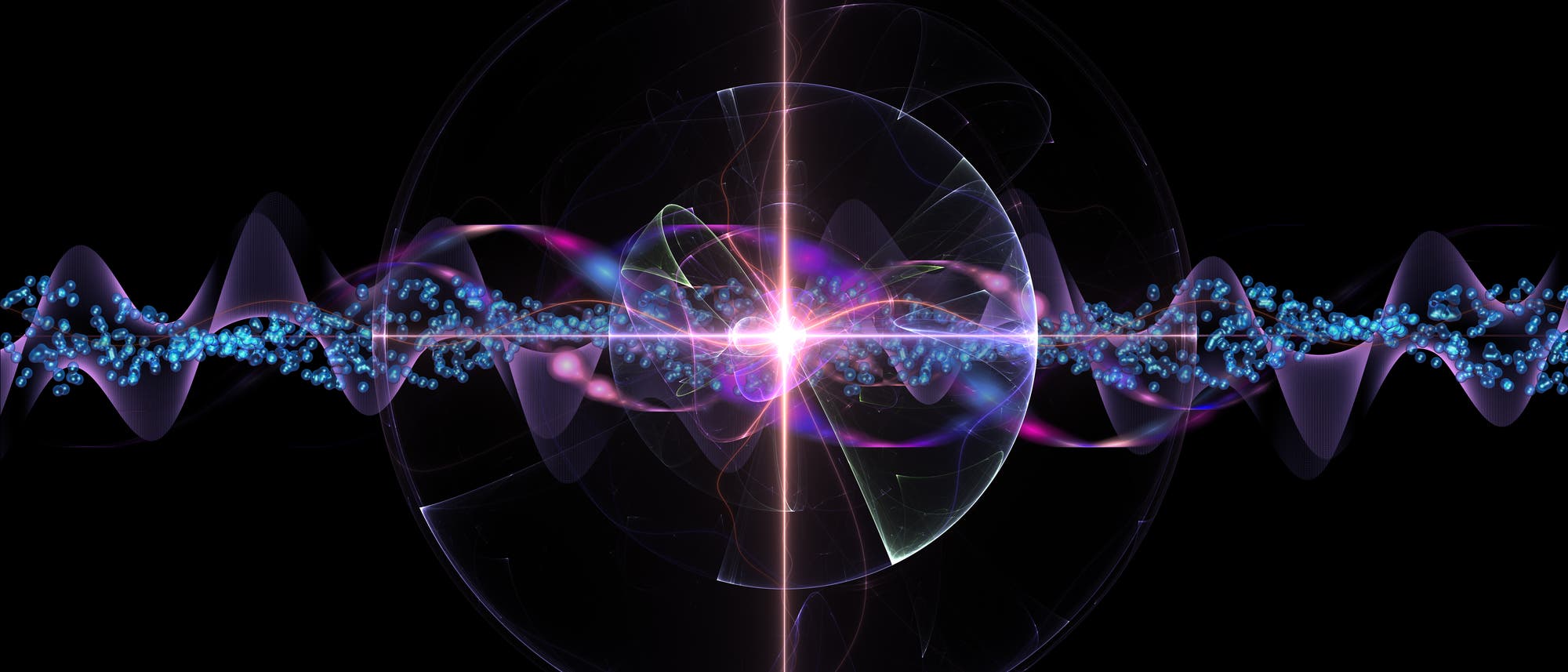
Was passiert im Inneren eines Metalls? Und was in einem Nichtleiter? Solche Fragen stellten Physiker lange Zeit vor ein Problem: Festkörper bestehen aus unzähligen miteinander wechselwirkenden Elektronen und Atomkernen, so dass es unmöglich ist, die Bewegung jedes Teilchens einzeln zu beschreiben. Der sowjetische Wissenschaftler Lev Landau fand 1956 einen Ausweg: Er führte die so genannten Quasiteilchen ein. Darunter verstehen Physiker Mehrteilchenzustände in Festkörpern, deren Eigenschaften denen eines einzelnen Teilchens ähneln. Dieser Kniff erspart Physikern viel Arbeit - und öffnet letztlich ein Fenster zu ganz neuen Phänomenen.
Eine Analogie für ein Quasiteilchen ist die Fankurve eines Fußballstadions: Wenn ein Physiker darin eine La-Ola-Welle beschreiben wollte, würde er wohl kaum jeden Menschen einzeln betrachten, sondern eine Gleichung aus der Schwingungslehre verwenden. Statt tausende Individuen beschreibt diese eine einzige Welle und ist mathematisch viel leichter handhabbar.
Eine einfache Anwendung dieses Konzepts in der Festkörperphysik ist das so genannte Loch-Quasiteilchen. Mit seiner Hilfe beschreiben Physiker die Situation, dass in einem Material an wiederholten Stellen ein Elektron fehlt. Statt den betroffenen Atomkernen eine positive Ladung zuzuschreiben, definieren Physiker einfach ein positiv geladenes Quasiteilchen und tun so, als gäbe es dieses wirklich. Eine überaus erfolgreiche Strategie, mit der sich beispielsweise das Innere von Halbleitern elegant beschreiben lässt.
Doch nicht immer ist die Idee hinter Quasiteilchen so einfach. Die Elektronen und Atomkerne in Festkörpern können auf sehr komplizierte Weise angeordnet sein und miteinander wechselwirken. Manche Quasiteilchen ähneln sogar Teilchen, die Wissenschaftler in freier Natur noch gar nicht nachgewiesen haben. Und in manchen ein- oder zweidimensionalen Systemen entstehen völlig neue Strukturen, die in drei Dimensionen gegen die Gesetze der Physik verstoßen würden.
In den vergangenen Jahren sind Wissenschaftlern im Inneren von Festkörpern immer beeindruckendere Kunststücke gelungen. Manche von ihnen, hoffen die Forscher, könnten neue Anwendungen ermöglichen: beispielsweise die Entwicklung eines Quantencomputers oder die Herstellung effizienterer Prozessoren. Wir haben eine Auswahl der sieben exotischsten Quasiteilchen getroffen, die wir hier vorstellen:
1. Cooper-Paar
1911 entdeckte der niederländische Physiker Heike Onnes den Supraleiter, ein Metall, das bei etwa minus 270 Grad Celsius seinen elektrischen Widerstand verliert. Wissenschaftler rätselten lange, wie dieses Phänomen zu Stande kommt. Erst 40 Jahre später entwickelten die drei Physiker John Bardeen, Robert Schrieffer und Leon Cooper eine nach ihnen benannte Theorie, welche die Supraleitung erfolgreich erklärte, und erhielten 1972 den Physiknobelpreis. Sie fanden heraus, dass sich Elektronen in Supraleitern leicht anziehen und bei niedrigen Temperaturen gebundene Paare bilden: so genannte Cooper-Paare. Sie sind heute der wohl berühmteste Quasiteilchentyp.
Um zu verstehen, warum Cooper-Paare einen widerstandsfreien Stromtransport ermöglichen, muss man zunächst verstehen, was Fermionen und Bosonen sind. Alle in der Natur vorkommenden Teilchen gehören zu einer dieser beiden Teilchenklassen. Beispielsweise sind Elektronen, Quarks, Protonen und Neutronen Fermionen, das Photon dagegen ist ein Boson. Die zwei Klassen unterscheiden sich durch ihren Spin: Bei Bosonen ist er ganzzahlig, bei Fermionen halbzahlig. Fermionen zeichnen sich zudem dadurch aus, dass zwei von ihnen nie und nimmer am selben Ort denselben Zustand einnehmen können. Deshalb stoßen sich Elektronen in Leitern ab, wenn sie sich am selben Ort befinden.
Sobald sich zwei Elektronen in einem Supraleiter zu einem Cooper-Paar zusammenfügen, gehören sie allerdings plötzlich zur Klasse der Bosonen - und können darum widerstandsfrei aneinander vorbeifließen. Heute verwenden Wissenschaftler Supraleiter, um sehr starke Magnetfelder zu erzeugen, die in Teilchenbeschleunigern und Kernspintomografen benötigt werden. Diese werden mit großen Mengen an Strom erzeugt - besäßen sie einen elektrischen Widerstand, würden die Materialien überhitzen.
Dennoch bergen Supraleiter noch immer Geheimnisse: 1986 entdeckten Forscher, dass es Stoffe gibt, die bei weitaus höheren Temperaturen widerstandsfrei Strom leiten als gewöhnliche Supraleiter, die dies nur nahe des Temperaturnullpunkts tun. Physiker konnten aber bisher nicht erklären, wie diese "Hochtemperatur-Supraleiter" funktionieren. Sie gehen davon aus, dass auch hier Cooper-Paare eine Schlüsselrolle spielen. Was genau die Anziehung zwischen den Elektronen in den Materialien auslöst, ist bisher aber offen.
2. Magnetischer Monopol
Gewöhnliche Magnete haben immer zwei Pole - einen Nord- und einen Südpol - ganz gleich, wie klein sie sind oder wie oft man sie zerteilt. Bereits 1894 mutmaßte Pierre Curie, dass es auch einzelne magnetische Ladungen geben könnte - schließlich gibt es sie auch in der Elektrostatik. Vier Jahrzehnte später entwickelte Paul Dirac das dazugehörige theoretische Grundgerüst für diese "magnetischen Monopole". Überraschenderweise förderte er eine bis dahin unbekannte Verbindung zwischen elektrischen und magnetischen Ladungen zu Tage: Falls magnetische Monopole existierten, dürfte die elektrische Ladung nur als ganzzahliges Vielfaches der Elektronenladung auftreten, was sich mit den Beobachtungen von Experimentalphysikern deckt. Heißt das im Umkehrschluss, dass magnetische Monopole existieren?
Wissenschaftler suchen seit Langem nach ihnen, beispielsweise im Weltall - bisher allerdings erfolglos. Viele Physiker sind dennoch überzeugt, dass magnetische Monopole existieren, wie zum Beispiel der angesehene String-Theoretiker Joseph Polchinsky: "Die Existenz magnetischer Monopole ist die sicherste Wette, die man im Bereich der Physik abschließen kann", schrieb er in einer seiner Arbeiten.
2014 gelang es Physikern immerhin, die Auswirkungen eines magnetischen Monopols auf ein anderes Teilchen im Labor nachzuahmen. Dazu erzeugten sie ein Vakuum, in das sie etwa 10 000 Rubidiumatome auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts kühlten - diese bildeten daraufhin ein Bose-Einstein-Kondensat, in dem alle Atome den gleichen Zustand annehmen. Die Wissenschaftler nutzten das Kondensat, um auf spektakuläre Art und Weise ein anderes Quantensystem nachzuahmen: Bei weniger als minus 270 Grad verhielten sich die tausenden Rubidiumatome plötzlich wie ein einzelnes Elektron. Konkret gab die räumliche Verteilung der Atome an, wie wahrscheinlich das Quasielektron an diesem Ort aufzufinden ist.
Dann kam der magnetische Monopol ins Spiel: Durch vier magnetische Spulenpaare stellten die Wissenschaftler für mehrere Millisekunden das Verhalten eines Elektrons nahe einer solchen magnetischen Einzelladung nach. Von einem Quasinordpol ist das zwar noch ein Schritt entfernt, aber so konnte man im Labor schon mal dessen Auswirkungen auf ein Quasiteilchen analysieren. Eine Kompassnadel hätte sich allerdings nicht nach dem Pol ausgerichtet, da dieser die magnetischen Eigenschaften lediglich simulierte. Die Jagd nach dem Monopol geht aber weiter - sowohl nach der Quasiteilchenvariante als auch nach dem Original.
3. Weyl-Fermion
So wie makroskopische Objekte beispielsweise den newtonschen Gesetzen der Schwerkraft folgen, gehorchen relativistische Fermionen wie ein sich sehr schnell bewegendes Elektron der Dirac-Gleichung, die Paul Dirac 1928 präsentierte. Kurz darauf entdeckten Kollegen des introvertierten Genies, dass die Gleichung neben Fermionen noch andere, besonders sonderbare Teilchen beschrieb.
1929 präsentierte Hermann Weyl eine spezielle Lösung der Dirac-Gleichung, die außergewöhnliche Teilchen vorhersagte. Diese seien masselos, bewegten sich mit Lichtgeschwindigkeit und besäßen neben ihrer elektrischen Ladung eine weitere Eigenschaft: die chirale Ladung, welche die Weyl-Fermionen dazu zwingt, sich parallel zu ihrem Spin zu bewegen - darum können sie ihren Kurs nicht ohne Weiteres ändern.
Die Weyl-Fermionen haben allerdings einen Haken: Jedes Fermion, das Physiker bisher aufgespürt haben, hat eine Masse (selbst das Neutrino, das lange als masselos galt). Womöglich gibt es also keine Weyl-Fermionen in der Natur. Doch bereits 1937 mutmaßten Physiker, dass Kristalle existieren könnten, in denen die masselosen Exoten als Quasiteilchen vorkommen. Anders als andere Fermionen können Weyl-Fermionen nur in ungeradzahligen Dimensionen auftreten, so dass die Wissenschaftler ihre Suche auf dreidimensionale Festkörper beschränkten. Die weiteren Anforderungen an solche Kristalle waren sehr schwer zu erfüllen, weshalb Forscher erst 2015 Weyl-Quasiteilchen in einem dreidimensionalen Tantal-Arsenid-Halbleiter nachweisen konnten. Die besondere geometrische Anordnung der Atomrümpfe im Material führte dazu, dass sich die Elektronen wie masselose und relativistische Quasiteilchen verhalten. Diese exotischen Zustände existieren auch bei hohen Raumtemperaturen - anders als viele andere ungewöhnliche Phänomene der Festkörperphysik, die nur nahe des absoluten Nullpunkts entstehen.
Im Gegensatz zu den von Hermann Weyl vorhergesagten Fermionen bewegen sich die Quasiteilchen im Halbleiter langsamer als Licht. Dennoch behalten Quasiteilchen ihre Geschwindigkeit stets bei, sie können weder langsamer noch schneller fließen. Wegen ihrer chiralen Ladung können sie außerdem nicht an Hindernissen oder Fehlstellen im Festkörper abprallen, sondern unbeschadet an ihnen vorbeifließen. Deshalb leiten Weyl-Halbleiter bis zu 1000-mal schneller Strom als gewöhnliche Metalle. Das könnte entscheidend zur Herstellung effizienter Transistoren beitragen. Die dreidimensionalen Halbleiter besitzen zudem exotische Zustände auf ihrer Oberfläche, die Experten bei der Entwicklung von Quantencomputern nutzen könnten.
2017 gingen Forscher noch einen Schritt weiter und realisierten eine weitere Form von Weyl-Fermionen, die außerhalb eines Festkörpers gegen bestehende Naturgesetze verstoßen würden und darum nie als Elementarteilchen vorhergesagt wurden. Diese so genannten Typ II Weyl-Fermionen besitzen einzigartige Transporteigenschaften: Abhängig davon, in welche Richtung sie sich ausbreiten, haben sie eine andere Energie. Außerhalb von Kristallen würden sie damit gegen die spezielle Relativitätstheorie verstoßen, die besagt, dass physikalische Vorgänge unabhängig von ihrem Ort oder ihrer Ausbreitungsrichtung stattfinden. Gerade diese Besonderheit der Typ II Weyl-Fermionen könnten Forscher nutzen, um neuartige elektrische Geräte zu entwickeln.
4. Dirac-Fermion
Dirac präsentierte in seiner 1928 erschienenen Arbeit auch eine allgemeine Lösung der Dirac-Gleichung, die alle bisher bekannten Fermionen - beispielsweise Elektronen und Quarks - passend beschreibt. Sie befolgen die Gesetze der speziellen Relativitätstheorie, bewegen sich sehr schnell und besitzen endliche Masse und halbzahligen Spin.
Zustände mit diesen Eigenschaften gibt es auch in Festkörpern. Die ersten Dirac-Quasiteilchen realisierten Wissenschaftler 2004 in Graphen - einer einatomigen Graphitschicht und dem ersten stabilen zweidimensionalen Material. Im Gegensatz zu den Elementarteilchen besitzen diese Dirac-Quasiteilchen keine Masse. Daher bewegen sie sich mit konstanter Geschwindigkeit, allerdings wesentlich langsamer als das Licht. Sie unterscheiden sich dennoch von Weyl-Fermionen, da sie keine chirale Ladung besitzen: Sie können also ihre Ausbreitungsrichtung ändern.
Seit der Entdeckung von Graphen haben Wissenschaftler eine Vielzahl anderer ungewöhnlicher Materialien erforscht. Dazu gehören die 2007 entdeckten topologischen Isolatoren, an deren Oberfläche ebenfalls ein- oder zweidimensionale masselose Dirac-Fermionen auftauchen. Oder dreidimensionale Dirac-Halbleiter, die dreidimensionale Quasiteilchen beherbergen. Diese neuen Materialien ermöglichen es Physikern, einige komplizierte Quantenphänomene zu untersuchen, ohne dafür aufwändige Experimente in Teilchenbeschleunigern aufzubauen.
5. Majorana-Fermion
Der italienische Physiker Ettore Majorana fand 1937 (ein Jahr bevor er für immer spurlos verschwand) eine dritte Lösung der Dirac-Gleichung, die Teilchen vorhersagte, die gleichzeitig ihrem Antiteilchen entsprechen: Stoßen zwei dieser elektrisch neutralen Majorana-Fermionen zusammen, lösen sie sich in Energie auf. Bisher konnten Wissenschaftler keine Majorana-Elementarteilchen finden, doch verdächtigen viele von ihnen Neutrinos als mögliche Kandidaten. Auch einige Quantengravitationstheorien, darunter die String-Theorie, sagen Majoranas voraus.
Mittlerweile wissen Physiker, dass bestimmte Supraleiter an ihrer Oberfläche Zustände beherbergen, die Majorana-Fermionen gleichen. Diese Materialien tauften sie in Anlehnung an die topologischen Isolatoren "topologische Supraleiter". 2017 gelang es Wissenschaftlern, isolierte Majorana-Quasiteilchen in einem solchen Material nachzuweisen. Sie erzeugten den topologischen Supraleiter, indem sie einen gewöhnlichen Supraleiter auf einen speziellen Isolator mit besonderen Eigenschaften auftrugen. Beide Materialien bestanden aus hauchdünnen, gerade mal einige Nanometer messenden Filmen. So konnten die Wissenschaftler die Majorana-Quasiteilchen an der Grenzschicht zwischen dem topologischen Supraleiter und dem Isolator nachweisen.
Bisher konnten Wissenschaftler aber nur zweidimensionale Majorana-Quasiteilchen an den Oberflächen topologischer Supraleiter erzeugen. In zwei Dimensionen unterscheiden sich deren Eigenschaften stark von dreidimensionalen Majorana-Fermionen. Physiker vermuten, dass sie zu den mysteriösen Anyonen gehören könnten und zu einem Durchbruch bei der Entwicklung von Quantencomputern führen könnten.
6. Skyrmion
Die starke Kernkraft war Wissenschaftlern lange Zeit ein Rätsel. Sie ist der Grund dafür, dass sich Neutronen und Protonen anziehen und Atomkerne bilden. Anfang der 1960er Jahre waren nur drei Teilchen bekannt, die der starken Wechselwirkung unterlagen: Protonen, Neutronen und Pionen. Forscher nahmen damals an, dass es sich bei diesen Partikeln um Elementarteilchen handelte - aus heutiger Sicht ein Irrtum. Der britische Physiker Tony Skyrme entwickelte 1962 ein theoretisches Modell, das die starke Wechselwirkung erklären sollte. Er schlug vor, Protonen und Neutronen durch Wirbel in den Pionenfeldern zu beschreiben. Wissenschaftler tauften diese stabilen Wirbel "Skyrmionen".
Zwischen Mitte und Ende der 1960er Jahre erkannten Physiker dann jedoch, dass Protonen, Neutronen und Pionen aus Quarks bestehen, und benötigten fortan das Konzept der Skyrmionen nicht mehr. Doch 2009 erlebten sie ein Comeback - als Quasiteilchen. Forscher wiesen magnetische Wirbel in Legierungen nach, die sich wie die von Skyrme vorhergesagten Teilchen verhielten. Die Spins der Elektronen innerhalb der dünnen Kobalt- und Platinschicht richteten sich - anders als in gewöhnlichen Magneten - nicht streng in eine Richtung aus, sondern bildeten viele regelmäßig angeordnete Strudel.
Bisher wiesen Wissenschaftler zwei unterschiedliche Typen magnetischer Skyrmionen nach, die sich durch ihren Drehsinn unterscheiden: Néel- und Bloch-Skyrmionen. Im August 2017 entdeckten sie in einer heuslerschen Legierung auch das Antiteilchen eines Skyrmions. Experten bezeichnen die Wirbel als topologisch - äußere Einflüsse können sie kaum zerstören. Unter anderem sind sie auch bei Raumtemperatur stabil. Physiker glauben daher, dass sie sich in Zukunft als Informationsspeicher eignen könnten.
7. Anyon
1982 führte der spätere Nobelpreisträger Frank Wilczek das Anyon direkt als Quasiteilchen ein, um ein bisher kaum verstandenes Festkörperphänomen zu erklären: den fraktionalen Quanten-Hall-Effekt. Wie bei dem gewöhnlichen Quanten-Hall-Effekt wächst dabei der Widerstand eines Materials treppenförmig mit dem Magnetfeld an - in Schritten, die proportional zur Elektronenladung sind. Doch beim fraktionalen Quanten-Hall-Effekt steigt der Widerstand um einen Bruchteil an, als ob bruchstückhafte Elektronen das Material bevölkerten. Diese fragmentierten Zustände taufte Wilczek Anyonen.
Anyonen sind Quasiteilchen, die es nur in zweidimensionalen Systemen geben kann. Bosonen und Fermionen unterscheiden sich durch ihren Spin voneinander: Sie besitzen einen ganz- beziehungsweise halbzahligen Spin. Anders als bei gewöhnlichen Teilchen kann der Spin eines Anyons beliebige Werte annehmen (daher rührt auch ihr Name: aus dem englischen Wort "any"). Dies wirkt sich insbesondere auf Vielteilchensysteme aus: Tauschen zwei Fermionen ihren Platz, erhält die Wellenfunktion aller Teilchen ein negatives Vorzeichen. Bei Bosonen bleibt diese hingegen unverändert. Vertauscht man zwei Anyonen, erhält die Wellenfunktion eine komplexe Phase - diese beschreibt eine Drehung der Wellenfunktion um einen festen Winkel.
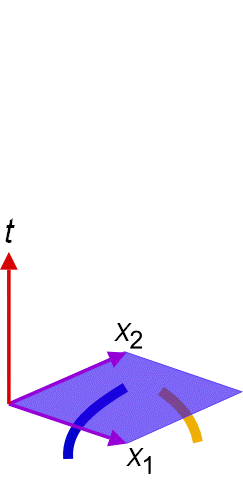
Bisher wiesen Wissenschaftler nur "abelsche" Anyonen nach - bei ihnen ist die Reihenfolge, in der sie vertauscht werden, unerheblich. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass auch nicht abelsche Anyonen in einem bestimmten fraktionalen Quanten-Hall-Effekt entstehen können. Bei ihnen ist die Reihenfolge, in der Teilchen vertauscht werden, entscheidend - sie hätten also eine Art Gedächtnis.
Nicht abelsche Anyonen könnten in ferner Zukunft eine große Rolle bei der möglichen Realisierung eines Quantencomputers spielen: Indem Forscher sie gezielt in verschiedener Reihenfolge miteinander vertauschen, können sie durch die dabei entstehenden Phasen einen Kode in die Wellenfunktion einprogrammieren. Zudem sind die exotischen Zustände sehr stabil und wechselwirken kaum mit der Umgebung - im Gegensatz zu anderen möglichen Ausführungen von Quantencomputern, in denen beispielsweise Spins als Informationsspeicher genutzt werden.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.