Login erforderlich
Dieser Artikel ist Abonnenten mit Zugriffsrechten für diese Ausgabe frei zugänglich.
Plasmonik: Der Zauber der Plasmonik
Eine Technik, die elektromagnetische Wellen in winzige Strukturen zwängt, verspricht eine neue Generation ungeahnt schneller Computerchips sowie höchst empfindliche molekulare Detektoren. Sogar unsichtbar machende »Zaubermäntel« werden bereits erprobt.

© (Ausschnitt)
Licht ist ein wunderbarer Informationsträger. Glasfasern umspannen den Erdball und transportieren Lichtsignale, die gewaltige Ströme gesprochener Sprache und riesige Datenmengen mit sich führen. Auf Grund dieser gigantischen Kapazität prophezeien manche Forscher, dass photonische Geräte, die sichtbares Licht und andere elektromagnetische Wellen kanalisieren und manipulieren, eines Tages elektronischen Schaltkreisen in Mikroprozessoren und Computerchips den Rang ablaufen werden. Leider sind Größe und Leistung photonischer Apparate durch die Beugungsgrenze eingeschränkt: Da eng benachbarte Lichtwellen interferieren, muss der Durchmesser einer optischen Faser mindestens halb so groß sein wie die Lichtwellenlänge im Material. Für optische Signale auf Chips, die höchstwahrscheinlich im nahen Infrarot mit Wellenlängen von rund 1500 Nanometern (millionstel Millimetern) arbeiten werden, ist die minimale Dicke viel größer als die kleinsten heute gebräuchlichen elektronischen Bauteile; die Details einiger Transistoren in Silizium-Schaltkreisen sind kleiner als hundert Nanometer.
Doch seit Kurzem arbeiten Wissenschaftler an einer neuen Technik zur Übertragung optischer Signale durch winzige Strukturen im Nanobereich. In den 1980er Jahren wurde experimentell nachgewiesen, dass Lichtwellen, die sich in der Grenzfläche zwischen einem Metall und einem Dielektrikum – einem Nichtleiter wie Luft oder Glas – fortpflanzen, unter gewissen Bedingungen mit den freien Elektronen an der Metalloberfläche in Resonanz treten.
Das heißt, die Elektronenschwingungen an der Oberfläche entsprechen denen des elektromagnetischen Felds außerhalb des Metalls. Dadurch entstehen so genannte Oberflächenplasmonen – Dichtewellen von Elektronen, die sich entlang der Grenzfläche ausbreiten wie die Wellen auf einem See, nachdem man einen Stein ins Wasser geworfen hat. In den letzten zehn Jahren haben die Forscher herausgefunden, dass sie mit speziell ausgetüftelten Grenzflächen Oberflächenplasmonen erzeugen können, welche zwar dieselbe Frequenz haben wie die externen elektromagnetischen Wellen, aber eine viel kürzere Wellenlänge.
…
Doch seit Kurzem arbeiten Wissenschaftler an einer neuen Technik zur Übertragung optischer Signale durch winzige Strukturen im Nanobereich. In den 1980er Jahren wurde experimentell nachgewiesen, dass Lichtwellen, die sich in der Grenzfläche zwischen einem Metall und einem Dielektrikum – einem Nichtleiter wie Luft oder Glas – fortpflanzen, unter gewissen Bedingungen mit den freien Elektronen an der Metalloberfläche in Resonanz treten.
Das heißt, die Elektronenschwingungen an der Oberfläche entsprechen denen des elektromagnetischen Felds außerhalb des Metalls. Dadurch entstehen so genannte Oberflächenplasmonen – Dichtewellen von Elektronen, die sich entlang der Grenzfläche ausbreiten wie die Wellen auf einem See, nachdem man einen Stein ins Wasser geworfen hat. In den letzten zehn Jahren haben die Forscher herausgefunden, dass sie mit speziell ausgetüftelten Grenzflächen Oberflächenplasmonen erzeugen können, welche zwar dieselbe Frequenz haben wie die externen elektromagnetischen Wellen, aber eine viel kürzere Wellenlänge.
…



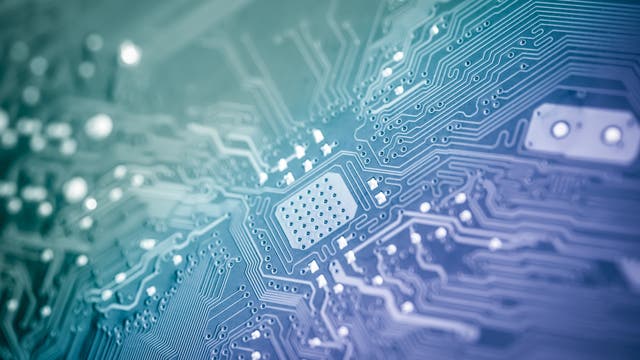
Schreiben Sie uns!
1 Beitrag anzeigen