August 2008: Wunderstoff aus dem Bleistift
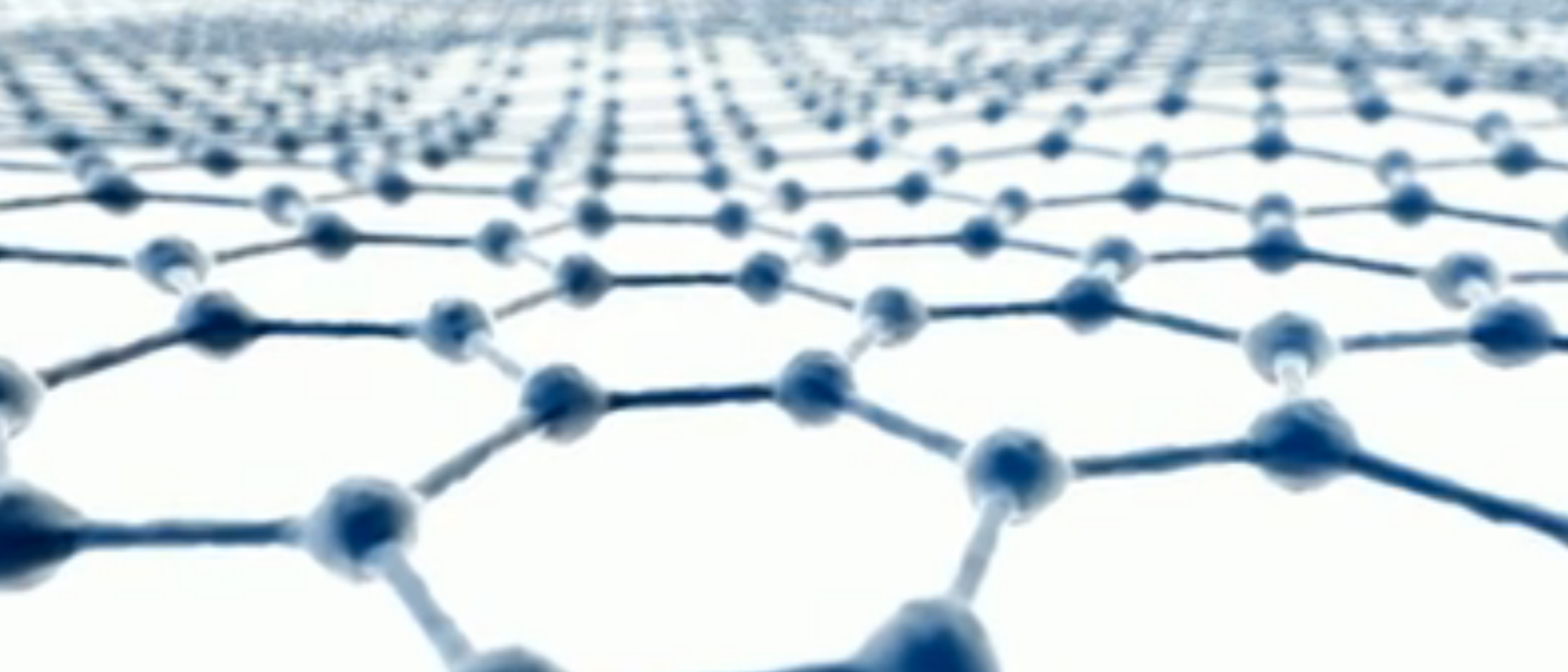
Wenn Sie einen simplen Bleistift betrachten, werden Sie kaum glauben, dass er einmal ganz oben auf der Liste der neuesten Technikprodukte stand. In England unterlagen die heute alltäglichen Schreibgeräte wegen der strategisch-militärischen Bedeutung des enthaltenen Graphits sogar einem Exportverbot. Doch auch derzeit steht der Bleistift wieder an vorderster Front des technischen Fortschritts; denn jeder damit gezogene Strich enthält kleine Mengen eines Materials, das zum Aufregendsten zählt, was es heute in der Nanotechnologie gibt: Graphen – mit Betonung auf der zweiten Silbe.
Die Bezeichnung kommt von Graphit – dem Stoff, aus dem die Bleistiftmine besteht. Dabei handelt es sich um eine Kohlenstoff-Modifikation, die aus übereinandergestapelten ebenen Schichten aufgebaut ist. Seit diese Struktur zu Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeklärt wurde, haben Physiker und Werkstoffwissenschaftler immer wieder versucht, den Graphit in solche einzelnen Schichten aufzuspalten; denn ein Material mit einer derart einfachen und eleganten Geometrie versprach interessante Eigenschaften. Die Kohlenstoffatome sind darin in Form sich wiederholender Sechsecke angeordnet, wodurch ein ebenes Gitter entsteht, das so genanntem Hasendraht ähnelt. Die Schichtdicke beträgt nur genau ein Kohlenstoffatom.
Jahrelang schlugen alle Versuche zur Herstellung von Graphen jedoch fehl. Die beliebteste Methode war damals, Moleküle als Keile zwischen die Schichten zu schieben und diese dadurch voneinander zu trennen -Chemiker sprechen von Interkalation. Obwohl bei diesem Vorgehen hin und wieder bestimmt auch Graphen-Schichten anfielen, wurden sie nie als solche erkannt. Letztlich entstand ein Brei aus graphitischem Material, der kaum von nassem Ruß zu unterscheiden war. So schwand allmählich das Interesse an der Methode.
Später versuchten Forscher die Trennung auf direkterem Weg. Durch Reiben oder Kratzen von Graphitkristallen an anderen Oberflächen zerspanten sie diese in immer dünnere Scheiben. Eine solche »mikromechanische Spaltung« ist zwar etwas grobschlächtig, funktioniert aber erstaunlich gut. Es gelang damit, Graphit lme aus weniger als hundert atomaren Schichten herzustellen. Schon 1990 erzeugten Physiker an der RWTH Aachen Exemplare, die so dünn waren, dass man hindurchsehen konnte.
Ein Jahrzehnt später konnte einer von uns (Kim) in Zusammenarbeit mit Yuanbo Zhang, damals Doktorand an der Columbia University in New York, das mikromechanische Spaltungsverfahren wesentlich verfeinern; das Resultat war die Hightech-Variante eines Bleistifts: der »Nanobleistift«. Beim Schreiben damit entstanden Plättchen aus nur 20 bis 50 atomaren Schichten. Es handelte sich jedoch immer noch um Graphit, nicht Graphen. Kaum jemand glaubte mehr im Ernst daran, dass monoatomare Schichten tatsächlich herstellbar und stabil wären.
Doch die Pessimisten wurden 2004 eines Besseren belehrt. Zusammen mit Kostya S. Novosedov und seiner Gruppe an der University of Manchester prüfte einer von uns (Geim) eine Vielzahl von Möglichkeiten, noch dünnere Graphitproben zu erzeugen. Damals nutzten die meisten Laboratorien dafür Ruß als Ausgangsstoffe, aber Geim und seine Mitarbeiter bewiesen ein glückliches Händchen, als sie stattdessen Graphit zertrümmerten und die Bruchstücke als Ausgangsmaterial verwendeten. Sie nahmen ein Plastikklebeband, bogen es mit der klebenden Seite um einen solchen Splitter herum und zogen es wieder glatt. Dabei wurde der winzige Kristall in zwei Teile gespalten. Je öfter die Forscher den Vorgang wiederholten, desto dünnere Plättchen erhielten sie. Als sie schließlich die dünnsten untersuchten, stellten sie erstaunt fest, dass einige atomare Dicke hatten. Und was noch frappierender war: Die Graphenfolien erwiesen sich bei Normaldruck und Raumtemperatur als stabil.
Diese Entdeckung löste eine wahre Forschungslawine aus. Graphen ist nicht nur das dünnste bekannte Material, sondern, wie sich zeigte, auch äußerst fest und steif. Zudem leitet es in reiner Form bei Raumtemperatur Elektronen schneller als jeder andere Stoff. Auf der ganzen Welt untersuchen Ingenieure die Substanz deshalb nun auf ihre Eignung für superharte Verbundwerkstoffe, intelligente Displays, ultraschnelle Transistoren und Quantenpunkt-Computer. Dank gewisser Besonderheiten auf atomarer Ebene ist Graphen aber auch für die Grundlagenforschung hochinteressant. So erlaubt es Vorstöße in den Bereich der relativistischen Quantenmechanik. Die Untersuchung der hochgradig exotischen Phänomene, die dort auftreten, war bisher Astronomen mit ihren millionenschweren Teleskopen und Teilchenphysikern mit ihren Milliarden Euro teuren Beschleunigern vorbehalten. Am Graphen lassen sich Voraussagen der relativistischen Quantenmechanik dagegen auch mit normalen Laborgeräten testen.
Graphit erwies sich nach seiner Entdeckung im 16. Jahrhundert in England nicht nur als ideales Material für Schreibgeräte, sondern auch als perfektes Futter für die Gussformen von Kanonenkugeln. Das verlieh ihm militärische Bedeutung. Während der Napoleonischen Kriege anfang des 19. Jahrhunderts verbot England deshalb die Ausfuhr von Bleistiften nach Frankreich.
Militärisches Geheimnis
Angesichts der weiten Verbreitung des Bleistifts in unseren Tagen erstaunt es, dass er in alten schriftkundigen Kulturen wie der chinesischen oder griechischen keine Rolle gespielt hat. Erst im 16. Jahrhundert entdeckten die Engländer ein großes Vorkommen von reinem Graphit, den sie Plumbago (lateinisch für Bleierz) nannten. Sie erkannten schnell die Eignung des Materials zum Schreiben und entwickelten daraus unverzüglich ein handliches Gerät als Ersatz für Gänsekiel und Tinte. In europäischen Gelehrtenkreisen machte der Bleistift bald Furore.
Dass Plumbago kein Blei, sondern Kohlenstoff ist, fand erst 1779 der schwedische Chemiker Carl Scheele heraus. Ein Jahrzehnt später schlug der deutsche Geologe Abraham Gottlob Werner deshalb vor, die Substanz nach dem griechischen Wort für »schreiben« besser Graphit zu nennen. Inzwischen hatten die Munitionshersteller eine weitere Verwendung des bröseligen Materials gefunden: Es erwies sich als ideales Futter für die Gussformen von Kanonenkugeln was zum streng gehüteten militärischen Geheimnis wurde. Während der Napoleonischen Kriege verfügte die englische Krone deshalb auch eine Ausfuhrsperre für Bleistifte gegenüber Frankreich.
In den letzten Jahrzehnten hat Graphit etwas von diesem Nimbus als Hochtechnologie-Werkstoff zurückgewonnen; denn Wissenschaftler stießen auf neue, hochinteressante Modifikationen von Kohlenstoff mit hohem Anwendungspotenzial, die in gewöhnlichen graphitischen Materialien vorkommen. Die erste war das berühmte Buckminsterfulleren, auch salopp Buckyball genannt: ein fußballförmiges Molekül, das die US-amerikanischen Chemiker Robert Curl und Richard E. Smalley zusammen mit ihrem englischen Kollegen Harry Kroto 1985 entdeckten. Sechs Jahre später identifizierte der japanische Physiker Sumio Iijima jene zylindrischen Anordnungen von Kohlenstoffatomen mit Wabenstruktur, die inzwischen als Kohlenstoff-Nanoröhren bekannt sind. Obwohl schon früher darüber berichtet worden war, hatte niemand die Bedeutung des Materials erkannt. Die beiden neuen molekularen Formen erhielten die Sammelbezeichnung Fullerene (zu Ehren des visionären US-Architekten und Ingenieurs Buckminster Fuller, der analog gestaltete geodätische Kuppeln entworfen hatte).
Molekularer Hasendraht
Die grundlegende Anordnung der Atome ist für Graphit, Fullerene und Graphen dieselbe. Jede Struktur beginnt mit sechs Kohlenstoffatomen, die in Form eines regulären Sechsecks fest miteinander verbunden sind; Chemiker sprechen von einem Benzolring.
Auf der nächsthöheren Stufe im Komplexitätsgrad steht Graphen, in dem viele solche Sechsringe zu einem ebenen Wabenmuster, das wie Hasendraht aussieht, aneinandergefügt sind. Die anderen graphitischen Formen beruhen auf dieser Grundstruktur. Bei den Kohlenstoff-Nanoröhren sind die Graphen-Schichten zu Zylindern aufgerollt und bei den Buckyballs wölben sie sich durch zusätzlich eingebaute Fünfecke zu einer Kugel oder einem Ellipsoid. Bei Graphit schließlich sind sie, wie erwähnt, übereinandergestapelt. Dabei halten schwache molekulare Wechselwirkungen so genannte van der Waals-Kräfte die einzelnen Schichten zusammen. Wegen dieser lockeren Verbindung zwischen den Graphen-Ebenen genügt beim Schreiben mit einem Bleistift schon der Druck auf das Papier, dass sich Schichtpakete vom Graphit ablösen und als Strich auf der Unterlage zurückbleiben.
Die Entdeckung von Graphen löste eine wahre Forschungslawine aus
Wie rückblickend klar ist, waren die neu entdeckten molekularen Formen von Kohlenstoff schon immer präsent. So kommen Fullerene im Ofenruß vor, wenn auch nur in kleinen Mengen. Ebenso enthält jeder Bleistiftstrich zweifellos winzige Graphen-Stücke, die früher nur niemand bemerkt hat. Seit ihrer Entdeckung jedoch stehen sie im Brennpunkt wissenschaftlicher Forschung.
Buckyballs sind vor allem deshalb interessant, weil es sich um eine völlig neue Art von Molekülen handelt. Allerdings könnten sie auch bedeutende praktische Anwendungen haben etwa bei der Verabreichung von Arzneimitteln. Kohlenstoff-Nanoröhren vereinen gleich eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Eigenschaften chemischen, elektronischen, physikalischen, optischen und thermischen auf sich, was eine breite Palette potenzieller Einsatzmöglichkeiten eröffnet. So könnten die winzigen Kohlenstoffzylinder als Halbleitermaterial Silizium in Minichips ersetzen oder Fasern liefern, die sich zu sehr leichten und dabei extrem festen Tauen flechten lassen. Obwohl Graphen, die »Mutter« aller graphitischen Formen, erst seit ein paar Jahren Eingang in solche Zukunftsvisionen gefunden hat, scheinen seine Aussichten ebenfalls rosig. Wahrscheinlich wird es sogar noch faszinierendere technologische Anwendungen haben als seine Vettern aus der Kohlenstoff-Familie. Zugleich dürfte es tiefere Einsichten in grundlegende physikalische Prinzipien vermitteln.
Vor allem zwei Eigenschaften machen Graphen zu einem außergewöhnlichen Stoff. So fällt es trotz der relativ groben Herstellungsmethode in bemerkenswert hoher Qualität an. Das liegt neben der Tatsache, dass es aus reinem Kohlenstoff besteht, vor allem an der äußerst regelmäßigen Struktur, in der die Atome angeordnet sind. Bisher ließ sich kein einziger Defekt etwa eine unbesetzte Position im Gitter oder ein falsch platziertes Teilchen in einer Graphen-Probe entdecken. Die perfekte Kristallordnung scheint von den starken, aber nicht starren Bindungen zwischen den Atomen herzurühren. Dadurch entsteht ein Stoff, der härter ist als Diamant, dessen blattförmige Moleküle aber biegsam sind und sich ein gutes Stück weit mechanisch verformen lassen, bevor die Spannung so groß wird, dass sich die Atome neu anordnen.
Die Qualität des Kristallgitters ist auch verantwortlich für die erstaunlich hohe elektrische Leitfähigkeit von Graphen. Die Elektronen können fließen, ohne an Gitterfehlstellen oder Fremdatomen anzustoßen und abzuprallen. Sogar Rempeleien von den Kohlenstoffatomen auf regulären Plätzen, die auf Grund ihrer thermischen Energie bei Raumtemperatur nicht still sitzen können, halten sich wegen der großen Stärke der interatomaren Bindungen in Grenzen.
Das zweite außergewöhnliche Merkmal von Graphen ist, dass seine Leitungselektronen nicht nur besser vorankommen, weil sie kaum an Hindernisse stoßen, sondern an sich schon viel schneller unterwegs sind so, als hätten sie eine weitaus geringere Masse als Elektronen, die sich durch gewöhnliche Metalle oder Halbleiter bewegen. In der Tat sollte man sie besser als elektrische Ladungsträger bezeichnen; denn es sind eigenartige Teilchen in einer bizarren Welt, wo die Gesetze der relativistischen Quantenmechanik herrschen. Ihre Art von Wechselwirkung ist, soweit bekannt, einzigartig für Festkörper. Dank diesem neuartigen Stoff aus der Bleistiftmine spielt die relativistische Quantenmechanik nicht mehr nur im Kosmos und in Teilchenbeschleunigern eine Rolle, sondern hat jetzt auch das Labor erreicht.
Urknall im Flachland
Um sich das merkwürdige Verhalten elektrischer Ladungsträger in Graphen klarzumachen, wollen wir es zunächst mit der Bewegung gewöhnlicher Leitungselektronen in einem Metall vergleichen. Diese gelten zwar als frei, sind es aber nicht wirklich; sie bewegen sich jedenfalls deutlich anders als im Vakuum. Da Elektronen eine negative Ladung tragen, bleibt eine positive Ladung zurück, wenn sie ihren Ursprungsort verlassen und sich durch das Metall bewegen. Bei ihrer Wanderung durch das Kristallgitter treten sie mit dem dortigen elektrostatischen Feld in Wechselwirkung und werden in komplizierter Weise hin- und hergezerrt und gestoßen. Dadurch benehmen sie sich, als seien sie viel schwerer als gewöhnliche Elektronen; ihre »effektive Masse« ist deutlich höher. Physiker nennen solche Ladungsträger Quasiteilchen.
Während Elektronen im Vakuum fast Lichtgeschwindigkeit erreichen können, bewegen sie sich in Metallen wegen ihrer relativ hohen effektiven Masse sehr viel langsamer. Für ihre theoretische Beschreibung ist das von Vorteil. Bei Partikeln, die sich der Lichtgeschwindigkeit nähern, kommt nämlich Einsteins Relativitätstheorie zum Tragen, die komplizierte Korrekturen erfordert. Weil Quasiteilchen in einem Leiter so langsam sind, lassen sie sich jedoch entweder mit der vertrauten klassischen Physik oder mit normaler, das heißt nichtrelativistischer Quantenmechanik beschreiben.
Die Aussagen der Quantenelektrodynamik widersprechen fast immer dem gesunden Menschenverstand
Auch Elektronen, die durch das Hasendrahtgitter von Graphen schlüpfen, verhalten sich wie eine Art Quasiteilchen. Erstaunlicherweise werden sie durch die Wechselwirkung mit dem elektrostatischen Feld der Kohlenstoffatome jedoch nicht schwerer, sondern leichter. Statt normalen Elektronen gleichen sie deshalb eher dem fast masselosen Neutrino. Zwar ist dieses Elementarteilchen, wie der Name schon sagt, elektrisch neutral, während die Quasiteilchen in Graphen eine negative Ladung tragen. Aber wie Neutrinos unabhängig von ihrer Energie oder ihrem Impuls stets fast lichtschnell unterwegs sind, bewegen sich auch die Elektronen in Graphen mit konstant hohem Tempo. Sie erreichen dabei etwa 0,3 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Damit sind sie schnell genug, dass relativistische Effekte auftreten können.
Statt mit der normalen Quantenmechanik muss ihr Verhalten deshalb mit der weitaus komplizierteren relativistischen Erweiterung dieser Theorie beschrieben werden: der so genannten Quantenelektrodynamik. In deren Mittelpunkt steht eine probabilistische Gleichung, die nach dem englischen Physiker Paul A.M. Dirac benannt ist, der sie 1928 formulierte. Folglich bezeichnen Physiker in Graphen wandernde Elektronen manchmal als masselose Dirac-Quasiteilchen.
Leider widersprechen die Aussagen der Quantenelektrodynamik fast immer dem gesunden Menschenverstand. Man muss mit scheinbar paradoxen Phänomenen vertraut werden, auch wenn ein gewisses Unbehagen nie ganz verschwindet. Oft beruhen die Paradoxien der Quantenelektrodynamik darauf, dass relativistische Teilchen stets ein bizarres Alter Ego als virtuellen Partner mitschleppen: ihr Antiteilchen. Beim Elektron handelt es sich um das Positron. Es hat exakt dieselbe Masse, aber die entgegengesetzte Ladung.
Gemäß der relativistischen Quantenmechanik kann jederzeit ein Teilchen-Antiteilchen-Paar auftauchen und zwar direkt aus dem Nichts, nämlich dem Vakuum. Das ergibt sich aus einer der vielen Versionen von Heisenbergs Unbestimmtheitsprinzip. Demnach lässt sich bei einem Ereignis die dafür nötige Energie nur umso ungenauer angeben, je kürzer es ist. Das hat erstaunliche Konsequenzen. Auf extrem kurzen Zeitskalen kann die Energie dadurch nämlich fast beliebig hohe Werte annehmen. Da sie gemäß Einsteins berühmter Gleichung E = m c2 zur Masse äquivalent ist, gilt für diese im Prinzip das Gleiche. So kann durch eine »Energieanleihe« beim Vakuum spontan ein »virtuelles« Elektron-Positron-Paar entstehen vorausgesetzt seine Lebensdauer ist so kurz, dass es die fehlende Energie zurückzahlt, bevor das Defizit nachweisbar wird.
Die seltsame Dynamik des Vakuums in der Quantenelektrodynamik führt zu vielen merkwürdigen Effekten. Dazu zählt insbesondere eine von dem schwedischen Physiker Oskar Klein formulierte Paradoxie. Demnach kann ein relativistisches Objekt unter bestimmten Umständen durch jede Potenzialbarriere gelangen, egal wie breit oder hoch sie ist. Als Beispiel einer solchen Barriere denke man sich einen Berg, der aus einer Ebene aufragt. Ein Lastwagen, der mit Motorkraft hinauffährt, gewinnt potenzielle Energie. Von der Bergspitze kann er dann im Leerlauf auf der anderen Seite hinabrollen. Dabei verwandelt sich seine potenzielle in kinetische Energie.
Ein Laster ohne Benzin schafft es nicht über den Berg. Analog sitzt ein Teilchen in einem Tal zwischen zwei Potenzialbarrieren fest. Allerdings bietet die Quantenmechanik und zwar schon in ihrer normalen, nichtrelativistischen Form ein Schlupfloch. Eine zweite Version von Heisenbergs Unbestimmtheitsprinzip besagt nämlich, dass man von einem Objekt unmöglich sowohl den Ort als auch den Impuls genau wissen kann. Letzterer ist bei einem Teilchen, das in einem Energietal hängt, praktisch gleich null und damit sehr präzise bekannt. Folglich herrscht eine hohe Unsicherheit über den Ort. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann sich das Teilchen demnach auch hinter der Barriere befinden: Es hat sie wie von Geisterhand durchquert. Physiker nennen das den Tunneleffekt.
Im nichtrelativistischen Fall ist die Tunnelwahrscheinlichkeit ziemlich gering und sinkt mit zunehmender Höhe und Breite der Barriere. In der Quantenelektrodynamik dagegen verhält es sich laut Klein völlig anders. Seinen theoretischen Überlegungen zufolge sollten relativistische Teilchen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent selbst durch sehr hohe, ausgedehnte Hindernisse tunneln. An deren Rand paaren sie sich einfach mit ihrem Antiteilchen-Zwilling, für den die Welt gleichsam auf dem Kopf steht, so dass ihm der Berg als Tal erscheint. Nach der Passage verflüchtigt sich der Ad-hoc-Gefährte wieder ins Nichts, aus dem er mit geborgter Energie kurz aufgetaucht ist, und das Elektron setzt seine Reise fort, als wäre nichts gewesen. Selbst vielen Physikern erscheint derlei Spuk allerdings suspekt.
Die Sache schreit also nach experimenteller Überprüfung. Lange war jedoch unklar, wie ein Test für das kleinsche Paradoxon aussehen könnte oder ob er vielleicht sogar prinzipiell unmöglich ist. Die masselosen diracschen Quasiteilchen in Graphen kommen da nun wie gerufen. Sie machen das kleinsche Paradoxon zum Routine-Effekt mit leicht beobachtbaren Konsequenzen. Man kann im Graphen künstlich Potenzialbarrieren unterschiedlicher Höhe und Breite erzeugen und dann die elektrische Leitfähigkeit messen. Sie sollte bei einer Tunnelwahrscheinlichkeit von 100 Prozent durch die Hindernisse nicht erniedrigt werden. In verschiedenen Laboratorien laufen derzeit entsprechende Untersuchungen. Auch zum Nachweis anderer ungewöhnlicher Konsequenzen der Quantenelektrodynamik bietet sich Graphen an.
Ultraschnelle Transistoren
Aber wie sieht es mit technischen Anwendungen aus? Noch ist es zu früh für eine definitive Antwort. Klar scheint jedoch: Jede Einsatzmöglichkeit für Nanoröhren eingerolltes Graphen steht auch der ebenen Form offen. Allerdings muss es dazu gelingen, das Material in industriellem Maßstab zu produzieren. Viele Forschungsgruppen arbeiten an der Entwicklung verbesserter Herstellungsmethoden.
Als Staub lässt sich Graphen bereits in industriellen Mengen erzeugen. Doch ausgedehnte Blätter von dem Material zu gewinnen ist noch immer sehr schwierig, weshalb es sich dabei vermutlich um den teuersten Stoff überhaupt handelt. Ein durch Spaltung mikromechanisch erzeugter Graphen-Minikristall, der dünner als ein Haar ist, kostet derzeit über tausend Dollar. Gruppen in Europa und an mehreren US-Institutionen darunter das Georgia Institute of Technology in Atlanta, die University of California in Berkeley und die Northwestern University in Evanston (Illinois) haben Graphen-Filme auf Siliziumkarbidscheiben abgeschieden.
Denkbar wären sogar integrierte Schaltkreise, die sich aus einem einzigen Graphenplättchen ausschneiden lassen
Inzwischen erkunden auch Ingenieure die einzigartigen physikalischen und elektronischen Eigenschaften, die das Material technisch so interessant machen. Mit seinem hohen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen sollte es sich etwa für harte Verbundwerkstoffe eignen. Als extrem dünnes Material könnte es auch effzientere Feldemitter ergeben: Geräte, die in Gegenwart von starken elektrischen Feldern aus nadelförmigen Spitzen Elektronen emittieren.
Da sich die Eigenschaften von Graphen mit elektrischen Feldern präzise regulieren lassen, bestehen gute Aussichten, mit dem Werkstoff ultraempfindliche chemische Detektoren sowie bessere supraleitende und Spin-Ventil-Transistoren zu bauen. Ferner könnten dünne Filme aus überlappenden Graphen-Stückchen transparente, elektrisch leitende Beschichtungen für Flüssigkristall-Anzeigen und Solarzellen abgeben. Die Liste ist keineswegs vollständig, und einige Nischenprodukte kommen vielleicht schon in wenigen Jahren auf den Markt.
Ein mögliches Einsatzgebiet verdient besondere Erwähnung: Elektronik auf Graphen-Basis. Wie beschrieben, bewegen sich die Ladungsträger in dem Material mit hoher Geschwindigkeit und verlieren relativ wenig Energie durch Zusammenstöße mit den Atomen im Kristallgitter. Das sollte den Bau so genannter ballistischer Transistoren ermöglichen, die viel schneller schalten als herkömmliche Geräte.
Noch faszinierender ist die Aussicht, mit Graphen die Gültigkeit einer Erfahrungsregel zu verlängern, die der Elektronikpionier Gordon Moore schon vor etwa 40 Jahren formuliert hat. Demnach verdoppelt sich etwa alle 18 Monate die Zahl der Transistoren, die sich auf einer bestimmten Fläche unterbringen lassen. Das unvermeidliche Ende dieser fortschreitenden Miniaturisierung wurde schon oft voreilig prophezeit. Dank seiner bemerkenswerten Stabilität und elektrischen Leitfähigkeit selbst im Nanometerbereich eignet sich Graphen vielleicht für Transistoren, die deutlich weniger als zehn Nanometer messen und womöglich nur aus einem einzelnen Benzolring bestehen. Vorstellbar wären sogar komplette integrierte Schaltkreise, die sich aus einem einzigen Graphen-Plättchen »ausschneiden« lassen.
Das nur ein Atom dicke Material hat also bestimmt eine große Zukunft als Ausgangspunkt für innovative kommerzielle Produkte ebenso wie als Minilabor zum Nachweis exotischer Quanteneigenschaften. Man kann nur staunen, dass all diese Fülle und Komplexität schon Jahrhunderte lang in jedem Bleistiftstrich verborgen war.
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben