Tagebuch: Rettung durch das anthropische Prinzip?
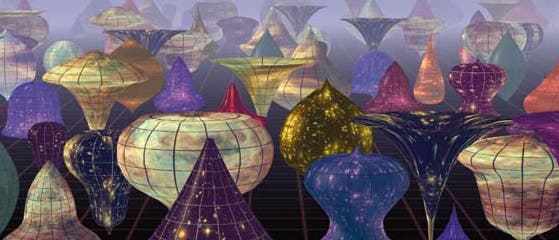
© Kristin Riebe (Ausschnitt)
Im Mai-Heft von Spektrum, das ab kommendem Dienstag am Kiosk erhältlich ist, verteidigt der Teilchenphysiker Dieter Lüst sein Forschungsgebiet, die Stringtheorie, gegen die Kritik, sie sei keine Wissenschaft mehr. Als ein Hauptargument führt der Direktor am Max-Planck-Institut für Physik das anthropische Prinzip an. Ich gestehe, das hat mich überrascht. Doch worum geht es?
Es war auf einer Tagung in Krakau, im Jahr 1973. Als junger Postdoc am MPI für Astrophysik (München) besuchte ich das Kopernikus-Symposium über Relativistische Astrophysik. Ich lauschte einem Theoretiker aus Cambridge (heute Meudon bei Paris), Brandon Carter. Er hielt einen Vortrag über "Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology". Darin vertrat er eine für einen hartgesottenen Relativitätstheoretiker etwas abseitige These: Das Leben müsse zumindest kompatibel sein mit den Naturgesetzen sowie der kosmischen Entwicklung.
Warum abseitig? Natürlich ist alles, was wir im Universum vorfinden, Ausdruck der Naturgesetze sowie der kosmischen Entwicklung, die Menschheit inklusive. Also was soll’s?
Die rätselhafte Feinjustierung der Naturgesetze
Carter sah Belege für die Hypothese vom anthropischen Prinzip, die vor ihm schon der Princeton-Physiker Robert H. Dicke 1961 geäußert hatte, in den bereits von Paul Dirac betrachteten "kosmischen Koinzidenzen". Bestimmte Zahlenverhältnisse in der Natur und ihrer Geschichte seien doch einigermaßen verblüffend. Immer taucht da die Zahl 10 hoch 40 auf. Das Universum ist, gemessen in Atomzeiteinheiten, 10 hoch 40 Einheiten alt. Die gleiche Zahl taucht auf als Verhältnis von elektrischer Kraft zu Gravitationskraft. Und die Teilchenzahl im sichtbaren Universum ist in etwa das Quadrat dieser Zahl, also 10 hoch 80. Es lassen sich noch weitere solcher Relationen finden.
Ja, das lässt fast jeden rätseln, vor allem darüber, was eigentlich zeitabhängige Größen (das kosmische Alter) mit unserer Atomphysik zu tun haben sollten. Das kann doch kein Zufall sein! Oder nur eine echte Koinzidenz?
So unterschied Carter seine zwei Versionen des anthropischen Prinzips: eine schwache Form, wonach alle physikalischen Parameter, die unsere Natur charakterisieren, durch die Tatsache eingeschränkt sind, dass wir existieren. Und eine starke Form, wonach das Universum so gebaut sein muss, um einmal in seiner Entwicklung die Existenz von Beobachtern zu ermöglichen. Im Jahr 1986 fügten dann J. D. Barrow und F. J. Tipler in ihrem Buch "The Anthropic Cosmological Principle" eine noch schärfere Variante hinzu: das finale anthropische Prinzip. Dieses fordert, dass vernunftbegabte Informations¬verarbeitung im Universum entstehen muss, und, wenn sie einmal entstanden ist, nie wieder ausstirbt.
In welchem Rahmen ist intelligentes Leben möglich?
Es war natürlich sowohl Carter als auch Barrow und Tipler völlig klar (und sie betonten das auch), dass sowohl das starke wie auch ihr finales anthropisches Prinzip hochspekulativ waren. Aber umso spannender war es für mich zu sehen, was sich allein aus dem wenig kontroversen schwachen AP argumentativ an Einsichten herausholen ließ. Sowohl Brandon Carter als auch nach ihm 1979 Bernhard Carr und Martin Rees in einem "Nature"-Artikel (und danach eine Reihe weiterer Forscher, zumeist Astrophysiker) nahmen sich der Sache systematisch an. Ihre Frage: Wie müssen ein Universum und seine Naturgesetze beschaffen sein, um noch intelligentes Leben zuzulassen?
Wie klärt man das, ohne in schieren Anthropozentrismus zu verfallen? Denn natürlich orientiert sich jede Definition von "Leben" oder "intelligente Beobachter" am irdischen Beispiel. Gleichwohl kann man sich auf allgemeine Prinzipien einigen, die etwa die Notwendigkeit biologischer Informationsspeicher und ihre Fähigkeit zu Reproduktion, Mutation und Selektion betrifft. Das sollte auch für außerirdische Intelligenzen im All zutreffen, die gänzlich andere Evolutionspfade beschritten haben.
Die zweite Einschränkung: Die Naturgesetze sind, wie sie sind, jedoch enthalten die physikalischen Theoriegebäude an die zwei Dutzend freie Parameter: vor allem die Stärken der Fundamentalkräfte sowie die Massen von Elementarteilchen. Die AP-Forscher variieren nun der Reihe nach alle diese Parameter (ohne die Form der Naturgesetze selbst zu ändern) und versuchen die Grenzen auszuloten, ab denen der Kosmos keine intelligenten Beobachter mehr hervorbringen könnte.
Grenzen in einem grenzenlosen Universum?
Dazu ist es nützlich, sich etwas abstrakter einen 24-dimensionalen Parameterraum aller Naturkonstanten vorzustellen, dessen Ursprung unser Universum mit all seinen tatsächlichen Eigenschaften einnimmt. Seine Dimensionen sind genau jene (dimensionslos gemachten) Naturkonstanten, die in unseren Naturgesetzen auftauchen. Ohne hier auf Details einzugehen, lässt sich das Ergebnis aller entsprechenden Studien so zusammenfassen: Jede der Parametervariationen ist offenbar nur in einer ganz kleinen Umgebung des Ursprungs möglich, wenn man die Nebenbedingung unserer Existenz (oder einer ähnlich komplexen außerirdischen Lebensform) beibehält. (Auch was "kleine Umgebung" im Parameterraum bedeutet, lässt sich halbwegs vernünftig festlegen.) In dieser Fassung halte ich das schwache AP für eine nützliche Betrachtung im Sinn eines Selektionsprinzips.
Selektionsprinzip? Da unser Universum, wie der Name verrät, nur eines ist, lässt sich da nicht wirklich viel auswählen. Wie also soll eine naturwissenschaftliche Herleitung dann klären können, warum das Universum gerade so und nicht anders ist? Gerät das anthropische Prinzip also nicht unweigerlich in einen Zirkelschluss: Das Universum ist so, wie es ist, weil wir sonst nicht hier wären, um diese Fragen zu stellen?
Hier kommt jetzt – Überraschung! – die Stringtheorie ins Spiel. Unter anderem behauptet sie, als Erweiterung des Standardmodells und als Supertheorie zur Vereinigung aller Fundamentalkräfte, dass unser Kosmos lediglich einen Fall unter sehr vielen, vielleicht 10 hoch 500, anderen Universum darstellt. Die "wirkliche" Anzahl ist hier nicht so wichtig, außer dass es laut Stringtheorie "viele" sein sollen.
Aus 1 mach 10 hoch 500 Universen
Diese Behauptung machte viele schier wahnsinnig. Auch Dieter Lüst gibt in seinem Essay ("Ist die Stringtheorie noch eine Wissenschaft?", SdW 5/2009, S. 34) zu: "Die Suche nach einer Weltformel, die Aussagen über ein einziges Universum macht, ... ist wahrscheinlich zu naiv gewesen." Und er räumt ein, dass "mit dem stringtheoretischen Bild eines Multiversums" die Physik zumindest einen Großteil ihrer "Vorhersagekraft" verliere. "So scheint die Stringtheorie alles vorherzusagen und damit letztlich nichts."
Folgt man dieser, leider experimentell unprüfbaren, Behauptung, dann gäbe es mindestens zwei Sorten von Universen: solche, in denen keine Beobachter vorkommen, und solche, wo die Naturgesetze und ihre Parameter so aufeinander abgestimmt sind, dass auch Beobachter entstehen können.
Wie Dieter Lüst in seinem "Spektrum"-Essay erklärt, liefert das anthropische Prinzip keine Zahlenwerte für konkrete physikalische Größen. Jedoch sei es dennoch mehr als eine "philosophische Spitzfindigkeit". Es löse nämlich zwei alte Probleme der Physik:
1. Warum haben unsere Naturgesetze gerade die Form, die wir beobachten?
2. Warum scheinen unsere Naturkonstanten so fein abgestimmt zu sein, dass sie Leben ermöglichen, wie wir es kennen?
Unzählige Möglichkeiten in unzähligen Universen
Darin, so Lüst, liegt die Lösung dieser Fragen: "In beiden Fällen stützt sich das anthropische Prinzip auf das Gesetz der großen Zahlen: In einer hinreichend großen Stichprobe muss alles, was möglich ist, irgendwo realisiert sein." Worin liegt nun die Erklärungskraft dieser Betrachtung? Unsere Kombination von Naturkonstanten wäre demnach kein Spezialfall des einzigen existierenden Universums mehr; vielmehr wird sie im Multiversum "statistisch notwendig".
Ich bin sicher, dass diese Art des Argumentierens nicht jeden Physiker zufrieden stellt. Auch Dieter Lüst ist sich klar, dass "es den Rückzug von einer Theorie bedeutet, die klare Vorhersagen und Erklärungen für die Welt liefern" könnte. Doch wer sie akzeptiere, dem gebe "die Theorie des Multiversums – nach Kopernikus und Darwin – dem Menschen vielleicht sogar eine Sonderrolle wieder zurück".
Reinhard Breuer
Es war auf einer Tagung in Krakau, im Jahr 1973. Als junger Postdoc am MPI für Astrophysik (München) besuchte ich das Kopernikus-Symposium über Relativistische Astrophysik. Ich lauschte einem Theoretiker aus Cambridge (heute Meudon bei Paris), Brandon Carter. Er hielt einen Vortrag über "Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology". Darin vertrat er eine für einen hartgesottenen Relativitätstheoretiker etwas abseitige These: Das Leben müsse zumindest kompatibel sein mit den Naturgesetzen sowie der kosmischen Entwicklung.
Warum abseitig? Natürlich ist alles, was wir im Universum vorfinden, Ausdruck der Naturgesetze sowie der kosmischen Entwicklung, die Menschheit inklusive. Also was soll’s?
Die rätselhafte Feinjustierung der Naturgesetze
Carter sah Belege für die Hypothese vom anthropischen Prinzip, die vor ihm schon der Princeton-Physiker Robert H. Dicke 1961 geäußert hatte, in den bereits von Paul Dirac betrachteten "kosmischen Koinzidenzen". Bestimmte Zahlenverhältnisse in der Natur und ihrer Geschichte seien doch einigermaßen verblüffend. Immer taucht da die Zahl 10 hoch 40 auf. Das Universum ist, gemessen in Atomzeiteinheiten, 10 hoch 40 Einheiten alt. Die gleiche Zahl taucht auf als Verhältnis von elektrischer Kraft zu Gravitationskraft. Und die Teilchenzahl im sichtbaren Universum ist in etwa das Quadrat dieser Zahl, also 10 hoch 80. Es lassen sich noch weitere solcher Relationen finden.
Ja, das lässt fast jeden rätseln, vor allem darüber, was eigentlich zeitabhängige Größen (das kosmische Alter) mit unserer Atomphysik zu tun haben sollten. Das kann doch kein Zufall sein! Oder nur eine echte Koinzidenz?
So unterschied Carter seine zwei Versionen des anthropischen Prinzips: eine schwache Form, wonach alle physikalischen Parameter, die unsere Natur charakterisieren, durch die Tatsache eingeschränkt sind, dass wir existieren. Und eine starke Form, wonach das Universum so gebaut sein muss, um einmal in seiner Entwicklung die Existenz von Beobachtern zu ermöglichen. Im Jahr 1986 fügten dann J. D. Barrow und F. J. Tipler in ihrem Buch "The Anthropic Cosmological Principle" eine noch schärfere Variante hinzu: das finale anthropische Prinzip. Dieses fordert, dass vernunftbegabte Informations¬verarbeitung im Universum entstehen muss, und, wenn sie einmal entstanden ist, nie wieder ausstirbt.
In welchem Rahmen ist intelligentes Leben möglich?
Es war natürlich sowohl Carter als auch Barrow und Tipler völlig klar (und sie betonten das auch), dass sowohl das starke wie auch ihr finales anthropisches Prinzip hochspekulativ waren. Aber umso spannender war es für mich zu sehen, was sich allein aus dem wenig kontroversen schwachen AP argumentativ an Einsichten herausholen ließ. Sowohl Brandon Carter als auch nach ihm 1979 Bernhard Carr und Martin Rees in einem "Nature"-Artikel (und danach eine Reihe weiterer Forscher, zumeist Astrophysiker) nahmen sich der Sache systematisch an. Ihre Frage: Wie müssen ein Universum und seine Naturgesetze beschaffen sein, um noch intelligentes Leben zuzulassen?
Wie klärt man das, ohne in schieren Anthropozentrismus zu verfallen? Denn natürlich orientiert sich jede Definition von "Leben" oder "intelligente Beobachter" am irdischen Beispiel. Gleichwohl kann man sich auf allgemeine Prinzipien einigen, die etwa die Notwendigkeit biologischer Informationsspeicher und ihre Fähigkeit zu Reproduktion, Mutation und Selektion betrifft. Das sollte auch für außerirdische Intelligenzen im All zutreffen, die gänzlich andere Evolutionspfade beschritten haben.
Die zweite Einschränkung: Die Naturgesetze sind, wie sie sind, jedoch enthalten die physikalischen Theoriegebäude an die zwei Dutzend freie Parameter: vor allem die Stärken der Fundamentalkräfte sowie die Massen von Elementarteilchen. Die AP-Forscher variieren nun der Reihe nach alle diese Parameter (ohne die Form der Naturgesetze selbst zu ändern) und versuchen die Grenzen auszuloten, ab denen der Kosmos keine intelligenten Beobachter mehr hervorbringen könnte.
Grenzen in einem grenzenlosen Universum?
Dazu ist es nützlich, sich etwas abstrakter einen 24-dimensionalen Parameterraum aller Naturkonstanten vorzustellen, dessen Ursprung unser Universum mit all seinen tatsächlichen Eigenschaften einnimmt. Seine Dimensionen sind genau jene (dimensionslos gemachten) Naturkonstanten, die in unseren Naturgesetzen auftauchen. Ohne hier auf Details einzugehen, lässt sich das Ergebnis aller entsprechenden Studien so zusammenfassen: Jede der Parametervariationen ist offenbar nur in einer ganz kleinen Umgebung des Ursprungs möglich, wenn man die Nebenbedingung unserer Existenz (oder einer ähnlich komplexen außerirdischen Lebensform) beibehält. (Auch was "kleine Umgebung" im Parameterraum bedeutet, lässt sich halbwegs vernünftig festlegen.) In dieser Fassung halte ich das schwache AP für eine nützliche Betrachtung im Sinn eines Selektionsprinzips.
Selektionsprinzip? Da unser Universum, wie der Name verrät, nur eines ist, lässt sich da nicht wirklich viel auswählen. Wie also soll eine naturwissenschaftliche Herleitung dann klären können, warum das Universum gerade so und nicht anders ist? Gerät das anthropische Prinzip also nicht unweigerlich in einen Zirkelschluss: Das Universum ist so, wie es ist, weil wir sonst nicht hier wären, um diese Fragen zu stellen?
Hier kommt jetzt – Überraschung! – die Stringtheorie ins Spiel. Unter anderem behauptet sie, als Erweiterung des Standardmodells und als Supertheorie zur Vereinigung aller Fundamentalkräfte, dass unser Kosmos lediglich einen Fall unter sehr vielen, vielleicht 10 hoch 500, anderen Universum darstellt. Die "wirkliche" Anzahl ist hier nicht so wichtig, außer dass es laut Stringtheorie "viele" sein sollen.
Aus 1 mach 10 hoch 500 Universen
Diese Behauptung machte viele schier wahnsinnig. Auch Dieter Lüst gibt in seinem Essay ("Ist die Stringtheorie noch eine Wissenschaft?", SdW 5/2009, S. 34) zu: "Die Suche nach einer Weltformel, die Aussagen über ein einziges Universum macht, ... ist wahrscheinlich zu naiv gewesen." Und er räumt ein, dass "mit dem stringtheoretischen Bild eines Multiversums" die Physik zumindest einen Großteil ihrer "Vorhersagekraft" verliere. "So scheint die Stringtheorie alles vorherzusagen und damit letztlich nichts."
Folgt man dieser, leider experimentell unprüfbaren, Behauptung, dann gäbe es mindestens zwei Sorten von Universen: solche, in denen keine Beobachter vorkommen, und solche, wo die Naturgesetze und ihre Parameter so aufeinander abgestimmt sind, dass auch Beobachter entstehen können.
Wie Dieter Lüst in seinem "Spektrum"-Essay erklärt, liefert das anthropische Prinzip keine Zahlenwerte für konkrete physikalische Größen. Jedoch sei es dennoch mehr als eine "philosophische Spitzfindigkeit". Es löse nämlich zwei alte Probleme der Physik:
1. Warum haben unsere Naturgesetze gerade die Form, die wir beobachten?
2. Warum scheinen unsere Naturkonstanten so fein abgestimmt zu sein, dass sie Leben ermöglichen, wie wir es kennen?
Unzählige Möglichkeiten in unzähligen Universen
Darin, so Lüst, liegt die Lösung dieser Fragen: "In beiden Fällen stützt sich das anthropische Prinzip auf das Gesetz der großen Zahlen: In einer hinreichend großen Stichprobe muss alles, was möglich ist, irgendwo realisiert sein." Worin liegt nun die Erklärungskraft dieser Betrachtung? Unsere Kombination von Naturkonstanten wäre demnach kein Spezialfall des einzigen existierenden Universums mehr; vielmehr wird sie im Multiversum "statistisch notwendig".
Ich bin sicher, dass diese Art des Argumentierens nicht jeden Physiker zufrieden stellt. Auch Dieter Lüst ist sich klar, dass "es den Rückzug von einer Theorie bedeutet, die klare Vorhersagen und Erklärungen für die Welt liefern" könnte. Doch wer sie akzeptiere, dem gebe "die Theorie des Multiversums – nach Kopernikus und Darwin – dem Menschen vielleicht sogar eine Sonderrolle wieder zurück".
Reinhard Breuer
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben