Medizin: Bessere Früherkennung von Brustkrebs
Die Früherkennung von Brustkrebs stellt gerade bei jungen Frauen, die familiär vorbelastet sind und dadurch ein höheres Erkrankungsrisiko tragen, immer noch ein ernsthaftes Problem dar – unter anderem, weil die derzeit etablierte Röntgen-Mammografie für diese Personengruppe offenbar nicht sensitiv genug ist. Dies könnte sich nach Ansicht der Radiologin und Privatdozentin Christiane Kuhl von der Universitätsklinik Bonn mithilfe der Magnetresonanz-Tomogra-fie (MRT, auch Kernspin-Tomografie genannt) ändern.
Bereits vor einigen Jahren haben Forscher der Bonner Universitätsklinik die Eignung der MRT für die Früherkennung des familiären, erblich bedingten Mammakarzinoms untersucht. Die Ergebnisse dieser Pionierarbeit ermutigten andere Gruppen weltweit, eigene Studien zu beginnen. Untersuchungen in den USA und den Niederlanden bestätigten, dass die MRT tatsächlich die empfindlichste Methode ist, um Brustkrebs bei jungen "Hochrisiko-Frauen" zu entdecken. Allerdings hatte die MRT in diesen Studien nur einen ziemlich niedrigen "positiven Prädiktivwert". Diese Zahl gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass bei einer Patientin tatsächlich Brustkrebs vorliegt, wenn die Untersuchung einen auffälligen Befund ergeben hat.
Aufsehen erregten daher die Ergebnisse einer umfangreichen Studie zur MRT-Früherkennung des familiären Mammakarzinoms, die Christiane Kuhl im Juni 2003 auf einem Treffen der American Society of Clinical Oncology in Chicago vorstellte. Die Radiologin hatte über fünf Jahre – von 1996 bis 2001 – an der Bonner Klinik 462 "Risikofrauen" einmal jährlich sowohl mit der Röntgen-Mammografie, dem Ultraschall als auch mit der Magnetresonanz-Tomografie auf Brustkrebs untersucht. Aufgenommen in die Studie wurden Patientinnen, die entweder als Trägerin defekter BRCA1- beziehungsweise BRCA2-Gene identifiziert worden waren oder die auf Grund ihrer eigenen oder der familiären Krankheitsgeschichte als Trägerin eines mutierten Tumor-Suppressor-Gens "verdächtigt" wurden. Tumor-Suppressor-Gene sind – vereinfacht ausgedrückt – dafür zuständig, Mutationen, die zum Beispiel durch ionisierende Strahlen entstanden sind, zu korrigieren und damit der Entwicklung von Karzinomen vorzubeugen.
Der Studie zufolge erreichte die MRT verglichen mit der Röntgen-Mammografie und der Sonografie nicht nur die höchste Sensitivität (das heißt, es wurden konkret mehr als doppelt so viele Karzinome gefunden wie mit Mammografie und Ultraschall zusammen), sondern hatte mit 57 Prozent auch einen doppelt so hohen positiven Prädiktivwert wie die Mammografie. In einem Gespräch mit "Spektrum der Wissenschaft" erläutert Christiane Kuhl, warum die MRT für junge Risikopatientinnen das Mittel der Wahl ist.
Spektrum der Wissenschaft: In Deutschland erkranken rund 46000 Frauen jährlich an Brustkrebs, bei einem Drittel verläuft die Erkrankung tödlich. Hängt die Prognose auch davon ab, ob es sich dabei um familiären, also erblich bedingten, oder um sporadischen Brustkrebs handelt?
Christiane Kuhl: Grundsätzlich ja, denn Ursachen, radiologisches Aussehen und klinischer Verlauf sind verschieden. Die körpereigene Krebs-Abwehr verfügt über "Tumor-Suppressor-Gene", die schädliche Mutationen korrigieren. Wenn ein solches Suppressor-Gen selbst durch eine Mutation funktionsunfähig wird, kann eine Korrektur nicht mehr erfolgen, und die mutierte Zelle kann sich im schlimmsten Fall zu einem Karzinom weiterentwickeln. Jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens von einem solchen sporadischen Mammakarzinom betroffen. Von einem familiären Mammakarzinom, das etwa zehn Prozent aller Brustkrebsfälle ausmacht, spricht man dann, wenn die Frauen bereits eine defekte Kopie eines Tumor-Suppressor-Gens ererbt haben. Diese Frauen haben ein Risiko von achtzig Prozent, an Brustkrebs zu erkranken. Das familiäre Mammakarzinom tritt daher deutlich eher auf als das sporadische, oft im Alter zwischen dreißig und vierzig; mehr als die Hälfte der Frauen erkrankt vor dem fünfzigsten Lebensjahr.
Spektrum: Die Vorsorge muss also bei diesen Frauen sehr früh beginnen?
Kuhl: Ja, und zwar viel früher als bei Frauen ohne besondere familiäre Belastung: in einem Alter von etwa dreißig Jahren. Und wir müssen das Screening-Verfahren der oft erhöhten Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors anpassen, also in kurzen Zeitabständen kontrollieren. Bislang wurde hierfür die Röntgen-Mammografie eingesetzt – allerdings mit sehr bescheidenen Resultaten, was auch durch unsere Studie bestätigt wurde. Denn das Drüsengewebe junger, dreißig- bis vierzigjähriger Frauen ist in der Regel noch voll entwickelt und sehr dicht. Wenn nun ein Tumor im dichten Drüsengewebe eingebettet ist, können wir ihn mit der Röntgen-Mammografie oft nicht erkennen. Mit zunehmendem Alter bildet sich das Drüsengewebe zurück und wird durch Fettgewebe ersetzt. Das ist bei Frauen um die fünfzig, die üblicherweise zur Mammografie kommen, meistens bereits der Fall.
Spektrum: Wo liegt denn dann der Vorteil der Röntgen-Mammografie?
Kuhl: Einige Mammakarzinome und deren Vorstufen prägen manchmal kleinste Kalkpartikel aus. Über diese Mikroverkalkungen sind die Karzinome auch im Röntgenbild indirekt zu erkennen, selbst wenn sie in dichtem Drüsengewebe liegen. Das ist ein spezifischer Vorteil der Röntgen-Mammografie, denn weder die MRT noch Ultraschall vermögen Mikroverkalkungen nachzuweisen. Allerdings relativiert sich dieser Vorteil bei Frauen mit familiärem Mammakarzinom sehr, denn diese Erkrankungen prägen offenbar weit seltener Mikroverkalkungen aus als sporadische Mammakarzinome.
Spektrum: Für die Patientinnen ist auch die Strahlenbelastung ein Thema ...
Kuhl: Natürlich. Da das Röntgen-Screening bereits im Alter von dreißig Jahren beginnt, erhalten gerade jene Frauen, die auf Grund eines Gendefekts Strahlenschäden nicht korrigieren können, durch die ionisierende Röntgenstrahlung eine deutlich höhere kumulative Lebenszeit-Dosis als die mutmaßlich "genetisch intakten" Frauen. Eine solche Zusatzbelastung sollte aber tunlichst vermieden werden – etwa durch Einsatz der MRT, die ohne Röntgenstrahlung auskommt.
Spektrum: Ziel Ihrer Studie war es also, für junge Frauen mit familiärem Mammakarzinom das geeignetste Screening-Verfahren zu finden?
Kuhl: Wir hielten es für notwendig, Röntgen-Mammografie, Ultraschall und Magnetresonanz-Tomografie parallel zur Früherkennung des familiären Mammakarzinoms einzusetzen, um zu klären, welche Methode die beste und sicherste Diagnose liefert. Denn was man bisher über die "ererbte" Form des Brustkrebses weiß, zeigt, wie wichtig eine zuverlässige Früherkennung ist.
Spektrum: Können Sie das noch näher erläutern?
Kuhl: Nachdem Mitte der 1990er Jahre zwei der wichtigsten Tumor-Supressor-Gene namens BRCA1 und BRCA2 identifiziert worden waren, konnte man erstmals darangehen, Frauen auf einen Gendefekt zu testen, der möglicherweise für Brustkrebs verantwortlich ist. Die Deutsche Krebshilfe hat daraufhin eine Multicenter-Studie ins Leben gerufen, deren Hauptzweck es zunächst war, diese Genmutationen zu erforschen und die betroffenen Frauen zu beraten. Wir waren hier in Bonn der Meinung, dass wir den Frauen weiterführende Hilfe anbieten müssen. Denn die Genmutation an sich kann derzeit ja nicht therapiert werden – mithin bleibt die Früherkennung unverzichtbar. Selbst dann, wenn der gesamte Brustdrüsenkörper prophylaktisch entfernt wird, was zum Beispiel in den USA Frauen mit dokumentierter Genmutation angeboten wird, bleibt ein Restrisiko bestehen.
Spektrum: Und wenn der Gentest keine Mutation ergeben hat? Können die Frauen sich dann sicher fühlen?
Kuhl: Der Gentest ist leider nur begrenzt tauglich, um Frauen, die sich ausweislich ihrer Eigen- oder Familienanamnese in einer "Hochrisiko-Situation" befinden, von ihrer Angst zu befreien. Die bislang bekannten BRCA-Mutationen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nur für die Hälfte aller familiär bedingten Mammakarzinome verantwortlich. Auch bei einem negativen Testergebnis dürfen diese Frauen also nicht aus der intensivierten Früherkennung entlassen werden.
Spektrum: Welche Ergebnisse hat nun Ihre Studie erbracht?
Kuhl: Bereits unsere ersten Resultate haben die Überlegenheit der MRT überaus deutlich gezeigt. Wir hatten mit diesem Verfahren doppelt so viele Karzinome gefunden wie mit der Röntgen-Mammografie und nur halb so viele falsche positive Befunde. Das hat uns dazu ermutigt, die Studie fortzuführen.
Spektrum: Worauf beruht die hohe Empfindlichkeit der Magnetresonanz-Tomografie?
Kuhl: Wir verwenden grundsätzlich ein Kontrastmittel, eine sehr verträgliche Gadoliniumverbindung. Das Kontrastmittel verteilt sich im Blutstrom und reichert sich dort an, wo die Durchblutung verstärkt ist. Das Wachstum von bösartigen Tumoren geht mit der Ausbildung zusätzlicher Blutgefäße einher, deren Wände undicht und löchrig sind. Diese pathologischen Veränderungen im Tumor werden durch die MRT sichtbar.
Spektrum: Sie beurteilen nicht nur ein verdächtiges Aussehen, sondern auch eine verdächtige Kinetik der Kontrastmittelanreicherung.
Kuhl: Ja. Gutartige Veränderungen sind normalerweise durch glatte Ränder charakterisiert. Bösartige Tumoren hingegen wuchern in das umgebende Gewebe hinein und weisen deshalb keine scharfen Ränder auf. Eine solche Unterscheidung ist bereits mit Ultraschall und Röntgen-Mammografie möglich, funktioniert bei der MRT aber noch besser. Und Sie haben eine zusätzliche Information: Sie sehen, wie schnell sich das Kontrastmittel anreichert. Zu einem bösartigen Tumor gelangt das Kontrastmittel sehr schnell.
Spektrum: Warum beurteilen viele Ärzte eine MRT-Untersuchung der Brust immer noch recht kritisch?
Kuhl: Das Kontrastmittel reichert sich überall dort an, wo die Zellvermehrung verstärkt ist. Deshalb ist es manchmal schwierig, den Wald vor lauter Bäumen noch zu erkennen. Anders als bei Mammografie und Ultraschall ist bei der MRT die eigentliche Detektion absolut unproblematisch. Die Kunst ist eher die Klassifizierung der Befunde in gutartig oder bösartig. Man muss viele Fälle gesehen haben, um eine hohe Sicherheit der MRT-Befunde zu erreichen und unnötige Operationen zu vermeiden.
Spektrum: Verwenden denn die anderen Forschungsgruppen, welche die Eignung der MRT für die Brustkrebsdiagnostik untersuchen, die gleichen Kriterien für die Beurteilung?
Kuhl: Grundsätzlich machen wir nichts anderes als unsere Kollegen. Aber für die MRT gilt genauso wie für die Röntgen-Mammografie, dass die Qualität der Befunde mit der Erfahrung des Untersuchers wächst. Wir sehen hier seit über zehn Jahren jährlich rund 2000 MRTs der Brust. Damit sind wir schon allein hinsichtlich dieser Zahl eines der international stärksten Zentren.
Spektrum: Ihre Studie ist nun abgeschlossen. Wie geht es weiter?
Kuhl: Die Ergebnisse unserer Bonner Studie sind nicht ohne weiteres übertragbar, schon deshalb nicht, weil wir hier auf Grund der hohen Patientenzahlen eine besonders hohe Befundsicherheit anbieten können. Seit 2002 finanziert die Deutsche Krebshilfe eine so genannte Multicenter-Studie, die bis mindestens 2005 laufen wird. Dabei wird das Abschneiden der verschiedenen Verfahren an mehreren Standorten miteinander verglichen. An dieser Studie, die rund tausend Patientinnen erfasst, nehmen außer unserer Klinik noch die Universitätskliniken Großhadern, Ulm und Münster teil.
Spektrum: Wie sieht die Situation für Frauen aus, die nicht an der Studie teilnehmen: Übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die MRT?
Kuhl: Bei strenger Indikation mittlerweile ja. Aber es ist immer noch viel einfacher, für jedes andere Organ eine MRT auf Krankenschein zu bekommen als für die Brust – obwohl sich gerade hier das Verfahren als äußerst effizient herausgestellt hat. Mit der MRT erreichen Sie nicht nur eine hohe Sensitivität bei der Diagnostik des familiären, sondern auch bei derjenigen des sporadischen Mammakarzinoms der nicht erblich belasteten Frau. Speziell für die Therapieplanung liefert sie wichtige Hinweise: Frauen, bei denen per Röntgen-Mammografie oder Ultraschall ein Karzinom nachgewiesen wurde, sollten sich vor einer brusterhaltenden Operation noch einer MRT unterziehen. Das wird bisher viel zu selten gemacht. Denn bei bis zu zwanzig Prozent der Frauen mit vermeintlich einzelnem Herd finden Sie mit der MRT weitere Tumoren in derselben oder in der gegenseitigen Brust. Diese sollten natürlich ebenfalls bei der Operation entfernt werden! Auch kleinste Rezidivherde der bereits operierten Brust werden mit der MRT gefunden und können unproblematisch von Narben unterschieden werden, was mit Mammografie und Sonografie grundsätzlich nicht möglich ist.
Spektrum: Für die junge "Risikofrau" ist also die MRT das Mittel der Wahl für die Früherkennung. Welche Empfehlung geben Sie der "Normalfrau"?
Kuhl: Auch Frauen ohne familiäre Vorbelastung haben ein Risiko von zwölf Prozent, an sporadischem Brustkrebs zu erkranken. Die Röntgen-Mammografie ist für diese Frauen sicherlich nach wie vor die Basis für eine Früherkennung und sollte vom vierzigsten Lebensjahr an einmal jährlich durchgeführt werden. Wir nehmen aber an, dass die MRT auch hinsichtlich der Früherkennung des sporadischen Mammakarzinoms der Mammografie und dem Ultraschall überlegen ist. Doch gibt es bislang noch keine aussagefähigen Studien zu dieser Patientinnengruppe. Wir würden eine solche Studie gerne durchführen, aber es ist in Deutschland außerordentlich schwierig, für solche klinischen Studien Drittmittelgeber zu finden – speziell, da hier, im Gegensatz zu den von der pharmazeutischen Industrie unterstützten Medikamentenstudien, kein Sponsor die fehlende staatliche Förderung ausgleicht.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 10 / 2003, Seite 86
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH




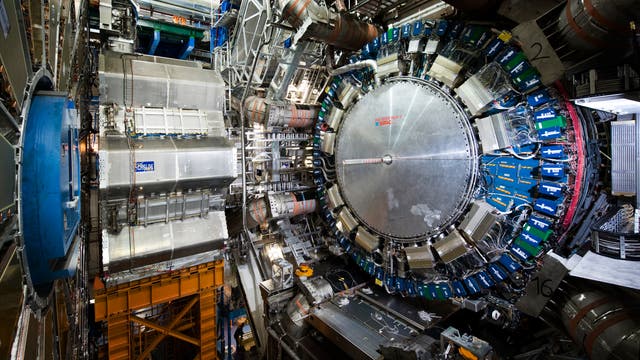

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben