Technologietrends: Bewirtschaftung des Regenwaldes
Neuere Studien im Amazonasgebiet zeigen, daß eine profitable Bewirtschaftung tropischer Regenwälder durchaus möglich ist, ohne noch mehr dieser für die gesamte Erde bedeutsamen Ökosysteme zu zerstören.
Reglos blinzeln zwei große, braune Kröten im Schein der Taschenlampe. Unterdes scheinen grün leuchtende Augenpaare langsam über den laubbedeckten Boden zu kriechen – Leuchtorgane auf dem Rücken von Schnellkäfern. Heute nacht möchte Barbara L. Zimmerman unserer Gruppe, die sie durch das Dunkel des brasilianischen Regenwaldes führt, den aufregendsten Frosch überhaupt zeigen, wie sie ankündigt. Den bellenden Ruf hat die Tropenbiologin bereits gehört; doch zu sehen bekommen wir das kräftig smaragdgrüne Amphib Phyllomedusa bicolor nicht.
Statt dessen taucht die rote Iris eines anderen Laubfrosches, der grünen Phyllomedusa tarsius, auf. Und wir entdecken einen hellgrünen Stelzenläuferleguan mit schokoladenbraunen Flecken namens Plica plica sowie zwei riesige giftige Aga-Kröten (Bufo marinus) und bewundern zuletzt noch den Bewohner des Abflußrohrs im Lager, einen Frosch der Art Osteocephalus taurinus, der unermüdlich volltönend ruft. Das ist typisch für den noch immer größten zusammenhängenden tropischen Urwald der Erde: Man findet stets etwas anderes, als man sucht.
Unsere Exkursionsleiterin hat bis vor kurzem in einem Gebiet 70 Kilometer nördlich von Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundestaates Amazonas, das Paarungsverhalten von Fröschen erforscht. Jetzt gilt ihr Hauptinteresse den menschlichen Bewohnern, wie überhaupt hierzulande in letzter Zeit immer mehr Regenwald-Experten sich den dringenden Problemen von Nutzung und Erhalt dieses bedrohten Lebensraums zuwenden. Barbara Zimmerman gehört zu einem Team von Tropenwissenschaftlern, das untersucht, wie die verschiedenen Interessen sich vereinbaren lassen. Sie erörtern in vielen Aspekten, was doch letztlich auf den hier überdeutlichen fundamentalen Gegensatz Ökologie/Ökonomie hinausläuft.
Sehr viele der Forscher geben dem Wald am wasserreichsten Flußsystem der Welt (Bild 2) keine Zukunft mehr. Der größte Teil der fünf Millionen Quadratkilometer, fürchten sie, wird verschwunden sein, während sie noch versuchen, den biologischen Reichtum überhaupt erst ansatzweise zu erfassen.
Tropische und subtropische Regenwälder mögen weltweit nur 7 Prozent der Landfläche bedecken, aber sie beherbergen wohl gut 50 Prozent aller pflanzlichen und tierischen Arten (über deren Gesamtzahl man sich streitet; es könnten zwei, aber auch dreißig Millionen sein). Nach einer Schätzung des Biologen Edward O. Wilson von der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts) sterben alljährlich rund 27000 Spezies allein deshalb aus, weil der Mensch ihnen den Lebensraum nimmt; insbesondere werden stündlich schätzungsweise 1800 Hektar ursprünglicher Wälder abgeholzt oder niedergebrannt.
Daß man sich weltweit gerade um die Waldgebiete Brasiliens sorgt und vor Ort dafür kämpft, hängt damit zusammen, daß die Artenvielfalt in diesem Land vermutlich die höchste der Welt ist; und bislang sind wohl erst 12 Prozent des Amazonas-Regenwalds vernichtet, so daß der Ruin vielleicht doch aufzuhalten wäre. Andererseits ist die föderative Republik, die fast die Hälfte Südamerikas einnimmt, mit 121 Milliarden US-Dollar verschuldet; viele der rund 150 Millionen Einwohner sind sehr arm, und das Wohlstandsgefälle ist extrem. Jeder Versuch, die Natur zu retten, muß scheitern, solange er nicht gleichzeitig und auf Dauer die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung verbessert.
Die Wissenschaftler hoffen nun, in Zusammenarbeit mit den Menschen, die im und vom Urwald leben, Kompromisse zu finden, die das Dilemma auflösen: Wie kann man erträgliche Lebensverhältnisse schaffen, ohne die dafür nötigen Ressourcen zu erschöpfen? Es gilt, das bei aller Üppigkeit äußerst verletzliche Ökosystem Regenwald zu bewahren und dabei den Interessen von noch intakten Indio-Stämmen wie von Kautschuksammlern, kleinbäuerlichen Siedlern, Saisonarbeitern und Großunternehmern in Holz- und Agrarwirtschaft gerecht zu werden – und das rasch. „Hauptsache, es geschieht überhaupt etwas in dieser Richtung“, diesen Slogan verbreitet Don E. Wilson, der Leiter des Programms zur biologischen Vielfalt der Smithsonian Institution, die ihren Sitz in der US-Bundeshauptstadt Washington hat.
Die Idee all solcher Konzepte ist, für eine nachhaltige, zukunftsträchtige Entwicklung zu sorgen. Auch die Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, stand unter diesem Motto. Es ist schon fast zur modischen Phrase geworden und fehlt auf beinahe keinem Antrag für einen Zuschuß oder Kredit mehr, der für entsprechende Projekte eingesetzt werden soll. Wie ein nachhaltiges System auf der Basis des brasilianischen Regenwalds aber funktionieren könnte, das ist noch keineswegs klar. Die Forscher tragen bisher nur einzelne Teile eines Konzepts zusammen, dessen Gesamtmuster sich erst allenfalls erahnen läßt – nicht viel anders als bei dem komplexen ökologischen System, auf dem es gründet.
Dennoch zeichnen sich langsam erste wissenschaftlich fundierte Fortschritte ab. Nicht selten stehen sie im Widerspruch zu dem, was man bisher für ökologisch vertretbar und möglich hielt. So versucht man herauszufinden, wie die Millionen Hektar brandgerodeter Flächen, die zu Weideland wurden, aber bald auslaugten und jetzt brachliegen, wieder nutzbar gemacht werden können. Zwar vermag sich die dünne Humusschicht der Böden dieser tropischen Zone nicht von allein zu regenerieren. Doch wie man mittlerweile weiß, müssen gerodete Gebiete nicht notwendig veröden, sondern eignen sich bei richtiger Bearbeitung und Düngung durchaus für Feldbau und Forstwirtschaft (siehe „Schwierigkeiten tropischer Bodenkultur“ von Wolfgang Weischet, Spektrum der Wissenschaft, Juli 1984, Seite 112). Ein solches Regime würde den noch unberührten Primärwald erheblich von weiteren Attacken entlasten. Sogar die inzwischen verpönte Viehzucht wäre nach einer neueren Studie mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit verträglich.
Indianische Interessen
Aber Brasilien ist groß, und entsprechend divers sind die Meinungen. Auch wer in diesem Labyrinth der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme einem Ariadne-Faden zu folgen meint, findet schwerlich einen Ausweg, sondern stößt am Ende doch wieder auf einen Minotaurus. Zu den umstrittensten Themen gehört die Zukunft der Indios. In einem der abgelegenen Reservate, bei den Kayapó (Bild 3), arbeitet nun Barbara Zimmerman.
Unterstützt von der Umweltorganisation Conservation International und der gemeinnützigen David-Suzuki-Stiftung aus Kanada baut sie dort – nahe dem Rio Xingu im Süden des Bundesstaates Pará – eine Forschungsstation auf. Dafür haben ihr die Bewohner des Ortes Aukre, was soviel heißt wie „wo der Grund des Flusses tost“, 5000 Hektar inmitten der von ihnen kontrollierten 500000 Hektar Regenwald überlassen.
Zunächst einmal soll die biologische Vielfalt dieser bislang wenig erforschten Region erfaßt werden. Selbst in benachbarten Gebieten ist das Artenspektrum oft gänzlich verschieden, erläutert die Wissenschaftlerin; zählt man auf dem einen Hektar 120 Baumarten, sind es auf dem nächsten vielleicht 170. Auch kann jeder Flecken Tiere oder Pflanzen beherbergen, die vielleicht nirgends sonst vorkommen, und andere, die hier häufig, anderswo aber sehr selten sind.
Vielfach schrecken Wissenschaftler vor einer Zusammenarbeit mit den Indios zurück. „Man weiß eigentlich nie, woran man ist“, meint Anthony B. Anderson, der Verantwortliche für das Brasilien-Programm der Ford-Stiftung. „Mal machen die Stämme die Politik, mal rollt sie über ihre Köpfe hinweg.“
Nach Aussage von Stephan Schwartzman vom brasilianischen Umweltschutzbund sind immerhin 790000 Quadratkilometer bereits als Reservate der Ureinwohner ausgewiesen oder vorgesehen. Viele Wissenschaftler und Umweltschützer erachten sie als ideale Möglichkeit, nicht nur die biologische Vielfalt zu erforschen und zu erhalten, sondern auch die Reste ursprünglicher Kulturen zu bewahren. Den Kayapó etwa wurde ein 100000 Quadratkilometer großes Gebiet zugesprochen (das entspricht ungefähr der Fläche der neuen Bundesländer Deutschlands).
Wegen des Reichtums an Bodenschätzen und hochwertigem Holz verlocken diese Landstriche indes zur wirtschaftlichen Erschließung. Vielfach dringen Holzfäller und arme Glücksritter illegal ein, zum Beispiel in das Territorium der Yanomami in Nordbrasilien, die jetzt unter Gewalttätigkeiten und eingeschleppten Krankheiten zu leiden haben und unter Vergiftung der Flüsse mit Quecksilber aus der Goldgewinnung. Das Land der Kayapó wurde bisher von alldem verschont, denn sie stehen im Ruf wilder Krieger. Als einige der Häuptlinge aber dann ihrerseits Holzeinschlag- und Schürfrechte verkaufen wollten, brachte dies die Umweltschützer auf. Ein jüngster Vorstoß von Greenpeace, das Fällen von Mahagonibäumen auf Stammesgebieten zu untersagen, verärgerte wiederum diese Kayapó.
Viele der Entwicklungsexperten und Naturschützer setzen sich für die Einrichtung von Reservaten ein, weil sie erwarten, daß die Indios von sich aus den Regenwald erhalten. Diese Ansicht fußt unter anderem auf anthropologischen Studien, denen zufolge die Stämme ihren Lebensraum schonend nutzen und zum Beispiel einen ökologisch sehr ausgewogenen Wanderfeldbau betreiben. Hört man andere Experten, dann geschieht dies allerdungs nicht geplant: Der Wald sei nämlich so riesig, daß er sich von den Eingriffen der bislang kleinen Menschengruppen habe erholen können. Anderson formuliert es so: „Die Idee vom edlen Wilden hat nur Verwirrung gestiftet. Die Indios sind wie andere Menschen Opportunisten, auch wenn sie der Natur in der Vergangenheit nicht ernstlich geschadet haben.“
Wenn das Projekt in Aukre Erfolg hat, dürfte es diesen Streit beilegen helfen. Es böte den Kayapó ein Einkommen und reizte dazu an, gleichwohl die Artenvielfalt zu erhalten. Das Dorf hat die gesamte Kontroverse miterlebt. Paiakan, der Häuptling, hat sich mit seinem öffentlichen Eintreten für den Schutz des Regenwaldes und das Bewahren der Tradition einen Namen gemacht. Er gilt als geschickter Politiker, der verfeindete Stämme im Beisein von Entwicklungsexperten zu einen weiß. Allerdings teilen nicht alle Dorfbewohner seine Ansichten; und seine Stellung als Anwalt der Ureinwohner ist nicht mehr unangefochten, seit er versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen – demnächst gibt es einen Prozeß.
Wie der Stamm, so hat auch sein Territorialgebiet viele Zivilisationsnarben aufzuweisen. Fliegt man von der Siedlerstadt Redença˜o, die von Bodenschätzen und Mahagoniholz aus dem Kayapó-Land lebt, nordwestlich in Richtung Aukre, überblickt man alle Stadien der Erschließung. Viehweiden, frisch gerodete Flächen und von Goldschürfern verschandelte Flüsse löst nach und nach eine geschlossene Waldfläche ab. Vom Boden aus gesehen wirkt die Umgebung der neuen Forschungsstation intakt, obwohl eine ehemalige Holzfällerstraße vorbeiführt. Die Station selbst steht mitten auf einer Lichtung direkt an einem Fluß; mit dem Kanu braucht man bis Aukre eine Stunde. Auf den Trampelpfaden der Tapire flattern schillernd hellblaue Morphofalter, und vom Blätterdach klingen pfeifende Vogelrufe.
Wenn hier demnächst Doktoranden und Wissenschaftler forschen werden, sollen sie die Kenntnisse der Indios nutzen, so auch die von Spezialisten wie den Mateiros, die Hunderte von Bäumen allein nach dem Geruch unterscheiden. Man hofft, mit ihrer Hilfe neue Heilpflanzen oder Feldfrüchte zu entdecken und vielleicht sogar einen Weg zu finden, Mahagoniholz schonend und nachhaltig zu gewinnen.
Gleichzeitig soll das Projekt Geld nach Aukre bringen. Die Wissenschaftler werden örtliche Erzeugnisse kaufen, ökologisch interessierte Gruppen können wie unsere an Exkursionen unter sachkundiger Führung teilnehmen und Angler die reichen Fischbestände kennenlernen. Vielleicht werden die Indios für das Preisgeben ihrer Kenntnisse auch einmal ein wenig entschädigt. Ein Anfang ist zumindest gemacht: Eine britische Firma erwirbt hier Paranuß-Öl für Kosmetika auf natürlicher Basis.
Lebensunterhalt für Siedler
Nicht weniger hitzig ist die Auseinandersetzung um geschützte Waldregionen, die offiziell nicht gerodet werden dürfen, aus denen die Anwohner aber Naturprodukte wie Kautschuk, Palmherzen oder Paranüsse gewinnen können (Bilder 1, 4 und 5). Die Regierung in Brasilia tut allerdings wenig für die Kontrolle. Viel Aufsehen erregte, als sich Kautschuksammler für den Kampf um solche Reservate zu organisieren begannen und ihr Anführer Chico Mendes von Viehzüchtern 1988 ermordet wurde.
Bisher bestehen 14 solcher Zonen mit zusammen drei Millionen Hektar. Das Nutzungsrecht erhalten bisher schon Ansässige sowie Siedler, die anderswo von Großgrundbesitzern vertrieben worden sind. (In Brasilien verfügen 4,5 Prozent der Landeigner über 81 Prozent des bebauten Landes.) Den Einfluß der mächtigen Viehzüchter sieht man zum Beispiel während der ganzen vierstündigen Fahrt von der Stadt Rio Branco nach Xapuri. Beidseits der Straße erstrecken sich Weiden, die trotz des Grüns unheimlich wirken. Denn geisterhaft ragen als Relikt des Urwaldes einzelne tote Paranußbäume mit bleichen Ästen auf. Dem Gesetz, das sie zu schlagen verbietet, ist Genüge getan – dafür trocknet die Sonne sie aus, wenn rundum erst einmal alles niedergebrannt ist.
Ungewiß ist, ob extensive Nutzung des Waldes den Bewohnern überhaupt eine Zukunft bietet. Alfredo Kingo Oyama Homma von der brasilianischen Gesellschaft für landwirtschaftliche Forschung (EMBRAPA) verweist auf Analysen bisheriger Marktzyklen, wonach Rohstoffe, die gefragt sind, dann unweigerlich mit mehr Gewinn auf Plantagen erzeugt oder durch synthetische Produkte ersetzt werden; so stammten 1991 etwa 60 Prozent des brasilianischen Naturkautschuks aus planmäßigem Anbau. Vielfach sinken die Preise derart, daß der Verkauf kleiner im Urwald gesammelter Mengen nicht länger lohnt.
Optimisten führen dagegen eine Untersuchung in Peru an, der zufolge auf nur einem Hektar Wald 72 verschiedene Produkte zu ernten waren, die im Jahr 422 Dollar einbrachten. Auf Dauer, folgerten die Forscher, sei das Sammeln lukrativer als die einmal zu erzielenden 1000 Dollar Gewinn durch Einschlag der Edelhölzer. Anderson dagegen ist skeptisch: „Am Amazonas wird man nicht viele Waldgebiete finden, die eine so reiche Ausbeute liefern.“ Zudem werden in Peru die gesammelten Produkte in der Region verkauft; diese Möglichkeit besteht für viele der brasilianischen Reservate noch nicht.
Deshalb plädiert Anderson, wie verschiedene andere Wissenschaftler auch, für einen Kompromiß: „Vielleicht sollte man gar nicht immer so die Gewinnung von Naturprodukten betonen. Eigentlich sind die Schutzgebiete doch eingerichtet worden, damit die Menschen, die dort leben, zu ihrem Recht kommen.“ Ohnehin würden Neusiedler, die das Recht zu extensiver Nutzung des Waldes zugesprochen bekommen, ihr Budget mit Viehzucht oder Gartenbau aufzustocken suchen. „Damit ändert sich zwar der Charakter der Reservate“, räumt der Pragmatiker von der Ford-Stiftung ein, „aber möglicherweise entsteht so erst die Basis für eine zukunftsträchtige Entwicklung“. Allerdings bleiben die ökologischen Folgen noch zu prüfen.
Etliche Wissenschaftler und unabhängigen Organisationen – darunter die Anthropologenvereinigung „Cultural Survival“ mit Sitz in Boston (Massachusetts) und das Institut für Wirtschaftsbotanik des New Yorker Botanischen Gartens – suchen in Zusammenarbeit mit Kautschuk- und Paranußsammlern mehr verwertbare Pflanzen, die zum Beispiel eßbare Früchte oder Medikamente liefern, und helfen ihnen, neue Märkte zu erschließen. Schon die Verständigung mit potentiellen Abnehmern und der Transport der Güter bereiten enorme Schwierigkeiten. Viele Verkäufer sind tagelang unterwegs, um ihre Produkte abzusetzen.
Einen Eindruck davon bekommen wir, als wir Xapuri in Richtung Rio Branco verlassen. Mit uns fährt Gomercindo Clovia Garcia Rodrigues, ein Mitglied der Sammlerkooperative. Vor längerer Zeit haben Rancher ihn angeschossen; die Wunde im Kiefer hört nicht auf zu schmerzen, und so nimmt er die Gelegenheit wahr, endlich einen Zahnarzt zu konsultieren. Gerade malt er uns lebhaft die Abenteuer einer solchen Reise aus, da bleibt unser weißer Fiat das erste Mal im roten Schlamm stecken. Nach dem vierten Loch ist der überlastete Scheibenwischer zerbrochen, so daß wir im Regen kaum noch die Straße erkennen, und dann streikt auch noch die Batterie. Rodrigues lacht nur: Die Hauptregenzeit hat noch gar nicht begonnen.
Land- und Forstwirtschaft auf verödeten Flächen
Bei Paragominas im Bundesstaat Pará kooperieren Wissenschaftler mit den Erzfeinden der Sammler, mit Viehzüchtern und Holzfällern. Wir kommen nachmittags in ein Tal, dessen feuchte Luft schwer von Rauch ist. Er kriecht aus den schwelenden Feuern Dutzender von Sägemühlen. Nur einige Kinder spielen am Rande der Straße; sie haben sich als kleine Stelzen Konservendosen unter die Füße gebunden.
Ausländische Forscher wie Christopher Uhl von der Staatsuniversität von Pennsylvania in Philadelphia und Da–niel C. Nepstad vom Woods-Hole-Forschungszentrum sowie einheimische wie Adalberto Verissimo und Paulo Barreto vom Amazonas-Institut für Mensch und Umwelt (IMAZON) suchen hier zusammen mit den Besitzern der Sägemühlen und Ranches und deren Arbeitern nach Möglichkeiten, aufgegebene ausgelaugte Landstriche wieder urbar zu machen und Sekundärwald forstlich zu nutzen. Ihre Erfahrungen aus diesem Projekt könnten auch in anderen Bundesstaaten dienlich sein, vor allem in Rondônia und Mato Grosso, die bis 1988 immerhin schon 24 Prozent des Urwaldes eingebüßt hatten.
Pará selbst, das ein Drittel der Amazonasregion Brasiliens umfaßt, hatte bis 1990 etwa 13 Prozent seines Waldbestandes verloren. Die Region um Paragominas wurde in den sechziger Jahren erschlossen, nachdem die Straße zwischen der neuen Hauptstadt Brasilia und Belém, dem Zentrum des brasilianischen Kautschuk-Booms, fertig war. Damals förderte die Regierung die Viehzucht mit großzügigen Investitionen; oft zahlte sie Siedlern bis zu 75 Prozent der Startkosten für eine Ranch. Zudem konnte jeder Landeigner werden, der Rodungsarbeit nachwies, was ein regelrechtes Abholzungsfieber auslöste.
Schon nach wenigen Jahren zeigten sich die fatalen Folgen dieser Politik. Im tropischen Regenwald kreisen die meisten Nährstoffe in den Nahrungsketten der Organismen; die Böden dagegen sind ausgesprochen arm. Was beim Verrotten und Verbrennen niedergemachter Vegetation frei wird, hält nicht lange vor. Auf den überweideten Rodungsflächen wuchsen nach etlichen Jahren nicht einmal mehr Gräser, sondern Kümmerpflanzen, die für das Vieh ungenießbar sind. Bereits um 1980 lohnte sich die Rinderwirtschaft nicht länger. Aber auch die Finanzmittel waren mittlerweile erschöpft – die Subventionen schwanden.
Die Besitzer nicht rentierlicher Rinderfarmen sahen neue Gewinnchancen in den verbliebenen Waldbeständen. Bereits 1990 gab es allein in der Umgebung von Paragominas 238 Sägemühlen.
Heute ist die Holzwirtschaft die wichtigste Industrie der Region – und genausowenig auf Nachhaltigkeit ausgerichtet wie ehemals die Rinderzucht. Das Prinzip ist, selektiv einzelne wertvolle Stämme aus der grünen Wildnis herauszuschlagen. IMAZON-Forscher haben errechnet, daß für jeden dieser Bäume 40 Meter Zufahrtswege gebahnt werden müssen; und wenn einer der Urwaldriesen fällt, werden 27 andere Bäume mit einem Stammumfang von zehn Zentimeter oder mehr schwer beschädigt und 600 Quadratmeter Blätterdach aufgerissen. Der Wald kann sich auch von so gezielter Nutzung nur langsam erholen, zumal mit dem Holz viel Biomasse verlorengeht; stellenweise erreicht er erst nach 70 Jahren wieder die frühere Geschlossenheit.
Trotzdem halten die Experten eine langfristig umweltverträgliche Holz- und Viehwirtschaft für machbar. Wir fahren mit Uhl und Verissimo zur Forschungsstation auf der Fazenda Vitória, wo wir von einem Turm aus die typischen vier Landschaftsformen überblicken: den hohen, dichten jungfräulichen Primärwald, nach einer Rodung mehr oder weniger nachgewachsenen ärmeren Sekundärwald, beweidetes Land und aufgegebene, verödete Flächen, die sehr leicht durch Erosion völlig verwüstet werden. Die kahlen Stücke, erläutern die Wissenschaftler, würden schon deshalb nur äußerst langsam wieder bewaldet, weil viele Samen zur Verbreitung auf Vögel angewiesen sind, die aber nicht gern ins Offene fliegen.
Im brasilianischen Amazonasgebiet gibt es bereits rund zehn Millionen Hektar solcher Brachen. Jetzt endlich beginnt man, sie als Ressource zu erachten. „Wozu immer weiter den Urwald dezimieren“, bemerkt Uhl dazu, „wenn zwei Drittel des ihm bereits entrissenen Landes nicht mehr genutzt werden.“
Bei einer Rekultivierung ließe sich unter bestimmten Bedingungen sogar biologische Vielfalt anstreben. Die Regeneration zu unterstützen erfordert jedoch, mehr über die Tier- und Pflanzenarten zu wissen, die sich hier als erste wieder ansiedeln, und über die Voraussetzungen, unter denen sie am besten gedeihen. Entscheidend allerdings ist letztlich der wirtschaftliche Anreiz, konstatiert Uhl: „Wir haben zwar ein gutes Gefühl, wenn der Wald wieder wächst; nur ist das eigentlich nicht der Punkt. Geld in ein Projekt zu stecken, das keine ökonomische Zukunft hat, ist nicht sonderlich klug.“
Er und sein Kollege Marli M. Mattos propagieren neuerdings sogar die verpönte Viehwirtschaft. Unter bestimmten Voraussetzungen sei sie hier vertretbar und lukrativ, sofern man das Land intensiv bewirtschaftet, also für Düngung und besser angepaßte Pflanzenarten sorgt. Der Gewinn mit Fleisch und Milchprodukten ließe sich bis zum Fünffachen steigern, und außerdem würden Arbeitsplätze geschaffen. (Angesichts der erwarteten Bevölkerungszunahme – im Jahre 2025 könnten in Brasilien 246 Millionen Menschen leben – haben Beschäftigungsmaßnahmen höchste Priorität.)
Bevor aber solche Strategien einen merklichen Wandel bewirken, meint Uhl, wird es noch schlimmer kommen: „Die Brandrodung nimmt weiterhin zu, und sie wird um so mehr Natur vernichten, je mehr die Vegetation schon angegriffen ist. Der unberührte Regenwald mit den hohen Bäumen brennt nicht besonders gut, aber bei ausgeholzten Beständen ist das anders.“ Nepstad berichtet, daß 1992 im Umkreis von 80 Kilometern um Paragominas mehr als der Hälfte der Fläche gebrannt hat.
Die drohenden Auswirkungen solchen Vorgehens auf das Weltklima sind weithin bekannt. Wie Nepstad gemessen hat, fixiert eine Weidefläche über dem Boden nur drei Hundertstel und in den Wurzeln ein Fünftel der Kohlenstoffmenge wie Urwald. Mit jedem abgebrannten Hektar werden zudem rund 220 Tonnen Kohlenstoff als Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt. Man vermutet, daß in den letzten Jahrzehnten dem Verlust an tropischen Wäldern ein Viertel des emittierten Treibhausgases zuzuschreiben ist.
Mehr auf das lokale Klima wirkt sich aus, daß der Wasserhaushalt schwer beeinträchtigt wird. Eine Weidefläche vermag wegen der relativ flachen Wurzelschicht nicht so viel Feuchtigkeit aufzunehmen wie Waldboden, und die kleinen, niedrigen Pflanzen können nicht größere Mengen speichern. Vor allem aber fehlt die riesige Blattfläche, über die in einem tropischen Wald Wasser verdunstet, das dann Wolken bildet und wieder abregnet. Wohl die Hälfte des Niederschlags im Amazonasgebiet dürfte aus diesem Kreislauf stammen. Entfällt er, wird es nicht nur trockener, sondern auch heißer – zum Schaden der Landwirtschaft und der Reste natürlicher Vegetation.
Bewirtschaftung des Sekundärwaldes
Dies macht deutlich, wie schwierig es ist, Nachhaltigkeit anzustreben. „Schon der Begriff ist ziemlich vertrackt“, meint Anderson. „Es ist doch jedesmal etwas anderes, ob man dabei an die Umwelt denkt, an die Wirtschaftlichkeit oder die soziale Situation der Menschen. Selten wird sich das alles in einer Strategie vereinen lassen. Verstehen Sie mich nicht falsch – ich sage nicht, die Weidewirtschaft sei ideal, aber sie ist auch nicht unbedingt so verwerflich, wie früher immer behauptet wurde. Und im übrigen wird sie ohnehin weiter betrieben.“
Die Holzgewinnung sehen die Wissenschaftler der Station von Paragominas nicht so kontrovers. IMAZON-Mitarbeiter Baretto hat für einen aufgeforsteten Waldabschnitt nahe beim Beobachtungsturm ein einfaches Schema entworfen, um die Arbeit besser zu organisieren und die Vegetation zu schonen. Üblicherweise hat man bisher geeignete Bäume ausgesucht und gefällt; danach erst wurden Pisten für das schwere Gerät gebahnt. Nun errechnet ein Computer das jeweils kürzeste Wegenetz. Die Länge der Schneisen hat sich deutlich verringert (Bilder 6 und 7).
Umsichtiges Fällen mindert den Schaden an umstehenden Bäumen um ein Drittel, etwa indem die Arbeiter die Sturzrichtung geschickt vorgeben und zuvor die vielen Lianen abschneiden. Und danach entwickeln sich Setzlinge wirtschaftlich interessanter Arten und junge Bäume rascher und kräftiger, wenn die lichtschluckenden Schlinggewächse kurzgehalten werden. Bei solchem Management regenerieren die Wälder in 35 statt in 70 Jahren. „Der unmittelbare Profit würde dadurch nur wenig sinken“, erklärt Verissimo, und die Differenz wäre eine Investition in die Zukunft.“
Weil die Nachfrage nach Holz aus dem Amazonasgebiet zukünftig wohl noch steigen wird, sind Optimierungsstrategien unerläßlich. Im Jahre 1976 stammten in Brasilien 14 Prozent des weiterverarbeiteten Holzes aus dem Regenwald, 1986 schon 44 Prozent. Die Zahl der Sägemühlen ist dort in den letzten 40 Jahren von rund 100 auf mehr als 3000 angewachsen. Noch liefert Brasilien keine 5 Prozent des Weltbedarfs an Tropenholz; doch der Export dürfte zunehmen, weil auch Südostasien, die derzeitige Hauptquelle, nicht unerschöpflich ist. Das, meint Uhl, könnte günstig auf die Praxis der brasilianischen Betriebe rückwirken: „Die Abnehmer in Übersee fragen inzwischen, woher das Holz kommt.“ Das wachere Umweltbewußtsein in den entwickelten Gesellschaften beeinflußt das Kaufverhalten und kann Fehlentwicklungen in den Erzeugerländern regulieren.
Die Regenwald-Politik der brasilianischen Bundesregierung ist allerdings nach wie vor ohne Konzept – Grund für die Experten, vornehmlich die Mitarbeiter von IMAZON, eigenständige Maßgaben der Bundesstaaten zu fordern. Seit dem Jahre 1988 gewährt die Verfassung ihnen mehr Macht. Der Vorschlag ist, daß sie für ausgewiesene Bezirke eine intensive Bewirtschaftung als Weide oder Forst vorschreiben. Die Viehzüchter und Sägemühlenbesitzer, meint Uhl, begännen schon jetzt allmählich umzudenken, weil an der Zivilisationsfront am ehesten ersichtlich wird, daß die Ressource Urwald nicht unerschöpflich ist und man sich auf Dauer besser stellt, wenn man mit der und nicht gegen die Natur arbeitet.
Vielfach allerdings geht es den Menschen, die ohne weiteres Nachdenken roden, nicht um Profit, sondern um das nackte Überleben. Gerade die sehr armen Kleinbauern können sich oft gar nicht anders helfen, als immer neue Waldparzellen urbar zu machen. Von diesem Wanderfeldbau zeugen die vielen kleinen schwelenden Flächen entlang der Straßen.
Tropenökologen wie Ralph M. Coolman und Erick C.M. Fernandes von der Staatsuniversität von North Carolina in Raleigh untersuchen zur Zeit zusammmen mit der EMBRAPA auf einer alten Wasserbüffelranch und einstigen Kautschuk- und Palmenplantage in der Nähe von Manaus, wie sich Tierhaltung, Feldbau und Holzgewinnung im kleinen am günstigsten verbinden lassen. Durch Auswahl der Pflanzen, die auf den verschiedenen Böden am besten gedeihen, und gezielten Wechsel der Sorten hoffen sie ein Schema für höheren Ertrag zu finden; wenn die Kleinbauern dann noch stickstoff-fixierende und sonstwie düngende Arten mit aussäen und unterarbeiten, sollten sie für unbegrenzte Zeit von den einmal gerodeten Flächen leben können und den angrenzenden noch ursprünglichen Wald intakt lassen.
Ökologische Vernetzung
Schon eines der ältesten Regenwald-Projekte suchte nach Wegen, pfleglichen Umgang mit der Natur und Bewirtschaftung zu vereinbaren. Konzipiert hatte dieses Konzept der US-Biologe Thomas E. Lovejoy, inzwischen Mitarbeiter der Smithsonian Institution, die nun die 1979 begonnenen Forschungen zusammen mit dem brasilianischen Nationalen Institut für Amazonasforschung (INPA) finanziert und leitet.
Anfangs ging es um die kritische Mindestgröße von Ökosystemen, später dann zunehmend darum, wie viele der ursprünglichen Arten sich überhaupt halten, wenn der verfügbare Lebensraum – in diesem Falle ein inselartiger oder streifenförmiger Rest Regenwald – noch verkleinert wird. Schließlich sind die verschiedenen Spezies oft aneinander adaptiert und in ihren Ansprüchen miteinander vernetzt; fehlt ein bestimmtes Glied in der Kette, werden zwangsläufig auch manche anderen verschwinden.
Die Landbesitzer im Amazonasgebiet sind zwar durch Gesetz gezwungen, auf der Hälfte ihres Geländes den Wald zu erhalten – aber nicht als zusammenhängenden Bestand. So finden sich nun überall verstreut kleinere oder größere Gruppen von Bäumen und Unterholz, die von Weideland umsäumt sind.
Die Wissenschaftler konnten erwartungsgemäß belegen, daß mit der Verkleinerung solcher Restbestände die ökologische Komplexität schwindet. Das galt aber so deutlich nur für völlig isolierte Pazellen. Unter Umständen reichen schon Verbindungsstreifen zwischen kleineren Waldstücken aus, den Raum- und Standortansprüchen bestimmter Arten zu genügen. Weil kaum mehr große unberührte Urwälder auf der Welt vorhanden sind, propagieren die Naturschützer nun zunehmend den Erhalt solcher sogenannten Korridore.
Neuerdings werden auch die Möglichkeiten zur Regeneration von Ödland in die Untersuchungen einbezogen. Außer um bessere Methoden des Wald-Managements und der Aufforstung von gerodeten und erodierten Parzellen geht es dabei um die günstigste Aufbereitung und Rekultivierung von Brachland zu Weideflächen und um die Vermarktung der Produkte. Geld ist nach der Erfahrung der Wissenschaftler für solche entwicklungsfördernden Vorhaben ohnehin viel eher zu bekommen als für Grundlagenforschung.
Selbst Lovejoy setzt mittlerweile auf die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Damit nicht alle guten Ideen am Mangel an Mitteln scheitern, unterbreitete er Mitte der achtziger Jahre den Plan, den Entwicklungsländern einen Teil ihrer Schulden zu erlassen, wenn sie im Gegenzug Naturschutzmaßnahmen durchsetzten. Den reichen Importländern sucht er derweil klarzumachen, daß biologische Vielfalt auch eine optimale Ressource ist, und beschreibt die Regenwälder als reiches Reservoir etwa von potentiellen Heilmitteln, von bislang ungenutzten Rohstoffen und von Genen, die für die Pflanzen- und Tierzucht bedeutsam werden können. Solche Überlegungen erregen zwar den Argwohn von Naturschutzorganisationen; aber der Wissenschaftler, der oft am selben Tag auf dem gestampften Boden einer Kayapó-Hütte hockt und dann mit dem Gouverneur des Staates an einem mit Kristall und Silber gedeckten Tisch speist, argumentiert, daß nachhaltige Entwicklung und Schutz der biologischen Vielfalt nur dann gelingen können, wenn sie zugleich auf allen gesellschaftlichen Ebenen praktiziert werden.
Deshalb berät Lovejoy auch die Brasilianische Stiftung für nachhaltige Entwicklung. Dieses Konsortium der 24 größten Unternehmen des Landes, das nach dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro 1992 gegründet worden war, will einschlägige Forschung fördern, die laufenden Studien über die Folgen der Zerstückelung des Regenwaldes auf das Artenspektrum finanzieren und andere Unternehmen bei der Umsetzung der Ergebnisse in ökologisch verträgliche Praktiken unterstützten.
Den neuen Ansatz, die letzten Refugien von Natur zu erhalten, indem man aus ihnen Nutzen zieht, verfolgen nicht mehr nur Wissenschaftler in Brasilien. Jedes Jahr einmal kommen die Experten der mittel- und südamerikanischen Regenwald-Staaten zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und das weitere Vorgehen zu überlegen. Beim letzten Treffen kam Don E. Wilson noch einmal auf den Wandel von Idealismus zu Pragmatismus zu sprechen: „Viele von uns sind für die biologische Forschung ausgebildet worden, doch es ist schiere Notwendigkeit, daß wir uns für den Erhalt unseres Forschungsgegenstandes nun auch mit Verwaltung und politischer Planung auseinandersetzen.“
Aus: Spektrum der Wissenschaft 9 / 1993, Seite 70
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

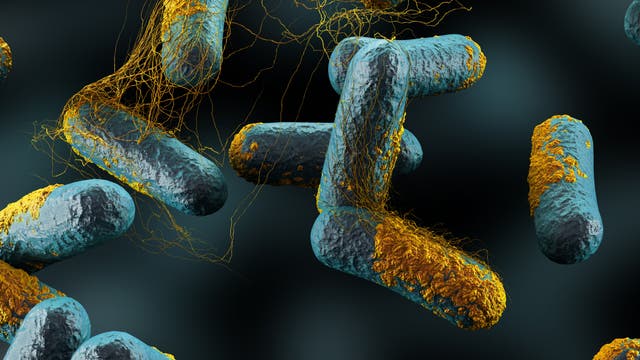

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben