Editorial: Der Hurz-Effekt

Kennen Sie »Hurz!«? Selbst nach fast 30 Jahren sorgt Hape Kerkelings genialer Aufritt als Möchtegernbariton immer noch für Gelächter – und eine gute Portion Fremdschämen. Denn das wirklich Witzige an diesem Sketch, heute auf Youtube millionenfach geklickt, ist nicht etwa der miserabelst vorgetragene Nonsense vom Lämmlein und dem Wolf auf der grünen Wiese, sondern der Versuch des Publikums, dieser Albernheit Sinn und künstlerischen Wert beizumessen. Doch bevor wir auf jene kulturbeflissenen Zuhörer allzu tief herabblicken, fragen wir uns einmal selbst: Wie gut könnten wir Kunst von Stuss unterscheiden?
Dieser Frage geht der Psychologe Claus-Christian Carbon im Titelthema dieses Hefts ab S. 20 nach. Jenseits des Lieblich-Dekorativen à la Claude Monets Seerosen oder des handwerklichen Geschicks der alten Meister erstreckt sich das unsichere Terrain der zeitgenössischen Kunst. Sie ist oft weder schön noch in erster Linie virtuos. Ihr Spezifikum ist vielmehr ideeller Art: Es besteht laut Carbon in dem Reiz, die Perspektive zu wechseln und zusammenzubringen, was zunächst gar nicht zusammengehört.
Darin liegt wohl auch der gemeinsame Nenner mit der Kunsttherapie, die unsere Autorin Corinna Hartmann ab S. 12 skizziert. Statt auf ästhetisch hochstehende Werke zielt die »Heil-Kunst« auf das Erleben der Selbstwirksamkeit, also des Vermögens, etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Dies erwies sich in vielen Studien als einer der wichtigsten Faktoren für die psychische Gesundheit.
So zählt in der Kunst wie im Leben offenbar häufig eins: die ausgetretenen Denkpfade und gewohnten Sichtweisen zu verlassen, gleich ob wir die Welt oder uns selbst betrachten.
Eine gute Lektüre wünscht Ihr
Steve Ayan


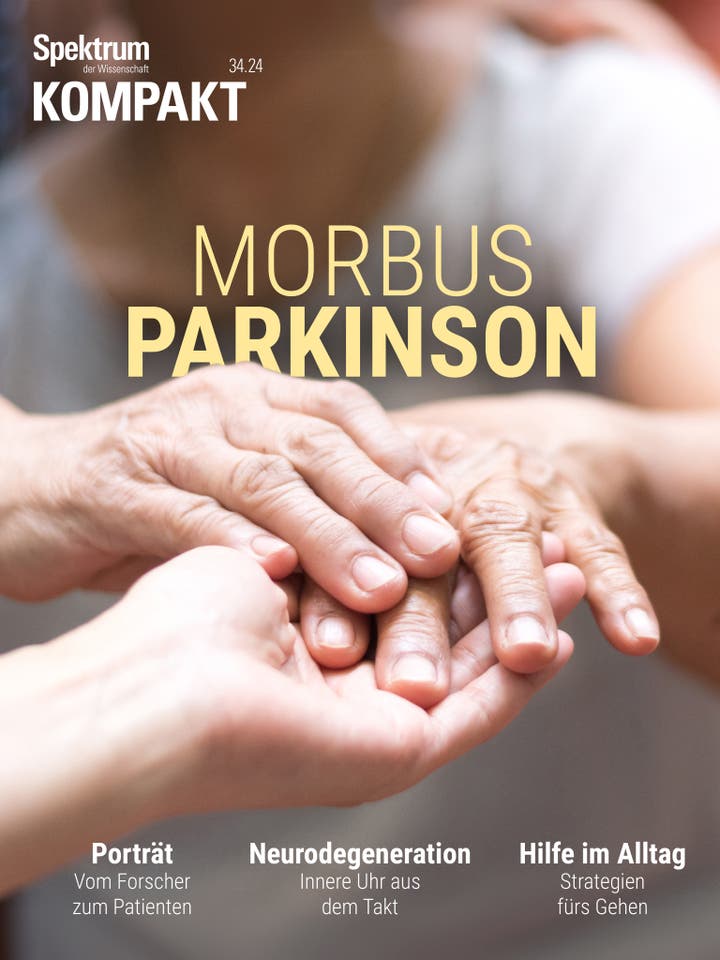



Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben