Flache Bildschirme
Durch Fortschritte in der Mikroelektronik übertreffen Flüssigkristall-Displays mittlerweile die Bildqualität herkömmlicher Farbmonitore. Innovative Produkte wie etwa das großflächige Fernsehgerät an der Wand und der Computer am Handgelenk sind mit solchen leichten, energiesparsamen Bildschirmen möglich.
Ob Fernsehgerät oder Computermonitor – der Bildschirm ist im Zeitalter der audiovisuellen Unterhaltung und der Datenverarbeitung für die Übermittlung von Informationen unentbehrlich geworden. Kein anderes Ausgabemedium ist auch nur annähernd so schnell und so vielseitig, und keines bietet vergleichbare Möglichkeiten der Interaktion. Für unterschiedlichste Anwendungen läßt sich ein geeigneter Bildschirm finden – auch wenn es darum geht, Texte, Graphiken, Photos und sogar Filme beliebig zu kombinieren. Weitere Innovationen werden im wesentlichen von Fortschritten bei der Entwicklung flacher Bildschirme geprägt sein.
Noch ist die herkömmliche, von dem deutschen Physiker Karl Ferdinand Braun (1850 bis 1918) erfundene Kathodenstrahlröhre marktbeherrschend; ihre Weiterentwicklung zu einem tragbaren Darstellungsmedium mit geringem Strombedarf und dennoch hoher Bildqualität hat sich freilich als sehr schwierig erwiesen. Alle Versuche, ihre Bautiefe zu verringern, verschlechterten entweder die Abbildungsgüte oder machten technisch sehr aufwendige und mithin teure Konstruktionen erforderlich. Zuletzt ersetzte man die übliche Elektronenkanone und das Strahlablenksystem durch eine Vielzahl winziger Elektronenquellen auf einer ebenen Grundplatte, über der sich – durch Abstandshalter getrennt – der ebenfalls ebene Schirm befindet. Damit diese Anordnung trotz des dazwischen herrschenden Vakuums stabil ist, benötigt man entweder sehr viele oder sehr große Abstandshalter; beides beeinträchtigt die Bildqualität. Eine befriedigende Lösung ist noch nicht in Sicht.
Aufgrund ihrer Bauweise sind flache Bildschirme handlich, leicht und energiesparsam. Auf manchen läßt sich sogar wie auf Papier schreiben. Ein solches Display in Miniaturformat wird man immer mit sich führen oder gar wie eine Armbanduhr tragen können.
Bereits jetzt bieten manche Luftverkehrsgesellschaften ihren Passagieren Spielfilme auf Bildschirmen an, die in Arm- oder Rückenlehne eingelassen sind; japanische Hotels preisen darauf in Aufzügen ihre Restaurants und Geschäfte an. Vermutlich in zehn Jahren werden hochauflösendes Fernsehen (high-definition television, HDTV) und ins Auto-Armaturenbrett integrierte Verkehrsleitsysteme etwas Alltägliches sein. Auch völlig neue Produkte werden aufkommen – etwa ein Taschennotizblock, der alles Geschriebene speichern und nach Schlüsselwörtern oder -daten durchsuchen kann (vergleiche auch „Computer im nächsten Jahrhundert“ von Mark Weiser, Spektrum der Wissenschaft, November 1991, Seite 92).
Der ideale flache Bildschirm ist hell und kontrastreich, hat eine hohe Auflösung und eine geringe Ansprechzeit, und er stellt Bilder in vielen Graustufen und allen Farben dar. Gleichzeitig muß er unempfindlich, dauerhaft und preiswert sein. Keiner der drei flachen Bildschirmtypen, die eine Marktakzeptanz erreicht haben – Plasma-, Elektrolumineszenz- und Flüssigkristall-Bildschirme –, erfüllt alle diese Anforderungen. Die Bildqualität eines vierten Typs, der gerade eingeführt wird, ist jedoch jener der Braunschen Röhre ebenbürtig und übertrifft sie in einigen Merkmalen sogar. Auf diesen Aktivmatrix-Flüssigkristall-Bildschirm konzentriert sich zur Zeit ein Großteil der Forschungsaktivitäten und des Investitionsaufwands im Fertigungsbereich.
Plasma- und Lumineszenzbildschirme
Als die Entwicklung flacher Bildschirme begann, ließen sich freilich aktive Displays nicht vorhersehen. Man versuchte zunächst, das Bild mit einer Anordnung aus ansteuerbaren, selbstleuchtenden Elementen zu erzeugen. Die ersten derartigen Bildschirme, die Ende der sechziger Jahre aufkamen, waren dazu aus Gasentladungs- oder Plasmaelementen aufgebaut.
Ein solcher Plasmabildschirm besteht im wesentlichen aus zwei Glasscheiben, auf denen eine Vielzahl elektrisch leitender, dünner Metallstreifen parallel aufgebracht ist. Die beiden Scheiben liegen so übereinander, daß sich die Leiterbahnen rechtwinklig kreuzen. Der Zwischenraum ist mit einem Gasgemisch gefüllt, das in der Regel auch Neon enthält (Bild 2 links). An jedem Kreuzungspunkt, an dem eine genügend hohe Spannung anliegt, wird das Gas ionisiert – es entsteht ein Plasma aus Elektronen und Ionen, das durch den Entladungsstrom zum Leuchten angeregt wird. Man hat es also gleichsam mit einer Anordnung winziger Neonlampen zu tun.
Da das Gas nur ab einer genau bestimmten Spannung ionisiert wird, lassen sich die Punkte, die aufleuchten sollen, leicht ansteuern, indem man an die gewünschten Zeilen und Spalten jeweils die halbe erforderliche Spannung anlegt. Wenn man diesen Vorgang zeilenweise mindestens 60 Mal pro Sekunde wiederholt, nimmt der Betrachter ein ruhiges, vollständiges Bild wahr. Da dabei aber jeder Punkt nur kurzzeitig aufleuchtet, ist das Gesamtbild zwangsläufig etwas dunkel. Trotz dieses Nachteils sind Plasmabildschirme in einigen tragbaren Computern und anderen Geräten zu finden.
Ein helleres Bild entsteht, wenn man den Monitor mit Wechselspannung ansteuert. H. Gene Slottow und Donald L. Bitzer von der Universität von Illinois in Urbana fanden nämlich heraus, daß sich die Restladung, die unmittelbar nach dem Aufleuchten eines Bildelements für kurze Zeit auf den isolierten Elektroden zurückbleibt, als eine Art Gedächtniseffekt nutzen läßt: Wechselt die Spannung das Vorzeichen, so addiert sich die Restladung zur neu angelegten Spannung, und es wird abermals eine Gasentladung ausgelöst. Da die Bildelemente (Pixel) bei jeder Spannungsumkehr auf diese Weise angeregt werden, leuchten sie insgesamt viel länger. Während sich das Interesse am Wechselspannungs-Plasmabildschirm anfangs auf diesen Gedächtniseffekt konzentrierte (der inzwischen wegen der außerordentlich billigen Halbleiterspeicher keine Rolle mehr spielt), schätzt man heute – insbesondere in militärischen Anwendungen – seine Helligkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.
Am Markt setzen sich immer mehr Farbbildschirme durch; ihr Anteil an den Computermonitoren beträgt mittlerweile mehr als 80 Prozent. Plasmabildschirme sind jedoch einfarbig, die meisten leuchten orange. Die gleichzeitige Darstellung mehrerer Farben wäre mit dieser Technik sehr aufwendig, denn jeder Bildpunkt müßte dazu aus drei Lichtquellen – je eine für rotes, blaues und grünes Licht – aufgebaut sein. Da es zu umständlich wäre, dazu jedes Bildelement mit einem anderen Gas zu füllen, hat man das Prinzip der Leuchtstoffröhre angewandt: Der Bildschirm selbst ist mit einem einheitlichen Gas gefüllt, das ultraviolettes Licht aussendet; hingegen ist die Scheibe mit unterschiedlichen Leuchtstoffen beschichtet, die das nicht sichtbare ultraviolette Licht in rote, blaue und grüne Bildpunkte umwandeln.
Wegen ihrer hohen Leistungsaufnahme setzt man Plasmabildschirme meist in Geräten ein, die nicht sonderlich stromsparend oder tragbar sein müssen. Sie eignen sich besonders für stationäre, an eine Wand montierte Systeme, denn Bilddiagonalen bis zu 1,50 Meter sind ohne weiteres möglich. Sollte sich eine gute Farbdarstellung preisgünstig erzielen lassen, wären solche Schirme für das hochauflösende Fernsehen bestens geeignet.
Eine andere Gruppe von flachen, selbstleuchtenden Bildschirmen beruht auf der Dünnschicht-Elektrolumineszenz. Ursprünglich hatte man gehofft, diesen Effekt zur Wohnungsbeleuchtung einsetzen zu können. Es zeigte sich jedoch schon bald, daß der Wirkungsgrad dafür bei weitem nicht ausreicht. Realisieren ließen sich hingegen Lumineszenzzellen, die – rasterförmig nach Art einer Matrix angeordnet – als großflächige Anzeigetafeln dienen.
Ein Lumineszenzdisplay ist ähnlich wie ein Plasmabildschirm aufgebaut, nur ist der gasgefüllte Raum zwischen den gekreuzten Leiterbahnen ersetzt durch zwei isolierende Schichten, zwischen denen sich ein Leuchtstoff befindet – in der Regel mit Mangan dotiertes Zinksulfid (Bild 2 rechts). Wenn die Spannung einen gewissen Schwellenwert überschreitet, kommt es zu einem Durchschlag, so daß Strom durch den Leuchtstoff fließt. Dies regt die Mangan-Ionen dazu an, gelbes Licht abzustrahlen.
Derartige Bildschirme sind zwar recht dauerhaft, weisen allerdings auch zwei Nachteile auf: Sie verbrauchen fast so viel Energie wie Plasmabildschirme, und eine Farbdarstellung ist nicht möglich, weil man bisher noch keinen blauen Leuchtstoff gefunden hat, der die Ansprüche an Helligkeit, Effizienz und Dauerhaftigkeit erfüllen würde. Zudem müßte eine Vielzahl von Graustufen darstellbar sein, was ebenfalls erhebliche Probleme aufwirft. Des weiteren nimmt der Wirkungsgrad mit steigender Zahl der Bildelemente ab. Jedes Element wirkt nämlich wie ein kleiner Kondensator, weshalb viel Energie einfach nur dafür verbraucht wird, sie alle wiederholt zu laden und zu entladen – ein erhebliches Hindernis für die Anwendung solcher Displays in batteriebetriebenen Geräten.
Die ersten Flüssigkristall-Bildschirme
Eine weitere Gruppe von Bildschirmen emittiert selbst kein Licht. Die wichtigste derartige Technik nutzt die elektro-optischen Eigenschaften von Flüssigkristallen – organischen Molekülen, die fast so regelmäßig angeordnet sind wie in einem Kristall, wenngleich die Substanz flüssig ist.
Dieser ungewöhnliche Materiezustand ist gar nicht so selten. Angenommen, ein Chemiker würde nach dem Zufallsprinzip irgendwelche organischen Verbindungen synthetisieren, dann entstünden etwa bei jedem tausendsten Experiment Moleküle mit Flüssigkristall-Eigenschaften. Bereits seit etwa hundert Jahren kennt man diese Art von Molekülen; sie treten in vielen Formen auf, zum Beispiel in Zellmembranen und im Seifenschaum.
Die wichtigsten Flüssigkristalle sind die nematischen (nadelförmigen) Verbindungen. Deren langgestreckte Moleküle können zwar aneinander vorbeigleiten, aber schwache zwischenmolekulare Kräfte halten ihre Längsachsen parallel – die Anordnung erinnert an einen Schwarm Fische. Die Ausrichtung der Moleküle läßt sich durch Anlegen eines elektrischen Feldes oder durch Kontakt mit einer speziell bearbeiteten Oberfläche gezielt beeinflussen. Dadurch verändern sich gleichzeitig die optischen Eigenschaften, insbesondere die Transparenz gegenüber Licht (siehe „Flüssigkristalle für optische Displays“ von Ulrich Finkenzeller, Spektrum der Wissenschaft, August 1990, Seite 54).
Eines der gebräuchlichsten Flüssigkristall-Anzeigesysteme ist die TN-Zelle (nach englisch twisted nematic, verdrillt nematisch). Auf zwei gegenüberliegenden Glasplatten ist jeweils auf der Innenseite eine elektrisch leitende, transparente Schicht (zum Beispiel aus Indium-Zinnoxid) aufgebracht. Darauf ist je eine dünne Orientierungsschicht aus einem organischen Polymer aufgetragen. Dessen Moleküle wurden bei Herstellung der Schicht in eine bestimmte Richtung gestrichen, so daß ein Rillenmuster vorliegt. Durch noch nicht genau bekannte Oberflächenkräfte überträgt sich die Orientierung der Polymermoleküle auf diejenigen der dazwischen befindlichen flüssigkristallinen Substanz. Die Verdrillung wird erreicht, indem man die Glasscheiben so aufeinanderlegt, daß die Orientierungsschichten um einen rechten Winkel gegeneinander gedreht sind.
Polarisiertes Licht folgt beim Durchgang durch die TN-Zelle der Verdrillung der Flüssigkristall-Moleküle. Bringt man nun vor und hinter der Zelle zwei um ebenfalls 90 Grad gegeneinander versetzte Polarisationsfilter an, welche die gleiche Orientierung wie die Moleküle an den Orientierungsschichten haben, lassen sie das Licht ungehindert passieren. (Ohne die Zelle würden die Polarisationsfilter im gekreuzten Zustand das Licht absorbieren.) Dies ist der eingeschaltete Zustand, die Zelle erscheint hell (Bild 3). Legt man an die zwei lichtdurchlässigen Leiterschichten ein elektrisches Feld, ist die Zelle ausgeschaltet. In diesem Zustand richten sich die Flüssigkristall-Moleküle nämlich mit ihren Längsachsen parallel zu den Feldlinien aus und können das einfallende Licht nicht mehr drehen. Die Zelle ist dann optisch neutral, so daß die beiden gekreuzten Polarisationsfilter das Licht absorbieren. In einer realen Zelle nimmt die Lichtdurchlässigkeit je nach Größe der angelegten Spannung auch Werte zwischen den Zuständen „Ein“ und „Aus“ an.
Ein vollständiges Flüssigkristall-Display (LCD nach englisch liquid crystal display) besteht nun aus einer Vielzahl solcher Zellen. Sie werden angesteuert, indem man auf die eine Glasscheibe die Zeilenelektroden und auf die andere die Spaltenelektroden aufbringt, so daß jeder Kreuzungspunkt die Adresse eines Bildelements definiert. Da das Licht von einem Reflektor oder von einer Hintergrundbeleuchtung kommt, funktioniert der Bildschirm wie eine Anordnung winziger elektronisch gesteuerter Verschlüsse. Wegen seiner Einfachheit und seiner geringen Spannungs- und Leistungsanforderungen ist das Passivmatrix-LCD inzwischen zum meistverkauften flachen Bildschirmtyp überhaupt geworden.
Die Einfachheit bedingt jedoch auch gewisse Einschränkungen. Wie Paul M. Alt und Peter Pleshko von der Firma IBM gezeigt haben, läßt sich die Auflösung nur zu Lasten des Kontrasts verbessern. Der Grund dafür ist das bauartbedingte Übersprechen: Um ein Bildelement anzusteuern, legt man zunächst an eine Bildzeile eine Spannung an und wählt die Spannung der Spalten dann so, daß an der gewünschten Stelle eine ausreichend hohe Gesamtspannung anliegt. Dabei ist jedoch immer auch an nicht angewählten Pixeln eine geringe Spannung vorhanden (Bild 4).
Der Aufbau des gesamten Bildes dauert etwa eine sechzigstel Sekunde, wobei die Bildzeilen nacheinander von oben nach unten angewählt werden. Dabei liegt an den angesteuerten Bildelementen eine hohe und an den anderen derselben Zeile eine mittlere Spannung an; die nicht aktivierten Elemente in allen anderen Zeilen stehen gleichwohl unter einer schwachen Übersprechspannung.
Da das Übersprechen um so stärker wird, je größer die Zeilenzahl ist, nimmt der Spannungsunterschied zwischen angesteuerten und nicht angesteuerten Elementen mit zunehmender Displaygröße ab. Er beträgt bei einem 240-Zeilen-Bildschirm (das ist etwa die Hälfte eines normalen Fernsehbildschirms) nur noch 6,7 Prozent. Ein Display aus TN-Zellen benötigt hingegen einen Spannungsunterschied von mindestens 50 Prozent.
Vom passiven zum aktiven Display
Es gibt dennoch drei Möglichkeiten, den Kontrast zu steigern, ohne daß die Auflösung darunter litte.
Zum einen kann man versuchen, die elektro-optische Kennlinie der Flüssigkristalle steiler zu machen, so daß schon geringe Spannungsunterschiede große Veränderungen in der Lichtdurchlässigkeit bewirken. Bei sogenannten STN-Zellen (nach englisch supertwisted nematic, super-verdrillt nematisch) erreicht man dies durch Verdrillen der Flüssigkristalle um 180 Grad oder mehr.
Zweitens kann man Flüssigkristalle mit Gedächtniseffekt verwenden, wodurch sich viele Zeilen ohne den ansonsten auftretenden Kontrastverlust ansteuern lassen. So hat man mit ferroelektrischen Flüssigkristallen, die eben diesen Effekt aufweisen, bereits Bildschirme mit mehr als tausend Zeilen gebaut. Solche Displays sind zwar relativ schnell, sie weisen aber lediglich zwei stabile Durchlässigkeitszustände auf, so daß sie nur schwer verschiedene Graustufen darstellen können. Wegen dieses Nachteils eignen sich Passivmatrix-Bildschirme kaum zur Darstellung realistischer Bilder.
Die dritte und radikalste Lösung des Problems besteht darin, Adressierung und optische Funktion der Bildelemente zu trennen und einzeln zu optimieren. Solch ein Aktivmatrix-Bildschirm besteht aus einer Anordnung von Transistoren, von denen jeder ein einzelnes Bildelement aktiviert. Nur dann, wenn der zugehörige Transistor eingeschaltet ist, kann über die entsprechende vertikale Leiterbahn (die Spalte der Matrix) eine Spannung zur optischen Ansteuerung angelegt werden. Bei ausgeschaltetem Transistor lassen sich die anderen Zeilen aktivieren, ohne daß sich dadurch die Spannung des betreffenden Bildelements veränderte.
Da auf diese Weise ein Übersprechen nicht möglich ist, lassen sich sehr viele Zeilen getrennt ansteuern. Auch eine Farbdarstellung ist kein Problem: Man faßt die Bildelemente und ihre zugehörigen Transistoren in Dreiergruppen zusammen und setzt vor jedes Element ein Filter für eine der drei Grundfarben (Bild 1).
Nachdem die Adressierung alle Zeilen durchlaufen hat, wird der gesamte Bildschirm neu beschrieben. Diese Art der Bildwiederholung (refreshing) verhindert Verzerrungen des Bildes: Würden Zellen trotz ihres über längere Zeit un-veränderten Anzeigewertes nicht immer wieder neu beschrieben, flössen langsam Ladungsträger aus ihnen ab, wodurch sich das Transmissionsverhalten der Zellen änderte. Zudem lassen sich auf diese Weise mit einer entsprechend hohen Bildwiederholfrequenz Fernsehbilder und schnelle Bildwechsel realisieren.
Solche Aktivmatrix-Bildschirme ähneln in ihrer Funktion den DRAM-Speicherchips (nach englisch dynamic random-access memories, dynamische Speicher mit wahlweisem Zugriff). Beide sind komplexe, integrierte Schaltkreise, die Ladungsträger an mehr als einer Million Positionen speichern, wobei jede von einem zugehörigen Transistor angesteuert wird. Während jedoch ein Computer das DRAM zeilenweise ausliest, erfaßt das menschliche Auge den gesamten Bildschirm gleichzeitig.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß ein DRAM digitale, ein Aktivmatrix-Bildschirm hingegen analoge Daten speichert. Der Zustand einer DRAM-Zelle ist entweder „Ein“ oder „Aus“, während die Display-Elemente jeden beliebigen Grauwert anzunehmen vermögen. Ein Monitor muß darum erheblich mehr Informationen verarbeiten können als ein DRAM vergleichbarer Größe.
Die dazu erforderlichen Qualitätsmerkmale hat man inzwischen mit präzisen Konstruktionsverfahren und engen Herstellungstoleranzen verwirklichen können. Günstig dabei ist, daß die Toleranzen jeweils nur auf kleiner Fläche, nämlich zwischen benachbarten Bildelementen, eingehalten zu werden brauchen; denn das Auge nimmt zwar feine Veränderungen an Rändern kleiner Objekte wahr, aber nicht solche, die sich nur allmählich über die Bildschirmfläche hinweg bemerkbar machen.
Zur Ansteuerung des Aktivmatrix-Displays dienen Dünnschichttransistoren (thin-film transistors, TFTs). Sie haben ihren Ursprung in der Solarzellen-Technologie und lassen sich in großen Anordnungen billig herstellen. Ihr einziger Nachteil – geringe Strombelastbarkeit – ist in Bildschirmen belanglos, da für die Ansteuerung von Flüssigkristallen sehr schwache Ströme genügen.
Wie bei herkömmlichen Transistoren wird der Strom bei TFTs über zwei Anschlüsse geleitet; der dritte schaltet das Bauelement ein und aus. Während jedoch üblicherweise die einzelnen Komponenten des Transistors in die Oberfläche eines einzigen Halbleiterkristalls eingebettet sind, dessen elektrische Eigenschaften an bestimmten Stellen verändert wurden, besteht ein Dünnschichttransistor aus Lagen unterschiedlicher Materialien, die jeweils den Halbleiter, die Isolatoren und die Elektroden bilden. TFTs lassen sich praktisch auf jeder Oberfläche, auch auf billigem Glas, herstellen.
Flüssigkristall-Displays mit Dünnschichttransistoren
Obwohl Paul K. Weimer von der Firma RCA bereits 1962 den Dünnschichttransistor konzipiert hatte, vergingen bis zur Entwicklung eines marktreifen Produkts noch 20 Jahre. Anfangs hatte man TFTs in herkömmlichen elektronischen Schaltkreisen einsetzen wollen; andere elektronische Bauteile lösten sie indes bereits vor ihrer Anwendungsreife ab, so daß sich die meisten Ingenieure von der Weiterentwicklung der TFT-Technik abwandten. Erst 1974 zeigte T. Peter Brody von der Firma Westinghouse, daß sich Dünnschichttransistoren als Schalter für Flüssigkristall-Bildschirme einsetzen lassen. Aber selbst das erwies sich als recht kompliziert, da man mit den damaligen Materialien und Herstellungsverfahren keine großen Anordnungen stabiler und defektfreier TFTs herzustellen vermochte.
In der Folge probierte man verschiedene Halbleitermaterialien aus. Polykristallines Silicium war schließlich das erste, das in einem kommerziellen Produkt verwendet wurde: in einem von der japanischen Firma Seiko-Epson 1984 auf den Markt gebrachten Taschenfernseher, dessen Fünf-Zentimeter-Monitor eine überraschend gute Bildqualität hatte. Freilich mußte man zu seiner Herstellung teure Produktionsverfahren aus der Halbleitertechnik und hochtemperaturbeständige Werkstoffe einsetzen.
Schon damals zeichnete sich jedoch ab, daß die Zukunft dem amorphen Silicium gehören würde. Dieser Werkstoff aus der Solarzellentechnik sollte – so hatte 1979 die Arbeitsgruppe von P.G. LeComber an der Universität Dundee (Großbritannien) erkannt – auch für die Dünnschichttransistoren in Bildschirmen geeignet sein.
Mehrere Schritte sind erforderlich, um Anordnungen aus TFTs herzustellen. Das Trägermaterial ist Glas, aus dem alle Alkalimetalle entfernt sind, weil sonst die Transistoren und auch der Flüssigkristall verunreinigt würden. Mit einem von der Firma Corning entwickelten Verfahren wird das Glas zu dünnen Scheiben gegossen, deren Oberflächenrauhigkeit äußerst gering ist – entsprechend dürfte ein Fußballfeld nur Unebenheiten aufweisen, die nicht höher sind, als ein Grasblatt breit ist.
Im nächsten Schritt trägt man die Halbleiterschicht auf. Dazu bringt man das Glassubstrat in eine Atmosphäre geringen Drucks aus Silan (SiH4), dessen Moleküle durch eine elektrische Entladung ionisiert und zersetzt werden; ihre Bruchstücke schlagen sich dann auf dem Glas als amorphe, wasserstoffreiche Siliciumschicht nieder. Die Wasserstoffatome haben die wichtige Funktion, offene Bindungen abzusättigen, die ansonsten Elektronen einfangen und den Halbleitereffekt beeinträchtigen würden. Schließlich bringt man Metallelektroden, Isolatoren und die anderen TFT-Elemente in einem Verfahren auf, wie es ähnlich auch bei der Herstellung integrierter Schaltkreise eingesetzt wird – mit dem Unterschied, daß hier eine viel größere Fläche zu bearbeiten ist.
Etwa zwei Dutzend Firmen, die meisten davon in Japan, entwickelten Mitte der achtziger Jahre solche TFT-Flüssigkristall-Displays. Schon wenige Jahre später stellten IBM/Toshiba, Sharp, Hitachi und andere Unternehmen Farbmonitore mit einer Diagonale von 25 Zentimetern oder mehr und hervorragender Bildqualität vor. Damit erreichten flache Bildschirme erstmals in Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung (Leuchtkraft) die Qualität von Kathodenstrahlröhren. Bei einem direkten Vergleich ziehen sogar die meisten Betrachter das scharfe, unverzerrte und flimmerfreie Bild des TFT-Flüssigkristall-Displays vor.
In der Herstellung ist ein TFT-LCD allerdings noch um ein Mehrfaches teurer als ein herkömmlicher Bildschirm. Um die für eine Weiterentwicklung des Produktionsverfahrens erforderlichen Erfahrungen zu sammeln, wird man sich wohl zunächst auf solche Anwendungen konzentrieren, die ohne flache Bildschirme gar nicht zu realisieren wären.
Das sind unter anderem winzige Fernsehgeräte, Monitore für Videokameras, tragbare Computer (vielleicht sogar Armbandrechner), Bildschirme in Autos zur Darstellung von Verkehrsleitinformationen, Anzeigen für die militärische und zivile Luft- und Raumfahrt sowie elektronische Bücher, Notizzettel und Pinwände. Weitere innovative Produkte dürften schon bald folgen: beispielsweise Monitore, die auf den Einkaufswagen von Supermärkten montiert sind, um die Kunden über Sonderangebote zu informieren, und Bildschirme für die Darstellung computererzeugter Szenen (virtuelle Realität), die wie eine Brille aufgesetzt werden können.
Mit solchen Produkten werden weltweit vermutlich bereits 1995 sechs bis acht Milliarden Mark jährlich umgesetzt werden. Vielleicht sind dann auch die Herstellungskosten pro Einheit auf das Niveau der Kathodenstrahlröhren gesunken. Gegen Ende des Jahrhunderts wird der Umsatz mit flachen Bildschirmen den mit Kathodenstrahlröhren sicherlich überflügeln.
In dem Maße, in dem flache Bildschirme leichter werden, größere Auflösung haben und weniger Strom verbrauchen, verdrängen sie vermutlich mehr und mehr das Papier. Denn ein weiterer wichtiger Vorteil außer ihrer Anwendungsvielfalt ist, daß sie auf den Druck eines Fingers oder eines Stifts reagieren können. Auf diese Weise läßt sich vielleicht das bislang schwächste Glied in der Kommunikationstechnik erheblich vereinfachen – die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer.
Ein flaches Display mit Speichereinheit könnte einen großen Aktenschrank ersetzen. Auch völlig neue Anwendungen werden sich eröffnen. Vielleicht wird der Bildschirm der Zukunft, wenn er nicht als Fernseher oder Computermonitor in Gebrauch ist, chamäleongleich im Muster der umgebenden Tapete verschwinden – oder er zeigt Ihnen berühmte Gemälde oder die Lieblingsphotos aus Ihrem Familienalbum (Bild 5). Und eines Tages können Sie womöglich Spektrum der Wissenschaft als elektronisches Medium auf Ihrem persönlichen Bildschirm lesen und auf Knopfdruck Videographiken einspielen oder Hintergrundinformationen abrufen.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 5 / 1993, Seite 42
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
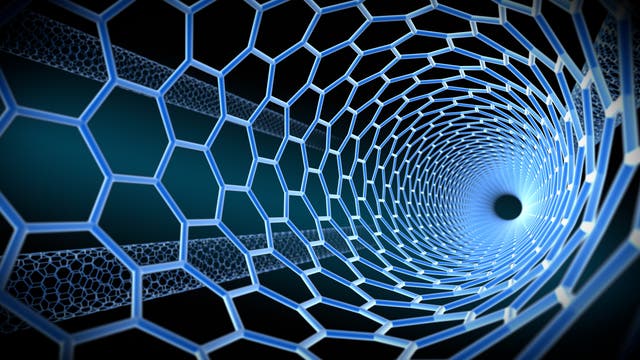


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben