Flüssige Quantencomputer
Eine 400stellige Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen würde selbst die schnellsten Supercomputer mehrere Milliarden Jahre kosten (Spektrum der Wissenschaft, September 1996, Seite 80); daran hängt die Sicherheit einiger Verschlüsselungsverfahren. Aber Geräte einer völlig neuen Bauart könnten diese Aufgabe mit Hilfe quantenmechanischer Effekte in etwa einem Jahr bewältigen – mit entsprechenden Folgen für die Vertraulichkeit von Daten. Noch besteht kein Anlaß zur Besorgnis, denn Quantencomputer gibt es bislang nur in der Theorie. Immerhin ist man der Realisierung schon näher gekommen. Ein solcher neuartiger Computer hätte mit dem Gerät auf dem Büroschreibtisch so gut wie nichts mehr gemein – eher schon mit der Tasse Kaffee daneben.
Wir sind nämlich – wie andere Forschungsgruppen auch – davon überzeugt, daß eines Tages Quantencomputer, deren wesentlicher Bestandteil Flüssigkeitsmoleküle sind, die konventionellen Rechnern gesetzten Schranken überwinden werden. Ein Transistor kann nicht kleiner, eine elektrische Verbindung nicht dünner werden als ein Atom, und weit vor dieser absoluten Grenze der Miniaturisierung wäre die Herstellung extrem kleinteiliger (und entsprechend leistungsfähiger) Mikrochips nicht zu bezahlen. Hingegen könnte die Quantenmechanik wie durch Zauberei alle diese Probleme umgehen.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Darstellung eines Bits, der kleinsten Informationseinheit. In einem klassischen digitalen Rechner wird es durch ein Bauteil realisiert, das zwei Zustände annehmen kann: 0 und 1. Ein sogenanntes Wort aus n Bits wird als Folge von n Nullen und Einsen dargestellt. In einem Quantencomputer ist ein Bit ebenfalls etwas (typischerweise ein Atom), das zwei verschiedene Zustände annehmen kann. Zwei Quanten-Bits – kurz Qubits genannt – können wie gewöhnliche Bits vier verschiedene, wohldefinierte Zustände annehmen, nämlich 00, 01, 10 und 11. Man nennt dies die reinen Zustände.
Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Bit kann ein Qubit jedoch auch in einer Überlagerung der reinen Zustände 0 und 1 existieren (siehe "Quanten-Computer" von Seth Lloyd, Spektrum der Wissenschaft, Dezember 1995, Seite 62). Man weiß im allgemeinen nicht, in welchem Zustand das Atom ist, bis man ihn mißt. Dadurch aber zerstört man unwiderruflich diesen Zustand, denn die Messung ergibt stets 0 oder 1 und nichts dazwischen. Ein überlagerter Zustand ist zu beschreiben durch eine Wahrscheinlichkeit (genauer: eine Wahrscheinlichkeitsamplitude) dafür, daß eine Messung den einen oder den anderen Wert ergeben würde.
Interessant wird es, wenn zwei verschiedene Qubits nicht unabhängig voneinander sind. Dann kommt es nämlich nicht auf die Wahrscheinlichkeiten für die reinen Zustände jedes einzelnen Qubits an, sondern auf die für alle reinen Zustände des Ensembles. Das sind bei zwei Qubits schon vier numerische Koeffizienten. Allgemein gesprochen erfordert ein Ensemble aus n Qubits 2n Zahlen zu seiner Beschreibung, was für große Werte von n sehr viel wird. Für n=50 braucht man bereits ungefähr 1015 Zahlen. Allein deren Speicherung würde bei sehr bescheidener Genauigkeit ungefähr 10 Millionen Festplatten zu einem Gigabyte in Anspruch nehmen – vom Rechnen mit solchen Mengen an Zahlen ganz zu schweigen. Rechnen mit einem Quantencomputer bedeutet hingegen Manipulieren des überlagerten Zustandes – und das ist, als würden alle 1015 Zahlen zugleich verarbeitet. Ein Quantencomputer arbeitet also wie ein gigantischer Parallelrechner.
Fernwirkung
Eine andere Eigenschaft von Qubits ist noch merkwürdiger – und ebenfalls nützlich. Stellen wir uns einen physikalischen Prozeß vor, bei dem zwei Photonen (Lichtquanten) emittiert werden, eines nach links und eines nach rechts, und zwar so, daß ihre elektrischen Feldkomponenten entgegengesetzt polarisiert sind. Vor einer Messung sind die Polarisationsrichtungen beider Photonen unbestimmt. Wie schon Albert Einstein (1879 bis 1955) und andere um 1928 bemerkten, wird mit der Messung der Polarisation eines Photons zugleich die des anderen festgelegt; wie weit die beiden Lichtteilchen sich voneinander entfernt haben, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Daß diese Fernwirkung eine Distanz schneller überwinden kann als das Licht, ist das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon (Spektrum der Wissenschaft, Oktober 1993, Seite 40). Quantensysteme sind also auf rätselhafte Weise miteinander verknüpft – man spricht von Verschränkung (entanglement); das gilt auch für die Qubits in einem Quantencomputer. Anton Zeilinger und seine Kollegen von der Universität Innsbruck haben im vergangenen Jahr diese Quantenfernwirkung in einem bemerkenswerten Experiment demonstriert.
Im Jahre 1994 zeigte Peter W. Shor von der Forschungsabteilung von AT&T (heute in Florham Park, New Jersey), wie ein Quantencomputer mit Hilfe von Verschränkung und Superposition eine ganze Zahl in Primfaktoren zerlegen könnte – und zwar um Größenordnungen schneller als die besten klassischen Rechner. Diese Entdeckung erregte großes Aufsehen, denn plötzlich schienen alle Verschlüsselungssysteme gefährdet, deren Sicherheit auf der Faktorisierung großer Zahlen beruht. Da gerade die Banken sich solcher Systeme zur Wahrung der Vertraulichkeit bedienen, rüttelte Shors Entdeckung an einem Grundpfeiler der elektronisch abgewickelten Weltwirtschaft.
Niemand hätte gedacht, daß ein solcher Durchbruch aus einer anderen Disziplin als der Informatik oder der Zahlentheorie kommen könnte. Alsbald machten sich die Informatiker daran, Quantenmechanik zu lernen, und die Physiker befaßten sich mit der Theorie des Computers.
Wie dressiert man Spins?
Es war klar, daß die Umsetzung von Shors Idee in die Praxis teuflisch schwierig werden würde. Denn nahezu jede Wechselwirkung eines Quantensystems mit seiner Umgebung – wenn etwa ein Atom ein anderes oder ein zufällig vorbeikommendes Photon trifft – ist im Prinzip dasselbe wie eine Messung. Die Überlagerung der Quantenzustände bricht zusammen, und es bleibt ein reiner Zustand: Man spricht vom Kollaps der Wellenfunktion. Damit geht auch das bisher erzielte – und in dem überlagerten Zustand gespeicherte – Rechenergebnis verloren. Um die sogenannte Kohärenz zu erhalten, muß das Innere eines Quantencomputers streng von der Umgebung isoliert werden – aber nicht total: Man muß ja Daten laden, Rechnungen ausführen und Resultate ablesen können.
Christopher R. Monroe und David J. Wineland vom amerikanischen Normeninstitut NIST in Gaithersburg (Maryland), H. Jeff Kimble vom California Institute of Technology in Pasadena und andere haben diese Isolierung auf elegante Weise zu bewerkstelligen versucht. So kann man mit magnetischen Feldern geladene Teilchen gefangenhalten und dann abkühlen, bis sie reine Quantenzustände erreichen (Spektrum der Wissenschaft, März 1990, Seite 100). Aber selbst diese experimentellen Meisterleistungen taugen nur für kläglich wenige Quantenoperationen, die Konstrukte enthalten nur eine geringe Anzahl an Bits, und die Kohärenz geht schnell verloren.
Wie ist dieses Hindernis zu überwinden? Im letzten Jahr wurde uns klar, daß man alle Schritte einer Quantenrechnung mit einer ganz gewöhnlichen Flüssigkeit durchführen kann: Herstellen eines definierten Anfangszustandes, logisches Operieren auf den verschränkten Überlagerungen und Lesen des Endergebnisses. Zusammen mit einer anderen Forschungsgruppe von der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts) und vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) am gleichen Ort fanden wir eine geeignete Technik, Quanteninformation in Flüssigkeiten zu manipulieren: Es handelt sich um die Kernspinresonanz (nuclear magnetic resonance, NMR), die auch in der Medizin zur Tomographie eingesetzt wird (Spektrum der Wissenschaft, Juli 1993, Seite 56, und Juni 1997, Seite 102).
Jedes Molekül einer geeigneten Flüssigkeit ist ein einzelner Quantencomputer. Da ein Reagenzglas somit eine riesige Anzahl von Computern enthält, kann man es in Kauf nehmen, wenn einige davon der Dekohärenz durch Wechselwirkung zum Opfer fallen. Wenn man es richtig betrachtet, betreiben die Chemiker, die seit Jahrzehnten komplizierte Moleküle mit Kernspinresonanz-Spektroskopie untersuchen, Quanten-Rechnen, ohne es zu wissen.
Kernspinresonanz betrifft die Spins der Atomkerne der Flüssigkeitsmoleküle. Es handelt sich um eine Eigenschaft, die von dem Gewirr der Wechselwirkungen unter den Flüssigkeitsmolekülen nahezu unbeeinflußt bleibt – jedenfalls kurzfristig. Nur die unten zu beschreibenden elektromagnetischen Felder haben eine merkliche Wirkung. Deswegen erfordert die Erhaltung der Kohärenz keinen sonderlichen Aufwand; man muß die Moleküle nicht auf ultratiefe Temperaturen kühlen, damit sie stillhalten, oder sie in einer Vakuumkammer isolieren (Bild 2).
Zu den Teilchen mit Spin zählen auch ganze Atomkerne; ihr Spin setzt sich aus denen der in ihnen enthaltenen Protonen und Neutronen zusammen. Ein solches Teilchen verhält sich wie ein winziger Stabmagnet: In einem äußeren magnetischen Feld richtet es sich entlang der Feldlinien aus, und zwar parallel oder antiparallel. Die beiden Möglichkeiten der Ausrichtung entsprechen zwei Quantenzuständen mit verschiedenen Energien; damit ist ein solcher Atomkern ein Qubit. Wir können dem parallelen Spin die Zahl 1 und dem antiparallelen die Zahl 0 zuordnen. Der Zustand mit parallelem Spin hat niedrigere Energie als der andere, und diese Energiedifferenz hängt von der Stärke des äußeren Magnetfeldes ab. Im Normalfall sind in einer Flüssigkeit beide Ausrichtungen gleich häufig vertreten, aber das äußere Magnetfeld begünstigt parallele Spins, und so entsteht ein geringfügiges Ungleichgewicht zwischen den beiden Zuständen. Dieser winzige Überschuß, vielleicht nur ein Millionstel, wird bei einem NMR-Experiment gemessen.
Zusätzlich zum festen magnetischen Feld nutzt man in der Kernspinresonanz variierende elektromagnetische Felder. Durch ein oszillierendes Feld mit genau der richtigen Frequenz (die durch die Stärke des konstanten Feldes und die Eigenschaften der beteiligten Teilchen bestimmt wird) kann man gewisse Spins von einem Zustand in den anderen umklappen lassen.
So kann man Protonen (Wasserstoff-Atomkerne), die sich in einem festen äußeren Magnetfeld von 10 Tesla befinden, mit einem oszillierenden Feld von etwa 400 Megahertz beeinflussen, einer in der Radiotechnik üblichen Frequenz. Dieses Feld wird gewöhnlich nur ein paar millionstel Sekunden lang eingeschaltet. Während dieser Zeit rotieren die Kernspins um die Richtung des oszillierenden Feldes, das in der Regel senkrecht zum festen Magnetfeld angelegt wird. Ist der ozillierende Radiofrequenzimpuls gerade lang genug, um die Spins um 180 Grad zu drehen, so gibt es nun im Gegensatz zu vorher einen Überschuß an Kernspins, die antiparallel zum festen Magnetfeld stehen. Nach einem Puls von nur der halben Zeitdauer wäre ein zuvor parallel ausgerichteter Spin mit der gleichen Wahrscheinlichkeit parallel wie antiparallel.
Quantenmechanisch ausgedrückt ist ein solcher Spin gleichzeitig in den beiden Zuständen 0 und 1. Klassisch pflegt man diese Situation so darzustellen, daß die Teilchenspins mit der Richtung des festen Magnetfeldes einen Winkel von 90 Grad bilden (Bild 3). Ähnlich wie ein Kreisel, dessen Achse nicht lotrecht steht, führen dann die Teilchen Präzessionsbewegungen um das magnetische Feld aus: Die Drehachse selbst rotiert mit einer charakteristischen Frequenz. Dabei wird ein schwaches Radiofrequenzsignal ausgesandt, das die NMR-Apparatur registriert.
Jedoch spüren die Teilchen mehr als nur die angelegten Felder. Jeder Atomkern beeinflußt auch das Feld in seiner unmittelbaren Umgebung. In einer Flüssigkeit mitteln sich diese Effekte wegen der ständigen thermischen Bewegung der Moleküle aus – ausgenommen die Wirkungen zwischen zwei Atomkernen im selben Molekül. Sie werden über die Elektronen vermittelt, die sich um beide Kerne zugleich bewegen.
Diese Eigenschaft erweist sich nun nicht als störend, sondern im Gegenteil als sehr nützlich. Man kann nämlich mit den zwei Kernspins sehr einfach ein logisches Verknüpfungsglied (Gatter) aufbauen, das elementare Bauteil für digitales Rechnen. Für unsere 2-Spin-Experimente verwendeten wir Chloroform (CHCl3). Die interessante Wechselwirkung ist die zwischen den Kernen des Kohlenstoff- und des Wasserstoffatoms. Da der Kern von normalem Kohlenstoff (C-12) keinen Spin hat, verwendeten wir Chloroform mit einem Kohlenstoffisotop (C-13), das ein zusätzliches Neutron enthält und deshalb einen Spin aufweist.
Nehmen wir an, das angelegte Magnetfeld sei wie in Bild 3 nach oben gerichtet. Der Spin des Wasserstoffs sei unbestimmt, parallel oder antiparallel zum angelegten Magnetfeld, aber der des Kohlenstoffs in einem definierten Zustand, nämlich aufwärts: parallel zum festen Magnetfeld. Ein Radiofrequenzpuls geeigneter Frequenz und Dauer dreht den Kohlenstoffspin in die horizontale Ebene. Er präzediert dann um die Vertikale mit einer Rotationsgeschwindigkeit, die von der Wechselwirkung mit dem Wasserstoffkern abhängt. Je nachdem, ob der benachbarte Wasserstoffspin auf- oder abwärts zeigt, wird deshalb nach einer gewissen, sehr kurzen Zeit der Kohlenstoffspin in die eine Richtung oder in die entgegengesetzte zeigen. Zu genau diesem Zeitpunkt legen wir wieder einen Radiofrequenzpuls an, der den Kohlenstoffspin um weitere 90 Grad dreht. Dadurch klappt er in die Abwärtsrichtung, wenn der benachbarte Wasserstoffspin aufwärts zeigte, oder zurück in die Aufwärtsrichtung im anderen Fall (Bild 4).
Diese Abfolge von Operationen realisiert genau die Aktion eines Bauteils, das die Elektroingenieure mit dem Namen Exklusiv-ODER-Gatter bezeichnen. Ein besserer Name wäre bedingtes NICHT; denn der Zustand des einen Eingangssignals bestimmt, ob das andere Eingangssignal umgekehrt wird oder nicht, bevor es zum Ausgangssignal wird. Klassische Computer bestehen aus ähnlichen Gattern mit zwei Eingängen sowie gewöhnlichen NICHT-Gattern mit nur einem Eingang, aber 1995 konnte eine Forschungsgruppe zeigen, daß in einem Quantenrechner alle Rechenoperationen aus den beiden beschriebenen – Spin rotieren und bedingtes NICHT – zusammengesetzt werden können. Dieses Quanten-Gatter kann sogar mehr als sein klassisches Gegenstück, denn seine Ein- und Ausgangssignale müssen keine reinen Zustände sein. Vielmehr kann es gewissermaßen mit den Eingangssignalen 0 und 1 zugleich rechnen.
Zwei auf einen Streich
Im Jahre 1996 begannen wir zusammen mit Mark G. Kubinec von der Universität von Kalifornien in Berkeley, einen bescheidenen 2-Bit-Quantencomputer aus einem Fingerhutvoll Chloroform zu bauen. Es erfordert bereits beträchtlichen Aufwand, dieses Gerät in den richtigen Anfangszustand zu versetzen. Eine Reihe von Radiofrequenzimpulsen muß die zahllosen Atomkerne in der Flüssigkeit genau so transformieren, daß eine Überschußmenge an Spins in die richtige Richtung zeigt. Dann müssen diese Qubits einer Reihe von Zustandsänderungen unterworfen werden. Während in einem konventionellen Computer die Bits in Form von Stromimpulsen geordnet die logischen Gatter durchwandern, gehen Qubits nirgendwohin. Statt dessen kommen die Gatter zu ihnen, und zwar in Form verschiedener Kernspin-Manipulationen. Im wesentlichen besteht das auszuführende Programm aus einer Serie von Radiofrequenzpulsen.
Unsere erste Quanten-Programmierübung war ein genialer Suchalgorithmus, den Lov K. Grover von den AT&T-Laboratorien sich ausgedacht hat. Ein Ding in einem ungeordneten Haufen von N Dingen zu finden erfordert im Durchschnitt N/2 Versuche: In Ermangelung anderer Anhaltspunkte muß man eben eines nach dem anderen überprüfen, bis man das richtige gefunden hat. Erstaunlicherweise benötigt Grovers Quantensuche nur etwa SQRTN Versuche. Als Beispiel diente uns ein Ding, das unser Zwei-Qubit-Computer in einem einzigen Schritt aus einer Liste mit vier Möglichkeiten fand (Bild 5). Auf dem üblichen Wege würde man im Durchschnitt zwei bis drei Versuche brauchen.
Die Möglichkeiten des Chloroform-Computers sind wegen seiner bescheidenen Anzahl von zwei Qubits sehr eng begrenzt. Mehr sind denkbar, aber sicherlich nicht mehr, als das verwendete Molekül Atome hat. Oberhalb von 10 Qubits sinkt bei Zimmertemperatur die Signalstärke unter die Möglichkeiten derzeitiger Kernspin-Apparaturen; ein eigens für diesen Zweck gebautes Gerät würde vielleicht noch mit 30 bis 40 Qubits funktionieren. Für noch größere Computer müßte man jedoch die Spins mit anderen Mitteln in Reih und Glied bringen. Mit einem geeigneten Laser (durch sogenanntes optisches Pumpen) wäre außerdem die thermische Bewegung der Moleküle großenteils auszuschalten, jedoch ohne daß die Flüssigkeit erstarrt oder die langen Kohärenzzeiten zerstört werden.
Man könnte also größere Quantencomputer bauen. Aber wie schnell wären sie wohl? Die Schaltzeit wird bestimmt durch die langsamste unter den Präzessionsgeschwindigkeiten der Spins; typische Werte liegen zwischen einigen hundert und fünf bis zehn Umdrehungen pro Sekunde. Das scheint trostlos langsam verglichen mit einem heute üblichen PC-Prozessor, der während einer einzigen solchen Umdrehung Millionen von Rechenschritten ausführt. Aber ein Quantencomputer mit genügend vielen Qubits wäre einem so massiv parallelen Rechner gleichwertig, daß er eine 400stellige Zahl immer noch in etwa einem Jahr faktorisieren könnte.
So glänzende Aussichten haben uns motiviert, über die Konstruktion eines ernstzunehmenden Quantencomputers nachzudenken. Moleküle mit genügend Atomen zu finden ist kein Problem. Leider werden mit wachsender Atomanzahl die Wechselwirkungen zwischen weit entfernten Spins zu klein, als daß man sie noch als logische Gatter nutzen könnte. Doch es ist nicht alles verloren. Seth Lloyd vom MIT hat gezeigt, daß es genügen würde, wenn jedes Atom nur mit einigen seiner nächsten Nachbarn wechselwirkt; die Prozessoren mancher Parallelrechner sind auf ähnliche Weise miteinander verbunden. So könnten Kohlenstoffkerne in einer langen Kohlenwasserstoff-Kette, mit Kernspin-Techniken angeregt, als Qubits dienen: der (Polyethylen-)Plastiktüten-Computer.
Ein weiteres technisches Hindernis ist die begrenzte Kohärenzzeit. Rotierende Kernspins in einer Flüssigkeit verlieren ihre Kohärenz nach einigen Sekunden bis Minuten. Sie geraten aus dem Takt, ähnlich Synchronschwimmern, denen zeitliche Anhaltspunkte fehlen. Unter günstigen Umständen reicht die begrenzte Haltbarkeit eines Quantenzustandes vielleicht aus, um 1000 Operationen durchführen. Diese Grenze kann man weiter hinausschieben, indem man zusätzliche Qubits zur Fehlerkorrektur einbaut.
In einem klassischen Computer sind Fehlerkorrektur-Bits nichts Besonderes. Sie tun ihre Wirkung, indem der Prozessor sie von Zeit zu Zeit mit den übrigen vergleicht und bei Unstimmigkeiten Korrekturen vornimmt. In einem Quantencomputer jedoch wäre ein solcher Vergleich eine Messung, und die würde, wie oben beschrieben, alles zerstören. Deswegen waren viele Experten überrascht, als Shor und andere zeigten, daß Quantenfehler im Computer selbst korrigiert werden können, ohne daß der fehlerhafte Zustand je gelesen werden müßte.
Trotzdem wird die Konstruktion solcher Geräte, die in ihrer Leistung mit den schnellsten klassischen Rechnern mithalten können, nach wie vor sehr schwierig bleiben. Aber wir glauben, daß die Mühe lohnt. Ein Quantencomputer ist nämlich, quasi als Nebeneffekt, auch ein quantenmechanisches System und jeder Ablauf eines Programms ein Experiment, das über diesen Zweig der Physik Auskunft gibt. Am Ende könnten sogar die Quantencomputer ihren konventionellen Gegenstücken auf die Sprünge helfen, wenn nämlich im Verlauf der weiteren Miniaturisierung quantenmechanische Effekte eine Rolle zu spielen beginnen. Aus diesem Grund hatte der amerikanische Physiker Richard Feynman (1908 bis 1988) schon früh über Rechner nachgedacht, die Quanteneffekte nutzen.
Bei allen technischen Problemen bleibt ein erfreulicher Aspekt: Große Errungenschaften in Miniaturisierung oder gar Nanotechnik werden nicht erforderlich sein. Den schwierigsten Teil der Konstruktion eines Quantencomputers hat die Natur längst erledigt, nämlich das Zusammensetzen von Molekülen aus Atomen. Mit anderen Worten: Ganz gewöhnliche Moleküle konnten schon immer gut rechnen. Nur haben wir die Ergebnisse nie richtig abgefragt.
Literaturhinweise
– Principles of Magnetic Resonance. Von Charles P. Slichter. Dritte Auflage, Springer, 1992.
– Quantum Information and Computation. Von Charles H. Bennett in: Physics Today, Band 48, Heft 10, Seiten 24 bis 30, Oktober 1995.
– Quantum Mechanics Helps in Searching for a Needle in a Haystack. Von L. K. Grover in: Physical Review Letters, Band 79, Heft 2, Seiten 325 bis 328, 14. Juli 1997.
– Bulk Spin-Resonance Quantum Computation. Von N. A. Gershenfeld und I. L. Chuang in: Science, Band 275, Seiten 350 bis 356, 17. Januar 1997.
– A Silicon-Based Nuclear Spin Quantum Computer. Von B. E. Kane in: Nature, Band 393, Seiten 133 bis 137, 14. Mai 1998.
– Experimental Realization of a Quantum Algorithm. Von Isaac L. Chuang, Lieven M. K. Vandersypen, Xinlan Zhou, Debbie W. Leung und Seth Lloyd in: Nature, Band 393, Seiten 143 bis 146, 14. Mai 1998.
– Experimental Implementation of Fast Quantum Searching. Von I. L. Chuang, N. Gershenfeld und M. Kubinec in: Physical Review Letters, Band 80, Seiten 3408 bis 3411, 1998.
– Implementation of a Quantum Search Algorithm on a Quantum Copmuter. Von Jonathan A. Jones, Michele Mosca und Rasmus H. Hansen in: Nature, Band 393, Seiten 344 bis 346, 28. Mai 1998
Aus: Spektrum der Wissenschaft 8 / 1998, Seite 54
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH




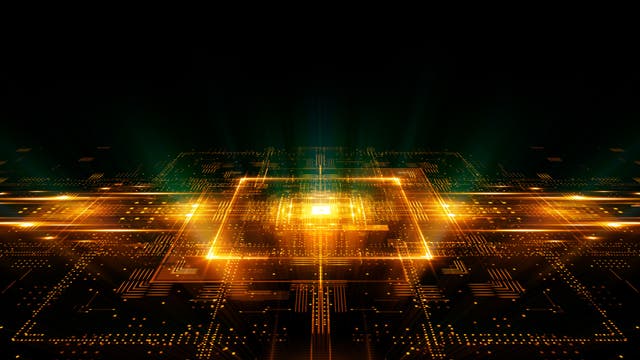

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben