Historische Experimente auf dem Prüfstand
Die Allgegenwart von Wissenschaft und Technik in allen Lebensbereichen ist eine noch recht junge Entwicklung. Erst im 17. Jahrhundert begannen Forscher, die naturwissenschaftliche Methode zu entwickeln. Als belegt gilt demnach nur, was sich im Experiment zeigen läßt, und das auch nur, sofern es – jedenfalls prinzipiell – stets reproduzierbar ist.
Als ein Wegbereiter gilt Galileo Galilei (1564 – 1642), der 1590 entdeckt hatte, daß alle Körper auf der Erdoberfläche der gleichen abwärts gerichteten Kraft unterliegen und daher die Geschwindigkeit eines fallenden Körpers – und nicht etwa der zurückgelegte Weg – proportional zur Fallzeit ist. Unter Wissenschaftshistorikern war aber noch Anfang der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts umstritten, ob Galilei anhand von Kugeln, die eine schiefe Ebene herabrollen, das Fallgesetz experimentell gefunden hatte. Nicht wenige glaubten, er habe lediglich Gedankenexperimente durchgeführt. Sie waren nicht die ersten Zweifler. Um 1636 kritisierte Marin Mersenne (1588 – 1648), französischer Naturforscher und Mitbegründer der Pariser Akademie der Wissenschaften: "Ich stelle die Frage, ob Herr Galilei die Experimente über den Fall längs schiefer Ebenen ausgeführt hat, denn er behauptet dies nirgendwo und die Proportionalitäten, die er angibt, widersprechen oft dem Experiment." Offensichtlich vermochte Mersenne die entsprechenden Experimente nicht mit übereinstimmenden Resultaten zu wiederholen.
Darum wurde bezweifelt, ob Galileis Ergebnisse mit damaligen Meß- und Versuchsmethoden zu erreichen waren. Das Studium von Veröffentlichungen, Briefen und Manuskripten half nicht weiter; deshalb wiederholte der amerikanische Wissenschaftshistoriker Thomas B. Settle 1961 einige der Experimente entsprechend Galileis Beschreibungen, darunter auch das von Mersenne erwähnte. Mit Erfolg, denn seine experimentellen Messungen stimmten mit der von Galilei behaupteten Gesetzmäßigkeit überein. Den Disput entschied schließlich der Fund einer von Galilei verfaßten Manuskriptseite, die auch einige Meßwerte enthielt.
Dieses Beispiel illustriert ein großes Problem der Wissenschaftsgeschichte: Das historische Experiment im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext zu verstehen ist ein zentrales Anliegen, doch das Studium zugehöriger schriftlicher Quellen erbringt oft zu wenig Information.
Um herauszufinden, welche Randbedingungen entscheidenden Einfluß auf das Gelingen der Versuche hatten, ist eine Wiederholung – besser: ein Nachvollziehen – oft unentbehrlich. Dies schließt freilich das Studium aller verfügbarer Quellen und sonstige in der wissenschaftsgeschichtlichen Forschung etablierten Methoden ein. Die an dem Fachbereich Physik der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg entwickelte sogenannte Replikationsmethode verknüpft dabei drei Schritte:
den möglichst originalgetreuen Nachbau der Geräte und Apparaturen,
den Nachvollzug der experimentellen Handlungen der beteiligten Personen sowie
die Rekonstruktion des wissenschaftlichen, historischen und sozialen Kontextes der Experimente.
Was waren für Forscher wie Galilei die wesentlichen Erfolgsbedingungen bei der praktischen Durchführung ihrer Experimente? Standen ihnen bestimmte Materialien zur Verfügung, gab es besondere Gerätschaften ungenannter Instrumentenmacher, spezielle Räumlichkeiten, in den Aufzeichnungen unerwähnte Helfer oder verfügten sie über besondere Fähigkeiten? Replikationen ermöglichen einen neuen Blick auf den historischen Versuch sowie eine Neuinterpretation des vorhandenen Quellenmaterials.
Dafür nun drei Beispiele: Jean Paul Marats Versuche zum Wesen der Elektrizität, das Torsionsexperiment Charles Augustin Coulombs zur Kraftwirkung elektrischer Ladungen (Coulombsches Gesetz) und die Entdeckung des Joule-Thomson-Effekts, auf dem das Linde-Verfahren zur Verflüssigung von Gasen beruht, durch James Prescott Joule und William Thomson
Der Versuch als Spektakel
Daß der Arzt und Publizist Jean Paul Marat (1743 – 1793) bis zu seiner Ermordung einer der radikalsten Volksführer der Französischen Revolution war, wissen viele. Wenige aber kennen seine Versuche, eine der brennenden wissenschaftlichen Fragen der damaligen Zeit zu klären: welcher Natur die elektrischen Erscheinungen seien. Nicht weniger als 212 Experimente hat er diesbezüglich durchgeführt; 1782 veröffentlichte er sie in einer 461seitigen Untersuchung (ähnlich umfangreiche Abhandlungen über Wärme und Licht hatte Marat zu diesem Zeitpunkt schon publiziert).
Damals waren in der Physik Fluidum-Theorien verbreitet: Ein oder mehrere stoffliche, aber sehr leichte und flüchtige Fluida (Gase oder Flüssigkeiten), die alle Körper zu durchdringen vermögen, wurden zur Erklärung verschiedener Phänomene wie Licht und Wärme postuliert. War Elektrizität eine Verbindung solcher Stoffe?
Marat versuchte, mit qualitativen Experimenten seine Vorstellungen eines elektrischen Fluidums, das sich von den Wärme- und Lichtstoffen deutlich unterscheiden sollte, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu demonstrieren. Dazu mußte es wahrnehmbar gemacht werden: "Die elektrische Flüssigkeit offenbart sich also nur dann, wenn sie in Wirkung gesetzt ist..." Das geschah offensichtlich während der Entladung elektrisierter Körper; Marat untersuchte deshalb vor allem Funkenentladungen
Dazu verwendete er auch Standardgeräte damaliger Forschung wie die Elektrisiermaschine. Die erste war 1660 von dem deutschen Naturforscher Otto von Guericke (1602 – 1686) gebaut worden; in der folgenden Zeit entwickelte sich daraus die gebräuchlichste Elektrizitätsquelle: Reibzeug (wie Leder mit Amalgambelag) wurde an eine rotierende Glasscheibe gehalten, die sich elektrisch auflud; über metallene Spitzen hat man diese Ladung auf einer als Speicher dienenden Metallkugel (Konduktor) akkumuliert und dann spektakulär in einem Funken wieder entladen. Anstelle des Konduktors verwendete Marat häufig Leidener Flaschen, die sich besser als Elektrizitätsspeicher eigneten. Sie waren 1745 von dem Geistlichen E. Jürgen von Kleist (1700 – 1748) und dem Leidener Naturphilosophen Pieter van Muschenbroek (1692 – 1761) unabhängig voneinander erfunden worden.
Schnell etablierte sich diese älteste Form des Kondensators als Standardgerät in der Elektrizitätsforschung. Es bestand aus einer innen und außen mit Zinnfolie überzogenen Glasflasche; die innere Metallfolie wurde mittels einer Elektrisiermaschine aufgeladen, die äußere geerdet. So ergab sich eine viel größere Kapazität als bei der einfachen Metallkugel, wodurch beim Verbinden der Folien stärkere Entladungen auftraten.
In einigen Experimenten stellte Marat die leitende Verbindung mit Wasser, Salz oder Rotwein her und verglich dann die entstehenden Funken und deren Färbung. Diese Versuche haben wir nachvollzogen und dabei Beobachtungen gemacht, die weitgehend mit den Beschreibungen in seinem Werk von 1782 übereinstimmen. Andererseits zeigte sich deutlich, daß die unmittelbar sichtbaren Erscheinungen nur sehr unvollkommen in Worte zu fassen sind. Für Marat war das aber kaum ein Problem, da er seine Versuche auch öffentlich vorführte, eine damals durchaus übliche Form, den Wahrheitsgehalt wissenschaftlicher Ergebnisse glaubhaft zu machen.
Andere Experimente des Forschers blieben nach der Lektüre seiner Schriften zunächst rätselhaft. So wollte er zeigen, daß das elektrische und das magnetische Fluidum nicht identisch sein können. Einer drehbar gelagerten Magnetnadel näherte er zuerst einen Magneten und dann eine geladene Leidener Flasche – die Nadel reagierte jedesmal. Anschließend wurde sie in Wasser gestellt und der Versuch wiederholt. Nun blieb die Nadel nach Marats Beschreibung von der Leidener Flasche unbeeindruckt. Das schien zunächst unverständlich, doch die Replikation läßt vermuten, daß sich der Kondensator bei der Annäherung in das Wasser entladen hatte. Dieses Detail findet sich nicht in den Aufzeichnun-gen, vielleicht weil es für Marat mehr auf die Gemeinsamkeit in den Erscheinungen ankam als auf stringente, detaillierte Erklärungen.
Ganz andere Interessen verfolgte der Militäringenieur Charles Augustin Coulomb (1736 – 1806). Ihm ging es nicht um Anzahl und Eigenschaften der elektrischen Fluida, sondern vor allem um eine mathematische Beschreibung physikalischer Zusammenhänge. Coulomb wurde aufgrund seiner Arbeiten zum Magnetismus sowie zur Statik von Bauwerken 1781 zum Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften, dieser für Frankreich in allen wissenschaftlichen Fragen entscheidenden Institution, ernannt. Nur drei Jahre nach Marats Publikation, 1785, begann er vor diesem Gremium mit der Vorstellung seiner Arbeiten zur Elektrostatik, die sich über sechs Jahre hinzogen und in insgesamt sechs Abhandlungen publiziert wurden.
In den ersten beiden Abhandlungen beschrieb er zwei Experimente, deren Ergebnisse als Begründung des heute nach ihm benannten Grundgesetzes der Elektrostatik galten.
In dem einen versuchte Coulomb nachzuweisen, daß die elektrostatische Anziehungskraft zwischen zwei Ladungen mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Dazu befestigte er an einem Ende eines dünnen Stäbchens aus Schellack (einer Art Harz) eine etwa pfenniggroße Blattgold-Scheibe. Zudem benötigte er einen sehr dünnen, unverdrillten Faden, gezogen aus dem Kokon einer Seidenraupe, mit dem er das Stäbchen an einem Holzgestell aufhängte. Diesen Teil der Apparatur stellte Coulomb vor eine große, elektrisch isolierte Metallkugel.
Kugel und Scheibe wurden dann elektrisch ungleichnamig aufgeladen, die Scheibe also von der Kugel angezogen. Daraufhin hatte Coulomb seiner Beschreibung nach das Stäbchen mitsamt der Scheibe seitlich ausgelenkt, wodurch es begann, um seinen Aufhängepunkt zu schwingen. Coulomb bestimmte die Periode der Torsionsschwingung, die bei zunehmender Anziehungskraft kleiner wurde; diese Kraft wiederum war abhängig vom Abstand zwischen Kugel und Scheibe. Coulomb gab drei Meßwertpaare an, die für ihn einen ausreichenden Beweis für seine Formulierung des Gesetzes darstellten.
Auf diese Weise wird das Experiment normalerweise in Darstellungen der Physik-Geschichte beschrieben. Warum der französische Ingenieur aus nur drei Meßwerten so weitreichende Schlußfolgerungen zu ziehen wagte, war eine der Fragen, die wir durch eine Replikation klären wollten.
Bereits der Nachbau erwies sich als alles andere als einfach. Natürlich vermochten die Werkstätten der Universität die entsprechenden hölzernen Gestelle zu fertigen, doch verfügte zunächst niemand über die erforderlichen Werkstoffkenntnisse und Fertigkeiten, um das System aus Schellack-Stab, Seidenfaden und Blattgold-Scheibe herzustellen. Es half nichts: Der Replikator mußte zunächst ähnliche Qualifikationen erwerben wie seine historischen Vorgänger: Wie läßt sich ein Faden ausreichender Länge von einem Kokon ablösen, wie ein Schellack-Stäbchen herstellen? Womit und wie kann daran eine Blattgold-Scheibe befestigt werden? Auf welche Weise sind Stab und Scheibe so an dem Faden anzubringen und zu justieren, daß sie waagerecht hängen? Notwendig war ein hohes Maß an Geschick, das erst im Umgang mit den Materialien erworben werden konnte. Derartige Fähigkeiten bleiben freilich in historischen Veröffentlichungen unerwähnt, zumal man sie auch nicht präzise zu verbalisieren vermag.
Widersprüche und offene Fragen
Das Auslenken der Scheibe mußte extrem vorsichtig geschehen, weil sonst der Faden riß oder das Blattgold zerknitterte. Um jeden störenden Luftzug zu vermeiden, waren sehr vorsichtige Bewegungen und sogar flaches Atmen nötig. Coulomb hatte fraglos ebenfalls mit diesen Widrigkeiten zu kämpfen. Eine öffentliche Vorführung des Experiments wäre auf keinen Fall in Frage gekommen.
Für das Gelingen war zudem die Ladungsmenge auf der Kugel entscheidend, wie unsere Versuche zeigten: War sie zu klein, kam keine gut meßbare Schwingung zustande, war sie zu groß, wurde die Torsionsschwingung von einem Pendel in Richtung Kugel überlagert, wodurch sich deren Dauer nicht mehr präzise bestimmen ließ.
Wesentliche Aspekte von Versuchsaufbau und -durchführung offenbarte also erst der Nachvollzug. Dies gilt auch für das zweite von Coulomb beschriebene Experiment zur Bestimmung des Kraft-Abstand-Gesetzes, das auf der gegenseitigen Abstoßung gleichnamiger elektrischer Ladungen beruhte. Zentrales Meßinstrument war dabei eine Torsions- oder Drehwaage: An einem 0,04 Millimeter dünnen Silberdraht, der am oberen Ende an einem von Coulomb so genannten Torsionsmikrometer befestigt war, hing ein kleiner Kupferzylinder. Daran wiederum, senkrecht zum Faden, war eine nichtleitende Stange befestigt, die an einem Ende eine Ku-gel aus Holundermark trug. Diese berührte im Versuch eine zweite, feststehende Kugel.
Waren beide elektrisch gleichnamig geladen, so stießen sie sich ab, und der Draht wurde verdrillt. Coulomb wußte aus seinen vorangegangenen Untersuchungen zur Messung des Magnetfeldes und zur Bestimmung des Torsionswinkels von Metallfäden, daß zum Verdrehen eine Kraft erforderlich ist, die mit dem Winkel proportional ansteigt; außerdem war damals bereits bekannt, daß die elektrische Abstoßungskraft mit zunehmender Entfernung schwächer wird. Demnach mußte es eine stabile Gleichgewichtslage geben, in der sich die abstoßende und die rückstellende Kraft gerade ausgleichen: Die bewegliche Kugel kommt zur Ruhe.
Indem Coulomb dann den Faden weiter verdrillte, störte er das Gleichgewicht. Die erste Kugel kam der zweiten wieder näher und pendelte sich in einer neuen Gleichgewichtsposition ein. Mit dem Torsionsmikrometer ließen sich die jeweiligen Winkel dieser Positionen als Maß für die abstoßenden Kräfte genau einstellen und ablesen. Auf diese Weise ergaben sich Paare von Drehwinkeln und Abständen; deren Verhältnis zueinander entsprach jeweils dem Verhältnis der Abstoßungskräfte und der zugehörigen Abstände zwischen den beiden Kugeln. Coulomb hat die elektrostatischen Kräfte also nicht absolut, sondern in Relation zueinander bestimmt.
Wieder veröffentlichte der Wissenschaftler nur drei Meßwertpaare als Beleg für sein Gesetz. Mit seinem Instrument konnte er zwar prinzipiell sehr kleine Kräfte messen, etwa entsprechend der Gewichtskraft einer Masse von zwei Millionstel Gramm. Und dennoch: Wie konnte er so sicher sein?
Auch dieser Versuchsaufbau erwies sich als problematisch: So verwendete Coulomb als isolierende Stäbe mit Schellack überzogene Seidenfäden. Auch die Handhabung des dünnen Silberfadens, der an eine Halterung angelötet werden mußte, erforderte langwieriges Üben.
Die Durchführung des Experiments selbst hielt eine Überraschung für uns bereit: Die Torsionswaage lieferte keine Meßwerte, die mit der von Coulomb angegebenen Gesetzmäßigkeit übereinstimmten. Eine umgekehrt quadratische Abhängigkeit der Kraft vom Abstand – Aussage des Coulombschen Gesetzes – ergab sich nicht. Erst mittels einer damals noch unbekannten Abschirmvorrichtung für äußere Ladungen konnten wir schließlich entsprechende Werte messen. Ursache für die Probleme waren vermutlich elektrische Ladungen auf der Kleidung des Experimentators.
Coulomb hatte mit großer Wahrscheinlichkeit mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das provoziert natürlich die Frage, wie seine Meßwerte zustande kamen. Wenn man Betrugsabsichten ausschließt, bleiben nur wenige Möglichkeiten. War es Coulomb gelungen, durch Maßnahmen, die er geheim hielt, das Aufladungsproblem in den Griff zu bekommen (etwa dadurch, daß er seine Kleidung erdete oder daß er nackt experimentierte)? Oder hatte er vielleicht passende Meßwerte ausgewählt, die seiner tiefen Überzeugung entsprachen, daß das elektrische Gesetz analog dem 1666 von Isaac Newton (1643 – 1727) gefundenen Gravitationsgesetz strukturiert sein müsse?
An diesem Punkt stößt die Replikationsmethode freilich an ihre Grenzen. Völlig zuverlässig ist ein physikalisches Experiment nach über 200 Jahren nicht mehr zu wiederholen. Beispielsweise wies die amerikanische Wissenschaftshistorikerin Mary Trumpler von der Universität Yale in New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) darauf hin, daß Coulombs Kleidung oder seine gepuderte Perücke nicht mit ausreichender Sicherheit zu reproduzieren sind. Immerhin weisen schriftliche Quellen darauf hin, daß äußere Ladungen (die vermutlich vom Experimentator stammen) auch andere Experimente des Franzosen störten, ohne daß er Abhilfe schaffen konnte.
Warum erforschte Coulomb trotz dieser Probleme die Elektrostatik? Recherchen im Archiv der Pariser Akademie der Wissenschaften ergaben, daß 1784, also kurz vor Beginn dieser Arbeiten, die Akademie nach einem technisch und ökonomisch optimalen Blitzschutz für Pulvermagazine suchte. Eines der Mitglieder der zu diesem Zweck eingesetzten Kommission war Coulomb. So lassen sich seine Untersuchungen als ein Programm interpretieren, das Berechnungsgrundlagen für einen idealen Blitzableiter zum Ziel hatte.
Vom Naturgesetz zur Präzisionsmessung
Durch den Nachvollzug der Experimente sehen wir sie heute also in neuem Licht. Gleichzeitig ist deutlich geworden, daß Marat und Coulomb höchst unterschiedliche Methoden anwandten: Marat sah die Funkenentladung als das zentrale Mittel zur Erkenntnis an, und seine Versuche waren so angelegt, daß die Effekte deutlich sichtbar vor Publikum demonstriert werden konnten. Ihm ging es darum, das Wesen der Elektrizität zu bestimmen. Für Coulomb war diese Fragestellung irrelevant, er verwies sogar darauf, daß seine Ergebnisse sowohl unter Annahme eines Fluidums wie auch unter der von zwei Fluida gleichwertig seien. Für ihn war die mathematisch-quantitative Beschreibung viel wichtiger. Zu diesem Zweck führte er die Präzisionsmessung in die Elektrizitätsforschung ein.
Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nutzten Forscher sie auch erfolgreich in der Thermodynamik und Energiephysik. Eines der heute klassisch zu nennenden Experimente ist unter dem Stichwort "Joule-Thomson-Effekt" in den physikalischen Lehrbüchern zu finden. Ein reales Gas, das in einen Bereich mit einem niedrigeren Druck strömt, kühlt sich dabei ab oder erwärmt sich je nachdem, ob seine Ausgangstemperatur über oder unter einem für das jeweilige Gas charakteristischen Wert liegt. Diese sogenannte Inversionstemperatur ist beispielsweise für Luft, Stickstoff und Kohlendioxid höher als die Zimmertemperatur, für Wasserstoff und Helium geringer.
Im Mai des Jahres 1852 fuhr der junge Glasgower Physik-Professor William Thomson (1824 – 1907) nach Manchester, um dort mit dem wohlhabenden Privatgelehrten und Brauereibesitzer James Prescott Joule (1818 – 1889) gemeinsam zu experimentieren. Joule propagierte das Prinzip der Energieerhaltung und hatte zum Beweis bereits zahlreiche Versuche durchgeführt. Doch war er in der Fachwelt noch nicht akzeptiert und suchte die Unterstützung Thomsons, der bereits ein etablierter Wissenschaftler war. Vor allem erhoffte Joule sich Rückendeckung im Streit mit dem deutschen Arzt Julius Robert Mayer (1814 – 1878) um die Priorität bei der Formulierung des Prinzips der Energieerhaltung. In den folgenden Experimenten wollte Joule jeglichen Anspruch Mayers durch den Nachweis eines Argumentationsfehlers abweisen.
In den von uns replizierten Versuchen wurde mit einer Handpumpe Luft durch eine Leitung gepumpt, die an einem Ende mit einem teildurchlässigen Stopfen verschlossen war, so daß sich im davor liegenden Rohr ein Druck aufbauen konnte (Bild rechts). Die spiralförmige Leitung hatten die beiden Wissenschaftler in ein Wasserbad getaucht, um die durchströmende Luft auf eine definierte Temperatur zu bringen. Hinter dem porösen Stopfen hatten sie dann die Lufttemperatur gemessen: Sie war geringfügig kleiner.
Teile der Originalapparatur befinden sich noch in einem Museum in Manchester, was den Nachbau wesentlich erleichterte. Vorsicht war allerdings geboten: Joule selbst hatte Teile des Aufbaus in späteren Experimenten nochmals verwendet und dazu verändert. Für die Präzision des Experiments war es offenbar entscheidend, mit der Handpumpe einen gleichmäßigen Luftstrom zu erzeugen: Wir verzeichneten selbst bei kleinen Änderungen im Rhythmus des Pumpens unerwünschte Temperaturschwankungen. Diese Erfahrung stimmt mit einer Fußnote in Joules und Thomsons Veröffentlichung überein, in der sie über das gleiche Problem berichteten.
Sie erwähnten aber an keiner Stelle – weder in ihrer Veröffentlichung noch in Briefen oder im Labortagebuch –, wie lange gepumpt werden mußte und wer dies tat. In der Replikation stellte sich die Temperatur der ausströmenden Luft nach ungefähr fünf bis sechs Minuten auf einen konstanten und damit exakt meßbaren Wert ein. Joules Labortagebuch zufolge waren bei manchen Versuchsdurchgängen bis zu 48 Pumpzüge pro Minute erforderlich, um den notwendigen Druck in der Leitung aufrecht zu erhalten. Eine Meßreihe bestand zudem aus bis zu zehn Einzelmessungen. Alles in allem: Es mußte ungefähr eine Stunde lang äußerst gleichmäßig gepumpt werden – eine enorme körperliche Belastung.
Des weiteren hatte jemand das Wasserbad zu rühren, um Temperaturunterschiede in dem Rohrsystem zu vermeiden; und der Experimentator mußte Thermometer sowie Manometer ablesen. Die Replikation machte also deutlich, daß den Versuch unmöglich eine Person allein durchführen konnte. Thomson blieb im Mai 1852 aber nur zehn Tage in Manchester, und laut Veröffentlichung führte Joule die Experimente fort. Viele Versuche, dies zeigen auch Joules Labortagebuch und der Briefwechsel mit Thomson, erfolgten sogar erst nach Thomsons Abreise. Wer experimentierte also im Keller des Jouleschen Privathauses in 1, Acton Square?
Joule dürfte sich wohl auf das Ablesen des Thermometers und des Manometers beschränkt haben, was nach damals allgemeiner Auffassung die entscheidende Tätigkeit eines Experimentators war. Außerdem litt der Gelehrte seit seiner Kindheit an einer Rückenerkrankung, so daß er das anstrengende Pumpen kaum hätte leisten können. Es muß ihm also mindestens eine weitere – bislang unbekannte – Person geholfen haben, vermutlich ein Hausangestellter oder ein Arbeiter aus der familieneigenen Brauerei.
Diesbezüglich unterschied sich das Joulesche "Privatlabor" deutlich von Thomsons universitärem Forschungs- und Lehrmilieu. Während bei letzterem Studenten mitarbeiteten und ein Assistent fest angestellt war, gibt es in den zur Verfügung stehenden schriftlichen Quellen keinerlei Hinweise auf assistierende Personen in Joules Labor – obwohl diese und folgende Replikationen deutlich zeigen, daß die Durchführung der Versuche Hilfe erforderte. Als Thomson im Herbst desselben Jahres Joule fragte, ob sie für die weiteren Arbeiten nicht einen Assistenten anstellen sollten, lehnte der dies sogar ab – es sei nicht nötig. Er scheint sich bei der Organisation seines Labors eher an der Situation in seiner Brauerei orientiert zu haben: In einem Brief an Thomson wird eine Abneigung gegen "selbstständig arbeitende Assistenten" deutlich.
Dies war wohl auch ein Grund dafür, daß Joule und Thomson nach 1852 begannen, die Experimente mit einer größeren Versuchsapparatur fortzuführen, in der eine Dampfmaschine die Luftpumpe antrieb. Sie erhofften sich einen größeren und gleichmäßigeren Luftstrom. Doch die Maschine arbeitete sogar schlechter als der oder die unbekannten Helfer: Erst eineinhalb bis zwei Stunden nach Beginn des Experiments waren die Druckschwankungen in der Leitung ausgeglichen, und erste Messungen ließen sich vornehmen.
Aus der erwähnten Eintragung im Labortagebuch über die Anzahl der Pumpzüge pro Minute kann man auch Folgerungen über ein anderes Detail des Experiments ziehen: den verwendeten Stopfen. Joule arbeitete zunächst mit einem fast geschlossenen Hahn und danach mit einem Lederstück. Da mit einem Hahn keinerlei befriedigende Ergebnisse reproduziert werden konnten, konzentrierten wir uns auf die Suche nach geeignetem Leder.
Auf den Stopfen kam es an
Wir probierten drei verschiedene Stücke aus. Die "besten" Meßergebnisse erreichten wir mit einem Lederstück, dessen Porosität mit dem Jouleschen weitgehend übereinstimmte. Wir glauben deshalb, daß auch der Gelehrte diesem Detail einige Aufmerksamkeit widmete – obwohl in den schriftlichen Aufzeichnungen darüber nichts zu finden ist. Die von Joule gewählte Durchlässigkeit des Materials war offenbar der optimale Kompromiß zwischen gegensätzlichen Anforderungen: bei einer angemessenen Pumprate einen hohen Druck in der Leitung aufzubauen und möglichst nahe hinter dem Stopfen einen gleichmäßigen Luftstrom zu erzielen. Die große Bedeutung des Stopfens zeigt sich auch daran, daß Joule und Thomson in ihren weiteren Experimenten immer wieder Veränderungen daran vornahmen.
Natürlich war auch die Methode der Messung geringer Temperaturunterschiede – ein geeignetes Thermometer und dessen Positionierung – ausschlaggebend für die Aussagekraft der Experimente. Aufgrund des Versuchsaufbaus galt für das Thermometer eine wichtige Einschränkung: Zumindest das untere Ende durfte einen Durchmesser von höchstens vier Millimetern haben, damit es in die enge Leitung gesteckt werden konnte. Joule und Thomson machten in ihrer Veröffentlichung darüber hinaus nur wenige Angaben über die Instrumente.
Das von uns verwendete Thermometer unterschied sich in einem wichtigen Punkt von dem Jouleschen: Es enthielt mehr Quecksilber, da das Reservoir zylindrisch und nicht sphärisch war. Dies erwies sich aber als vorteilhaft: Das Thermometer ist dann unempfindlicher gegenüber kleinen räumlichen oder zeitlichen Schwankungen des Luftstroms.
Die in der Replikation erzielten Meßdaten stimmten mit den aus der Theorie ableitbaren Erwartungen recht gut überein. Joule und Thomson hingegen waren mit ihren Messungen vom Sommer 1852 nicht zufrieden gewesen. Zwar glaubten sie fest daran, die Abkühlung der Luft bei Entspannung eindeutig nachgewiesen zu haben, konnten aber quantitativ keine Übereinstimmung mit ihren theoretischen Erwartungen erzielen. Letztere waren allerdings auch falsch, wie sie ein Jahr später selbst feststellten. Aber ihre Meßwerte weisen auch darauf hin, daß das von ihnen verwendete Thermometer auf leichte Schwankungen des Luftstroms zu empfindlich reagierte.
Für die historische Analyse ist es bedeutsam, woher die benutzten Instrumente stammten. Im Sommer 1852 mußte Joule zunächst nur Thermometer kaufen, da er alle übrigen Apparate bereits besaß. Joule hatte schon früher von der Handwerkskunst des damals bekannten Instrumentenmachers John Benjamin Dancer (1812 – 1887) profitiert, vermutlich griff er darauf wieder zurück. Die Herstellung von Instrumenten war zwar nur ein kleiner, aber doch wichtiger Bereich der handwerklichen Produktion in der Industriestadt Manchester. Die Bedeutung solcher lokalen Ressourcen wurde insbesondere deutlich, als Joule und Thomson 1853 die Experimente mit einer wesentlich größeren maschinengetriebenen Versuchsapparatur fortführten. Hierfür waren die Kenntnisse und Fertigkeiten von hoch qualifizierten Ingenieuren, Technikern und Handwerkern nötig, die sich in einer Industriestadt wie Manchester leicht finden ließen. Dancer spielte allerdings bald keine Rolle mehr, denn Thomson brachte Meßinstrumente aus Paris mit. Um 1850 begann dann das Kew-Observatorium in London mit der Herstellung sogenannter "Standardthermometer". Rückblickend berichtete Joule 1872, daß fast jeder Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wärmelehre seine Thermometer von dieser Institution bezogen hatte. Auch hier läßt sich wieder ablesen, wie die Idee der Präzisionsmessung das Ideal der physikalischen Forschung wurde, wobei die Standardisierung der Instrumente die Reproduzierbarkeit garantierte.
Gegenüber den Coulombschen Arbeiten zeigt sich ein bereits verändertes Verständnis. Wieder ging es um das Aufstellen eines Gesetzes, das quantitative Aussagen erlaubt, doch Joule und Thomson wählten in der Präsentation ihrer Ergebnisse nicht nur Meßwerte aus, die mit ihrer theoretischen Erwartung übereinstimmten, auch wenn das Resultat zumindest zu Beginn des Projekts aus ihrer Sicht enttäuschte.
Die Forscher selbst wurden zu Helden der Physikgeschichte, deren Instrumente, Labortagebücher und Briefwechsel in Museen und Archiven ihren Platz gefunden haben. Die Praxis ihrer Versuche ist freilich nicht überliefert. Replikationen eröffnen den historisch-sozialen Kontext neu und machen die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisproduktion transparenter. Sie sind eine wichtige Ergänzung der bisher in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung verwendeten Methoden.
Ist die Analyse eines Experiments abgeschlossen, lassen sich die Nachbauten in vielfältiger Weise weiter nutzen, zum Beispiel im Rahmen der Physikausbildung an Schulen und Hochschulen: Eine die Historie einbeziehende Lehrweise kann physikalisches und methodisches Fachwissen sehr gut vermitteln und zudem die gesellschaftliche Funktion der Physik deutlich machen. Für den Laien schließlich bieten Replikationen einen neuartigen Zugang zur Physik: Während die Originalgeräte aufgrund ihres historischen Wertes und ihrer Einzigartigkeit in gesicherten Vitrinen aufbewahrt werden müssen, können Besucher und Besucherinnen von Museen mit den Nachbauten eigene experimentelle Erfahrungen machen.
Literaturhinweise
Jean Paul Marat: Scientist and Revolutionary. Von Clifford D. Connor. Humanities Press, Atlantic Highlands (New Jersey), 1997.
Das Grundgesetz der Elektrostatik. Von Peter Heering. DUV, Wiesbaden, 1998.
Welt erforschen – Welten konstruieren: Physikalische Experimentierkultur vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Von Peter Heering (Hg.). Isensee, Oldenburg, 1998.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 12 / 1999, Seite 86
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH



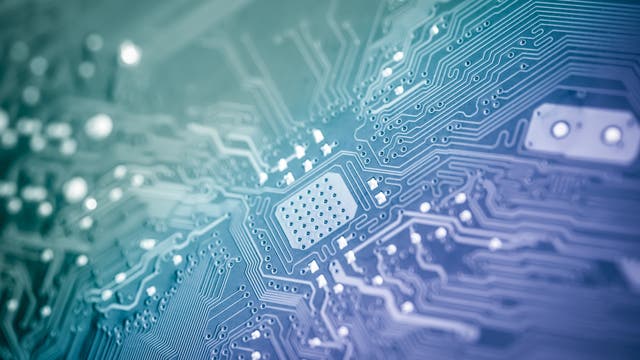

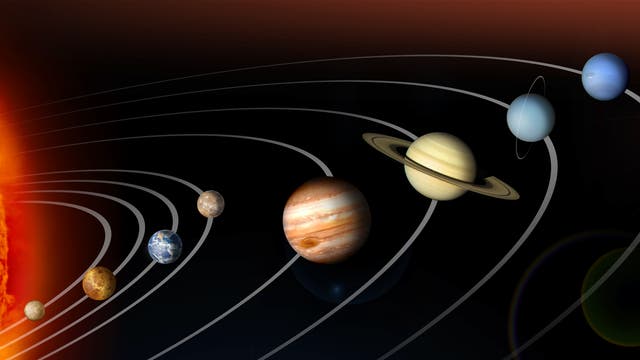
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben