Immunforschung: Impfen gegen Krebs
Sie lieben es versteckt. In allen Körpergeweben, die Kontakt mit der Umwelt haben, liegen sie auf der Lauer. Ihre langen tentakelähnlichen Arme halten sie weit von sich gestreckt – ständig auf der Suche nach Krankheitserregern und deren Giftstoffen.
Sie sind es, die in den Schleimhäuten von Nase und Lunge mit als Erste ein Grippe-Virus registrieren, das wir in einer überfüllten U-Bahn eingeatmet haben. Sie sind es auch, die im Verdauungstrakt das Immunsystem alarmieren, wenn wir mit verseuchter Nahrung eine gefährliche Dosis "giftiger" Salmonellen verschluckt haben. Und von ganz besonderer Bedeutung ist ihre Präsenz in der Haut, wo sie als verborgene Wächter in ständiger Alarmbereitschaft stehen – für den Fall, dass Mikroben den äußeren Schutzwall unserer Oberhaut durchbrechen. Die Rede ist von den dendritischen Zellen, einer Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Sie gehören zu den am wenigsten verstandenen, gleichzeitig aber auch faszinierendsten Akteuren des Immunsystems. Erst in den letzten Jahren konnten Forscher einen Einblick in jene geheimnisvollen Vorgänge gewinnen, mit denen diese Zellen ihre Kollegen in der Abwehr darüber aufklären, was zum Körper gehört und was fremd und damit potenziell gefährlich ist.
Dabei stellten sie Verblüffendes fest: Die merkwürdigen Zellen bringen die Immunantwort überhaupt erst in Gang und regeln gleichzeitig ganz entscheidend deren Art und Verlauf. So erwiesen sie sich als unverzichtbar für die Ausbildung eines immunologischen "Gedächtnisses", das Eindringlinge nach der ersten Bekanntschaft rasch wieder erkennt und bekämpft – die Grundlage für den Erfolg jeder Schutzimpfung. Dendritische Zellen erziehen aber auch das Immunsystem dazu, körpereigene Strukturen zu tolerieren und nicht zu attackieren.
Doch haben die Zellen auch ihre Schattenseiten. Werden sie zum falschen Zeitpunkt aktiviert, können sie Autoimmun-Krankheiten auslösen wie Lupus erythematodes, eine Erkrankung, bei der das Immunsystem die Erbsubstanz der Betroffenen angreift. Im Falle der erworbenen Immunschwäche Aids werden dendritische Zellen zum trojanischen Pferd. Quasi per Anhalter reist das HI-Virus in ihrem Inneren zu den Lymphknoten, wo es auf Unmengen seiner eigentlichen Opfer trifft, auf so genannte T-Helferzellen. Es befällt sie, vermehrt sich in ihrem Inneren, vernichtet die Zellen aber auch. Das Fortschreiten der Krankheit wird so auf fatale Weite beschleunigt. Denn erst durch den massiven Verlust der T-Helferzellen kommt es zum Ausbruch von Aids.
Wissenschaftler wollen die wichtige Rolle, die dendritische Zellen bei der Immunantwort spielen, nutzen und die Zellen für den Kampf gegen Krebs und andere Krankheiten rüsten. Aber auch ihre gezielte Inaktivierung kann medizinisch von großem Nutzen sein.
Potente Stimulatoren
Prinzipiell machen sich dendritische Zellen ziemlich rar: Sie stellen gerade einmal 0,2 Prozent aller weißen Blutkörperchen in der Blutbahn und noch weniger in Geweben wie der Haut. Das ist wohl einer der Gründe dafür, dass den Wissenschaftlern zunächst rund hundert Jahre lang die wahre Funktion dieser Zellen verborgen blieb.
Der deutsche Anatom Paul Langerhans hatte bereits 1868 diesen Zelltypus erstmals beschrieben, ihn aber fälschlicherweise nicht für etwas Eigenständiges gehalten, sondern für Nervenendigungen in der Haut. Erst 1973 entdeckte Ralph M. Steinman von der New Yorker Rockefeller-Universität solche Zellen in der Milz von Mäusen und erkannte, dass sie Teil des Immunsystems sind. In Tierversuchen erwiesen sie sich als außerordentlich potente Stimulatoren der Immunabwehr. Auf Grund ihrer spitzen, astförmigen Arme nannte Steinman sie dendritische Zellen, nach "dendros", griechisch für Baum. Jene Untergruppe, die in der Oberhaut vorkommt, heißt aber noch heute – nach ihrem ursprünglichen Entdecker – Langerhans-Zellen.
Doch selbst nach der Wiederentdeckung der dendritischen Zellen vergingen noch einmal fast zwanzig Jahre an Detailarbeit, bis es endlich möglich war, sie zur eingehenderen Untersuchung in größeren Mengen zu züchten, statt sie mühsam aus frischem Gewebe zu isolieren. 1992 – ich arbeitete damals am Schering-Plough-Laborartorium für Immunologische Forschung in Dardilly (Frankreich) – gelang es meinem Team erstmals, große Mengen dendritischer Zellen aus menschlichen Knochenmarksstammzellen heranzuzüchten. Etwa um die gleiche Zeit berichtete auch Steinman über einen ähnlichen Erfolg: Gemeinsam mit dem Team von Kayo Inaba an der Universität Kioto in Japan hatte er ein Verfahren entwickelt, dendritische Zellen von Mäusen zu kultivieren.
Einen weiteren Weg fanden 1994 schließlich Wissenschaftler um Antonio Lanzavecchia, der mittlerweile am Institut für biomedizinische Forschung im schweizerischen Bellinzona arbeitet, und Gerold Schuler, heute an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie züchteten die begehrten Zellen aus menschlichem Blut. Bestimmte weiße Blutkörperchen – die Monocyten – entpuppten sich als ein gemeinsamer Vorläufer von dendritischen Zellen und großen Fresszellen, die im Körper abgestorbenes Material und Mikroben beseitigen. Inzwischen können wir sogar weniger spezialisierte Vorläuferarten dazu bringen, sich in diese Zellen zu differenzieren. Seither haben sich unsere Kenntnisse über die Funktionsweise dendritischer Zellen enorm erweitert.
Es gibt mehrere Untergruppen solcher Zellen. Sie alle entwickeln sich aus den gleichen Vorläufern, die zunächst im Blut zirkulieren, um sich dann in noch unreifer Form in Haut, Schleimhäuten und Organen wie Lunge und Milz einzunisten. In unreifem Zustand verfügen dendritische Zellen über ganz verschiedene Mechanismen, um Mikroorganismen oder deren Moleküle dingfest zu machen. Sie können
-die Invasoren mit saugnapfartigen Rezeptoren auf ihrer Oberfläche einfangen und vereinnahmen,
-winzige Schlückchen der umgebenden Flüssigkeiten samt gelösten Proteinen aufsaugen,
-Viren oder Bakterien über mikroskopisch kleine, sich einstülpende Membransäckchen aufnehmen.
Manche unreife dendritische Zellen können zudem Viren außer Gefecht setzen, indem sie den Botenstoff alpha-Interferon ausschütten, wie Yong-Jun Liu feststellte, einer meiner früheren Kollegen bei dem Unternehmen Schering-Plough und heute am DNAX Research Institute im kalifornischen Palo Alto tätig. Die Substanz hat vielfältige Wirkungen. Unter anderem wird letztlich die Bildung von Virusproteinen unterdrückt, ohne die keine neue Virusgeneration entstehen kann.
Antigene auf dem Präsentierteller
Haben unreife dendritische Zellen fremde Objekte erst einmal verschlungen, zerlegen sie diese in handliche molekulare Bruchstücke, die von anderen Abwehrzellen erkannt werden können (siehe die Illustration auf den beiden nächsten Seiten). Solche molekularen Strukturen – Antigene genannt – bieten sie dann auf einer Art Präsentierteller auf ihrer Oberfläche zur Begutachtung an. Zur Präsentation dienen Proteine, die als MHC-Moleküle bezeichnet werden. Benannt sind sie nach dem Haupt-Histokompatibilitätskomplex (englisch: major histocompatibility complex), der Gengruppe, in der ihre Bauanleitung verschlüsselt ist. Die Proteine haben eine ganz charakteristische Form: Wie eine Zange mit breiten Backen halten sie die zur Präsentation aufbereiteten Antigene fest.
Dendritische Zellen sind äußerst effektive Fänger und Präsentierer. Selbst fremde Moleküle, die nur in winzigsten Konzentrationen auftreten, entgehen ihnen nicht. Noch während sie das eingefangene Material zur Präsentation aufbereiten, wandern die Zellen bereits über die Blutbahn in die Milz oder über die Lymphbahn zu den Lymphknoten. Dort schließen sie ihren Reifeprozess ab und präsentieren ihre beladenen MHC-Moleküle anderen Zellen des Immunsystems: etwa naiven T-Helferzellen, so genannt, weil sie noch nie mit richtigen Antigenen zu tun hatten. Mehr noch: Die dendritischen Zellen sorgen dafür, dass die Helferzellen ein Antigen als "fremd" oder "gefährlich" einordnen können.
Diese einzigartige Fähigkeit, naive T-Helferzellen zu lehren, was sie zu tun und zu lassen haben, verdanken dendritische Zellen offenbar weiteren, so genannten kostimulatorischen Molekülen auf ihrer Oberfläche. Mit diesen docken sie an passende Rezeptoren einer T-Zelle an, während sie ihr gleichzeitig das Antigen auf dem MHC-Teller servieren. Ist eine T-Helferzelle erst einmal "sensibilisiert", kann sie ihre "hilfreiche" Funktion ausüben: zum Beispiel so genannte B-Abwehrzellen dazu veranlassen, Antikörper zu produzieren. Diese Moleküle heften sich wiederum an das entsprechende Antigen in natura und machen es entweder unschädlich oder markieren es als zu zerstörendes Ziel. Sowohl dendritische Zellen als auch T-Helferzellen aktivieren außerdem T-Killerzellen. Deren Aufgabe ist es, von Erregern befallene Körperzellen zu zerstören. Einige der gut erzogenen T-Helferzellen entwickeln sich zu "Gedächtniszellen", die für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte im Organismus überdauern. Treffen sie später erneut auf das Antigen, gegen das sie sensibilisiert sind, werden sie sehr schnell aktiv – viel schneller als naive T-Helferzellen. Deshalb kann das Immunsystem bei einem erneuten Angriff des gleichen Erregers meist rascher zurückschlagen als beim ersten Mal.
Ob sich der Körper bei einer Infektion schließlich bevorzugt mit Hilfe von Antikörpern oder mit T-Killerzellen wehrt, hängt offenbar zumindest teilweise davon ab, welche Gruppe von dendritischen Zellen die Botschaft überbracht hat. Die Helferzellen produzieren immunstimulierende Substanzen aus der Klasse der Cytokine, und zwar je nach "Ansprache" vom Typ 1 oder 2. Bei einem Befall mit Parasiten und manchen Bakterien ist Typ 2 am besten, sorgt er doch dafür, dass sich das Immunsystem mit Antikörpern wehrt. Typ-1-Cytokine rufen hingegen T-Killerzellen auf den Plan, die mit Körperzellen aufräumen können, in denen sich Viren oder gewisse Bakterien eingenistet haben.
Der richtige Cocktail sorgt für eine angemessene Immunantwort und kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Startet eine dendritische Zelle an dieser Schlüsselstelle das falsche Programm, indem sie die Abgabe des falschen Cytokin-Typs anregt, bekommt die beginnende Offensive des Immunsystems unter Umständen eine falsche Stoßrichtung. Ein Beispiel: Menschen, die sich mit dem Lepra-Bakterium infizieren und eine Immunantwort vom Typ 1 starten, entwickeln eine Nervenlepra – eine milde, "tuberkuloide" Verlaufsform der Erkrankung. Eine Immunantwort vom Typ 2 führt hingegen eher zur gefährlichen "lepromatösen" Form, auch Knotenlepra genannt, die tödlich enden kann.
Die richtige Aktivierung von naiven T-Helferzellen ist auch die Grundlage für erfolgreiche Impfungen – sei es gegen Lungenentzündung, Tetanus oder Grippe. Forscher versuchen nun, ihre neu gewonnenen Kenntnisse über die Aufgaben dendritischer Zellen auch in eine Strategie gegen Krebs umzusetzen.
Tumormoleküle als immungerechte Häppchen
Die Theorie dahinter lautet: Weil sie so abnorm sind, tragen Krebszellen Moleküle auf ihrer Oberfläche, die auf gesunden Körperzellen nicht vorkommen. Und genau hier könnte der Schlüssel für eine gezieltere Bekämpfung von Krebs liegen – vorausgesetzt, es gelingt, Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln, die sich ausschließlich gegen diese verräterischen Moleküle richten. Normale Zellen würden verschont. Und damit blieben auch einige der gefürchteten Nebenwirkungen heutiger Chemo- und Strahlentherapie aus, wie Haarverlust, Übelkeit und Schwächung des Immunsystems.
Geeignete, für Krebszellen spezifische Antigene zu finden erwies sich als schwierig. Doch bei einigen Krebsarten, etwa dem Schwarzen Hautkrebs (Melanom), ist das mittlerweile gelungen. Zu Beginn der 1990er Jahre identifizierten Arbeitsgruppen um Thierry Boon vom Ludwig-Institut für Krebsforschung in Brüssel und Steven A. Rosenberg vom Nationalen Krebsforschungszentrum in Bethesda, Maryland, unabhängig voneinander solche spezifischen Antigene des Melanoms. Therapien, die darauf abzielen, werden derzeit an freiwilligen Patienten getestet.
Dabei kommen in der Regel Vorläufer von dendritischen Zellen zum Einsatz, die aus dem jeweiligen Patienten isoliert und zunächst zusammen mit Tumor-Antigenen kultiviert wurden. Die entstandenen dendritischen Zellen nehmen das Material auf und präsentieren es "immungerecht". Geht alles glatt, machen die mit Antigenen voll beladenen Zellen das Immunsystem des Patienten gegen den eigenen Tumor mobil.
Etliche Arbeitsgruppen sowie mehrere Biotechnikfirmen erproben diese Strategie derzeit gegen weitere Krebsformen, darunter B-Zell-Lymphom, Prostata- und Dickdarmkarzinom. Das Melanom bleibt aber weiterhin ein Schwerpunkt. Im September 2001 berichteten beispielsweise zwei kooperierende Teams – meines und das von Steinman – über einen Erfolg versprechenden Ansatz: 16 von 18 Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, die mit entsprechend aufbereiteten dendritischen Zellen behandelt worden waren, zeigten erste, im Test erfassbare Anzeichen einer verstärkten Immunantwort gegenüber ihrem Krebs. Wichtiger noch: Neun Patienten entwickelten eine Immunantwort gegen mehr als zwei der verwendeten Antigene – mit dem Effekt, dass sich auch das Tumorwachstum verlangsamt hatte.
Derzeit arbeiten verschiedene Wissenschaftler daran, den Therapieansatz methodisch weiter zu verfeinern und ihn an einer größeren Zahl von Patienten zu erproben. Bislang wurden solche potenziellen Impfstoffe, die auf dendritischen Zellen basieren, nur an Patienten in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien getestet. Vermutlich sprechen aber Betroffene in frühen Stadien besser auf die Therapie an. Denn ihr Immunsystem steht noch nicht mit dem Rücken zur Wand.
Weiße Flecken und hohe Kosten
Allerdings gibt es verschiedene Bedenken: So könnten entsprechend scharf gemachte dendritische Zellen das Immunsystem auch veranlassen, irrtümlicherweise gegen gesundes Körpergewebe vorzugehen. Bei einigen der Melanom-Patienten, die als Erste überhaupt derartige Impfstoffe erhielten, traten weiße Flecken auf der Haut auf – ein Warnzeichen dafür, dass auch normale pigmentbildende Zellen, die Melanocyten, zerstört werden.
Wir müssen außerdem einkalkulieren, dass Tumorzellen sich durch Mutationen dem Immunsystem wieder entziehen – wenn sie infolge einer Genveränderung nicht mehr jene Antigene erzeugen, gegen die sich die Attacke richtet. Die fortwährende Veränderung von Tumorzellen ist freilich ein generelles Problem, das auch herkömmliche Krebstherapien oft scheitern lässt. Schließlich stellt sich aber noch die Kostenfrage. Denn die dendritischen Zellen müssen für jeden Patienten individuell hergestellt werden. Die vielen Einzelschritte beim Verfahren – von der Isolation der Zellen aus jedem Patienten über ihre Manipulation im Labor bis zur späteren Re-injektion – machen die Methode sehr zeitaufwendig und dementsprechend teuer. Doch auch hier tüfteln bereits einige Forscherteams an neuen Ansätzen.
Eine Idee: die Vorläufer der dendritischen Zellen gleich vor Ort – im Körper eines Patienten – zur Teilung anzuregen und über ihre Abkömmlinge das körpereigene Abwehrsystem gegen den Tumor mobilzumachen. Ein dafür geeignetes Cytokin entdeckte die Arbeitsgruppe um David H. Lynch von der Firma Immunex in Seattle (sie wurde vor kurzem von der Firma Amgen in Thousand Oaks, Kalifornien, übernommen). Bei Mäusen kurbelt der Botenstoff die Bildung von dendritischen Zellen an – mit der Folge, dass Tiere eines immunschwachen Stammes transplantiertes Tumorgewebe schließlich doch abstoßen.
Sogar Tumorzellen selbst besitzen ein großes Potenzial als "Krebs-Impfstoff", wie unter anderem Drew M. Pardoll von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, Maryland, festgestellt hat. Auf gentechnischem Wege werden die Krebszellen dazu gebracht, große Mengen an Cytokinen zu erzeugen und abzugeben, die wiederum dendritische Zellen aktivieren. Auch das gezielte Abschalten von dendritischen Zellen verspricht therapeutischen Nutzen, und zwar immer dann, wenn ihre Tätigkeit eine Krankheit eher verschlimmert als lindert. Dies ist bei Autoimmun-Erkrankungen der Fall: Hier versagt die "Eigentoleranz" und das Abwehrsystem richtet sich gegen körpereigene Strukturen.
Die erste, zentrale Instanz, die für Toleranz sorgt, ist der Thymus. In diesem Organ hinter dem Brustbein reifen die T-Zellen aus. Dort werden sie einer strengen Prüfung unterzogen.
Wenn unreife T-Zellen zu stark auf körpereigene Moleküle reagieren, werden sie eliminiert, bevor sie eine Chance haben, im Körper zu zirkulieren und Unheil anzurichten. Doch ist es unvermeidbar, dass einige Zellen dieser Auslese entgehen. Der Organismus verfügt daher über ein Backup-System, das als periphere Instanz für Immuntoleranz sorgt.
Eben diese periphere Immuntoleranz scheint bei Menschen gestört zu sein, die an Autoimmun-Krankheiten wie Rheumatoider Arthritis, Typ-1-Diabetes oder systemischem Lupus erythematodes leiden. Vergangenes Jahr wies ich mit meinen Kollegen nach, dass dendritische Zellen aus dem Blut von Patienten mit Lupus überaktiv sind. Sie setzen enorme Mengen an alpha-Interferon frei. Dieser immunstimulierende Botenstoff veranlasst Vorläuferzellen, bereits zu dendritischen Zellen auszureifen, noch während sie sich in der Blutbahn aufhalten.
Solche "frühreifen" dendritischen Zellen nehmen freie DNA auf, die ebenfalls in ungewöhnlich großen Mengen im Blut der Patienten vorkommt. Ergebnis: Das Immunsystem beginnt mit der Produktion von Antikörpern gegen die körpereigene DNA. Die Antikörper verklumpen mit der DNA zu Aggregaten, die Gefäß- und Nierenschäden verursachen. Wir glauben deshalb, dass ein Wirkstoff, der alpha-Interferon blockiert, an einer frühen Schaltstelle ansetzen und gegen Lupus helfen könnte. Denn so ließe sich möglicherweise die fatale frühzeitige Aktivierung der dendritischen Zellen im Blut verhindern. Eine ähnliche Strategie könnte in der Transplantationsmedizin dazu dienen, Empfänger von Spenderorganen vor einer immunologischen Abstoßungsreaktion zu schützen.
Missbrauch durch Mikroben
Selbst Aids-Patienten werden vielleicht einmal vom besseren Verständnis dendritischer Zellen profitieren. Im Jahr 2000 fanden Carl G. Figdor und Yvette van Kooyk von der Universitätsklinik St. Radboud im niederländischen Nijmegen heraus, dass bestimmte dendritische Zellen ein Molekül namens DC-SIGN herstellen. An diesem kann das HI-Virus andocken, wenn die Zellen ihm während ihrer regelmäßigen Patrouillengänge durch Schleimhäute oder tiefer liegende Gewebe begegnen. Wandern sie dann wenig später in einen Lymphknoten, bringen sie das Virus unabsichtlich mit großen Mengen an T-Zellen in Kontakt. Wirkstoffe, welche die Interaktion von DC-SIGN und HIV verhindern, könnten daher das Fortschreiten von Aids verlangsamen.
Auch andere Viren, darunter Masern- und Cytomegalie-Viren, oder Blutparasiten wie der Malariaerreger manipulieren dendritische Zellen für ihre eigenen Zwecke. Wenn etwa rote Blutkörperchen vom Malariaerreger befallen sind, binden sie sich an dendritische Zellen und verhindern so, dass diese ausreifen und das Immunsystem alarmieren. Mehrere Forschergruppen entwickeln derzeit Strategien, um Mikroben am Missbrauch dendritischer Zellen zu hindern. Einige versuchen sogar den Spieß umzudrehen und dendritische Zellen, die besonders stark mit Antigenen beladen sind, zur Bekämpfung der Krankheitserreger einzusetzen.
Eine zunehmende Zahl an Forschern und Firmen, die sich auf diesem Gebiet tummeln, gibt jedenfalls Anlass zur Hoffnung, dass wir mit diesen faszinierenden Zellen bald Krankheiten behandeln oder vorbeugen können, gegen die wir heute noch weitgehend machtlos sind.
Literaturhinweise
Dendritische Zellen – Spezialisten der Antigenpräsentation. Von Nikolaus Romani, Eckhard Kämpgen und Gerold Schuler in: Aspekte im Gespräch, Nr. 5, S. 26, 1996
Dendritic Cells as Vectors for Therapy. Von Jaques Bancherau et al. in: Cell, Bd. 106, S. 271, 2001.
Dendritic Cells and the Control of Immunity. Von Jaques Banchereau und Ralph M. Steinman in: Nature, Bd. 392, S. 245, 1998.
In Kürze
-Dendritische Zellen kommen in vielen Geweben vor, hauptsächlich aber in Haut und Schleimhäuten. Dort fangen sie Eindringlinge wie Bakterien und Viren ab und zerlegen diese. Die Bruchstücke präsentieren sie außen als Antigene, die das Immunsystem erkennen kann.
-Mit Antigenen beladen wandern die dendritischen Zellen zu Lymphknoten oder Milz, wo sie mit anderen Zellen des Immunsystems interagieren. Zu diesen gehören unter anderem B-Zellen, die für die Antikörperproduktion zuständig sind, oder T-Killerzellen, die Mikroben und infizierte Körperzellen direkt attackieren und vernichten.
-Speziell behandelte dendritische Zellen werden bereits in klinischen Versuchen als Impfstoffe gegen Krebs erprobt. Andere Forscher haben es sich zum Ziel gemacht, Fehlaktivitäten dieser Zellen zu stoppen, um so gegen Autoimmunkrankheiten wie Lupus erythematodes anzugehen.
Krebsimpfstoffe auf dem Prüfstand
Die Tabelle listet eine kleine Auswahl von Impfstoffen gegen Krebs auf, die direkt oder indirekt auf der Basis von dendritischen Zellen wirken. Die Unbedenklichkeit der potenziellen Impfstoffe wird in klinischen Studien der Phase I überprüft, ihre Wirksamkeit in Phase II und III. Sind diese erfolgreich verlaufen, kann der Hersteller die Zulassung für die Therapie beantragen.
| Name der Firma | Firmensitz | Art der Krebserkrankung | Status |
| ML Laboratories | Warrington, England | Melanom | Phase I steht bevor |
| Dendreon | Seattle, USA | Prostata, Brust, Eierstock, Darm, Gebärmutterkörper | Phase I (Brust, Eierstock, Darm, Gebärmutterkörper), Phase I (Brust), Phase III (Prostata) |
| Genzyme | Framingham, USA | Niere, Brust, Melanom | Phase I |
| Immuno-Designed Molecules | Paris, Frankreich | Prostata, Melanom | Phase II |
| Merix Bioscience | Durham, USA | Melanom | Phase I steht bevor |
| Oxford BioMedica | Oxford, England | Dick- und Enddarm | Phase I/II |
| Zycos | Lexington, USA | verschiedene Krebsarten (Impfstoffe auf DNA-Basis) | Phase I und II |
Aus: Spektrum der Wissenschaft 4 / 2003, Seite 38
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH


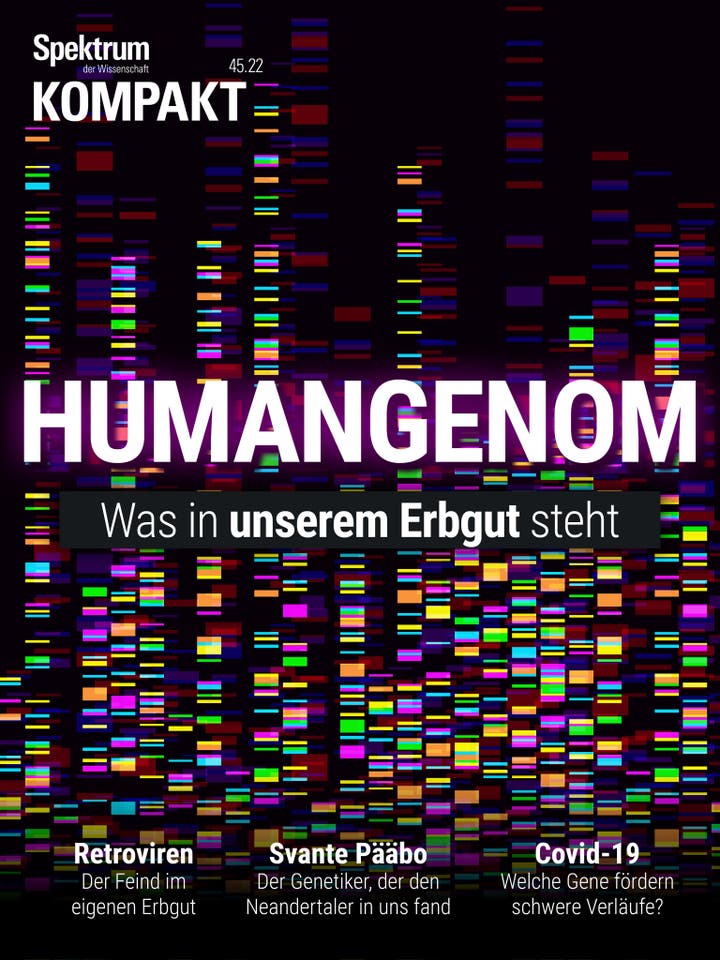
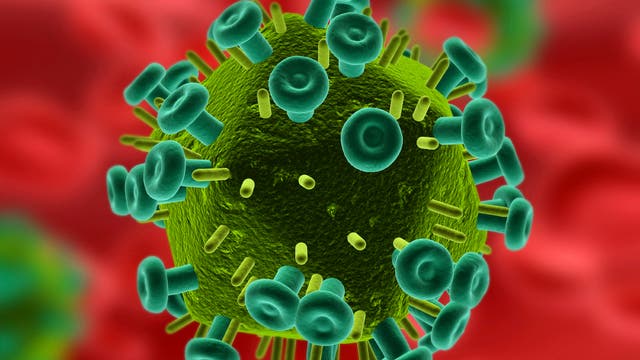
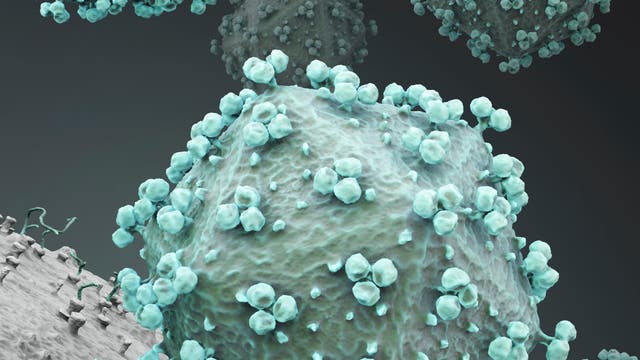

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben