Batterie: Mehr Power dank Nanoröhren
Das Rezept für den Superakku: Man nehme Lithium-Ionen-Akkus und ersetze Graphit durch Kohlenstoff-Nanoröhren.
Der Markt für Batterien und vor allem wiederaufladbare Akkus boomt, denn Handys, Camcorder, Notebooks, elektronische Terminkalender und ihre mobilen Verwandten benö-tigen reichlich Strom. Laut dem Beratungsunternehmen Frost & Sullivan setzte die Branche allein in Europa 1999 fast drei Milliarden Euro um, im Jahr 2006 könnten es sogar mehr als 4,6 Milliarden werden.
Akkumulatoren sollten klein, leicht, sicher und möglichst umweltfreundlich sein, aber auch über lange Zeit hohe Spannungen liefern und weit über tausend Lade-Entlade-Zyklen ohne Qualitätseinbuße überstehen. Hochpreisige Kandidaten sind Lithium-Ionen-Akkus, mit denen man Zellspannungen von bis zu vier Volt erreicht – Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus kommen nur auf die Hälfte. Nun soll die Latte doppelt so hoch gelegt werden – das Zauberwort heißt Kohlenstoff-Nanoröhren (Spektrum der Wissenschaft, Spezial 2/2001, S. 48).
Das einfach positiv geladene Ion des Elements Lithium hat für dieses Anwendungsgebiet attraktive Eigenschaften: Als Alkalimetall gibt es sein äußerstes Elektron bereitwillig ab, das dabei entstehende Ion ist klein und leicht. Metallisches Lithium lässt sich in Batterien jedoch nicht verwenden, wie erste Versuche rasch zeigten: Kurzschlüsse waren häufig, dabei wurde die Zelle heiß und verabschiedete sich unter Rauchzeichen. Nun war schon lange bekannt, dass man in Graphit, einem aus Kohlenstoffringen bestehenden Kristall mit Schichtstruktur, Fremdatome einlagern und sogar partiell chemisch binden kann (fachlich heißen solche Komplexe Interkalations- beziehungsweise Einlagerungsverbindungen).
Ein eingelagertes Lithium-Atom gibt sein äußerstes Elektron an den Kohlenstoff ab, das resultierende Ion ist nur 0,12 Nanometer groß, es passt daher gut zwischen die Kohlenstoffschichten von Graphit, deren Abstand etwa 0,337 Nanometer beträgt. Rein theoretisch könnte jeder Kohlenstoff-Sechsring im Graphit ein Lithium-Ion binden, jedoch ist die Abstoßung zwischen den positiven Ionen so groß, dass nur jeder zweite Platz besetzt wird. Somit kommen auf ein Lithium-Ion im Schnitt sechs Kohlenstoffatome, über die die negative Ladung "verschmiert" ist.
Wegen dieser negativen Ladung bildet also in der Batterie der mit Lithium-Ionen angereicherte Graphit die Anode, die beim Entladevorgang Elektronen an den Verbraucher abgibt. Im Inneren des Akkus diffundieren währenddessen die positiven Lithium-Ionen zur Kathode, wo die Elektronen über den äußeren Stromkreis wieder ankommen. Die Kathode besteht in der Regel aus einem Lithium-Metall-Oxid, wobei das Metall Kobalt (das leicht toxisch und daher bedenklich ist!), Nickel oder Mangan sein kann. Diese Oxide haben ebenfalls eine Schichtstruktur, in welche die Lithium-Ionen hineindiffundieren können. Beim Laden treibt man diese unter Aufwendung von elektrischer Energie wieder in den Graphit hinein, kehrt den Vorgang also um.
Weil das Lithium-Ion so klein ist, ändert sich während dieser Prozesse die Struktur des Kathoden- und Anodenmaterials nur geringfügig – ein für die technische Realisierung sehr wichtiger Aspekt. Als Maß für die Leistungsfähigkeit einer Batterie dient die Kapazität, meist in Amperestunden pro Kilogramm (Ah/kg) angegeben; die Lithiumbatterie mit Graphitanode erreicht maximal etwa 370 Ah/kg, und dieser Wert wird durch die Anzahl der Lithiumatome pro Masse bestimmt.
Ein ganzer Zoo von Nanoröhren
Lange Zeit kannte man nur zwei Kohlenstoffmodifikationen: den harten Diamant und den Graphit mit seiner oben vorgestellten Schichtstruktur. Das änderte sich 1985 mit der Entdeckung der Fullerene (C60, "Bucky-Balls") und wenig später, im Jahr 1991, mit der der Nanoröhren – so genannt wegen ihres geringen Durchmessers im Nanometerbereich. Die Wand einer Nanoröhre ähnelt einer Schicht im Graphit, denn sie besteht ebenfalls aus Kohlenstoffringen. Allerdings gibt es nicht eine einzige Nanoröhrenstruktur, sondern man findet einen ganzen Zoo: einwandige, mehrwandige, gerade und verdrillte, lange und kurze – die relativen Anteile sind jeweils abhängig von der Herstellung. Sehr bald nach der Entdeckung der Nanoröhren sah man in ihnen auch ein ideales Speichermedium, zum Beispiel für Wasserstoff, aber eben auch für Lithium-Ionen in Batterien.
Den Anfang machten die Theoretiker. Mit moleküldynamischen Methoden wurde der Einbau von Alkali-Ionen wie Li+ und Na+ in einwandige Nanoröhren simuliert. Die Voraussage lautete: Bündel von einwandigen Nanoröhren können mehr davon fassen als Graphit. Als theoretische Sättigungsgrenze fand man ein Verhältnis Lithium zu Kohlenstoff von 1:1,7, das möglicherweise wegen der Abstoßung der positiven Lithium-Ionen nicht realisierbar ist. In einem solchen Bündel sind die Lithium-Ionen nicht nur in den Nanoröhren, sondern auch dazwischen eingelagert (Physical Review Letters, Bd. 85, Heft 8, S. 1706, 2000).
Eine Forschergruppe an der Universität North Carolina in Chapel Hill verwendete daraufhin eine Methode des Nobelpreisträgers Richard Smalley, um Kohlenstoff-Nanoröhren herzustellen und das Prinzip weiter zu erkunden. Bei diesem Verfahren wird ein Kohlenstoffgas durch Laserbeschuss von Graphit erzeugt, aus dem sich dann mit Hilfe von Katalysatoren hauptsächlich einwandige Nanoröhren bilden. Die so erhaltenen Bündel waren über zehn Mikrometer lang und hatten einen Durchmesser von dreißig bis fünfzig Nanometer; eine einzelne Nanoröhre hatte im Schnitt 1,4 Nanometer. Nachdem die Wissenschaftler die Proben gereinigt hatten, ätzten sie einen Teil mit starker Salpetersäure und Schwefelsäure. Das ergab kürzere Röhren und bei 24-stündiger Behandlung noch dazu eine sehr enge Verteilung der Längen (0,3 bis 0,5 Mikrometer). Um das Lithium in die Bündel einzubringen, ließen sie Lithiumborhydrid mit dem Kohlenstoff der Nanoröhren reagieren. Dabei stellte sich heraus, dass die am längsten geätzte Probe besonders viel Lithium-Ionen binden konnte. Vermutlich haben die Röhrchen dort offene Enden und zusätzliche Wanddefekte (Physical Review Letters, Bd. 88, S. 015502-1, 2002), sodass die Ionen auch in die Röhren eindringen können.
Ähnliche Resultate werden aus dem John H. Glenn Research Center der Nasa in Cleveland (Ohio) gemeldet (www.nasatech.com/Briefs/June00/LEW16727.html). Dort wurden mit Lithium-Ionen "gefüllte" offene einwandige Nanoröhren auch schon als Anodenmaterial in Testbatterien verwendet. Die gemessene Kapazität betrug 640 Ah/kg, was fast der doppelten Kapazität von normalen mit Lithium-Ionen gefüllten Graphit-Anoden entspricht. Interessanterweise wurden jedoch für mehrwandige Röhren nur etwa 385 Ah/kg erzielt – vermutlich eine Folge von Wanddefekten, die bei einwandigen Nanoröhren sicher leichter auftreten.
Die mobilen Energiepakete der Zukunft könnten solche Winzlinge im Inneren tragen. Auch wenn damit die maximale Aufnahmefähigkeit von Kohlenstoff für Lithium-Ionen erreicht sein dürfte, fühlt man sich wieder an Richard P. Feynmans Vortragstitel erinnert: "There’s plenty of room at the bottom."
Aus: Spektrum der Wissenschaft 4 / 2002, Seite 90
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH



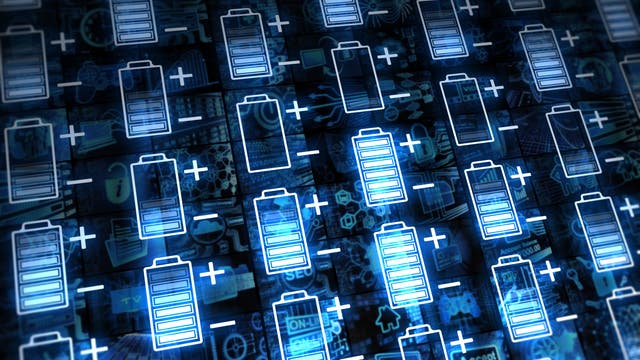


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben