Wissenschaftsphilosophie: Gute Theorien, schlechte Theorien
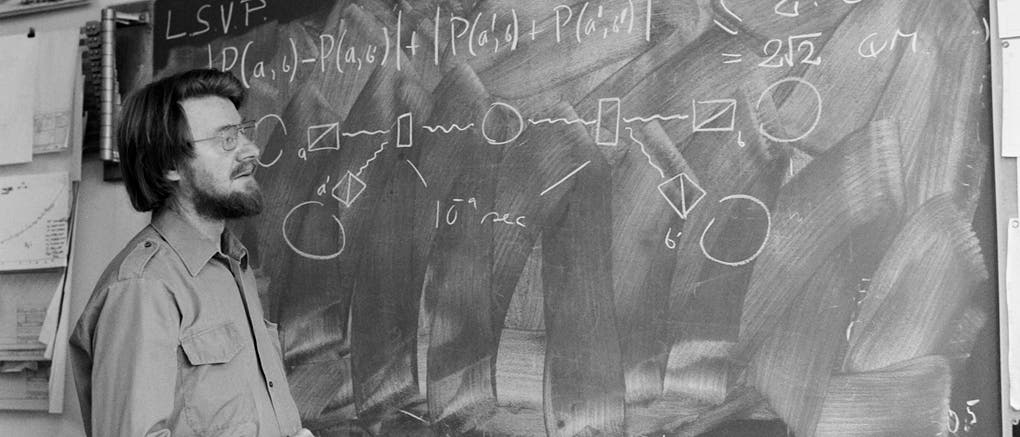
Wie viele seiner Zeitgenossen war Karl Popper von den revolutionären Arbeiten Einsteins fasziniert. So geht Forschung, dachte der Wiener sich und versuchte, sie philosophisch zu beschreiben. Er und seine Kollegen im zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch jungen Fach der Wissenschaftsphilosophie wollten genau erfassen, was Erkenntnissuche wie bei Einstein ausmacht: der kritische Diskurs über nachprüfbare Behauptungen und das Verwerfen alter Theorien zu Gunsten besserer.
Der Fortschritt kann spektakulär sein. Im 19. Jahrhundert diskutierten Physiker noch über den Äther, den sie sich als Medium vorstellten, in dem sich Licht ausbreitet. In den 1880er Jahren versuchte der Experimentator Albert Michelson zunächst in Potsdam, später zusammen mit Edward Morley in Chicago den Unterschied zwischen zwei Lichtstrahlen zu messen, die einmal in Bewegungsrichtung der Erde und einmal senkrecht dazu ausgestrahlt werden. Das Licht müsste sich im Äther mit leicht unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausbreiten. Das wäre vergleichbar zu einem Schwimmer, der sich gegen den Strom langsamer fortbewegt, und einem zweiten, der quer dazu rascher vorankommt. Doch Michelson und Morley fanden keinen Unterschied. Die Lösung lieferte Albert Einstein 1905, indem er den Äther in seiner speziellen Relativitätstheorie einfach wegließ. Ihr zufolge ist die Geschwindigkeit des Lichts immer gleich, egal, wie schnell und in welche Richtung es sich bewegt.
Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit kann man auch als Naturgesetz bezeichnen …
Schreiben Sie uns!
1 Beitrag anzeigen